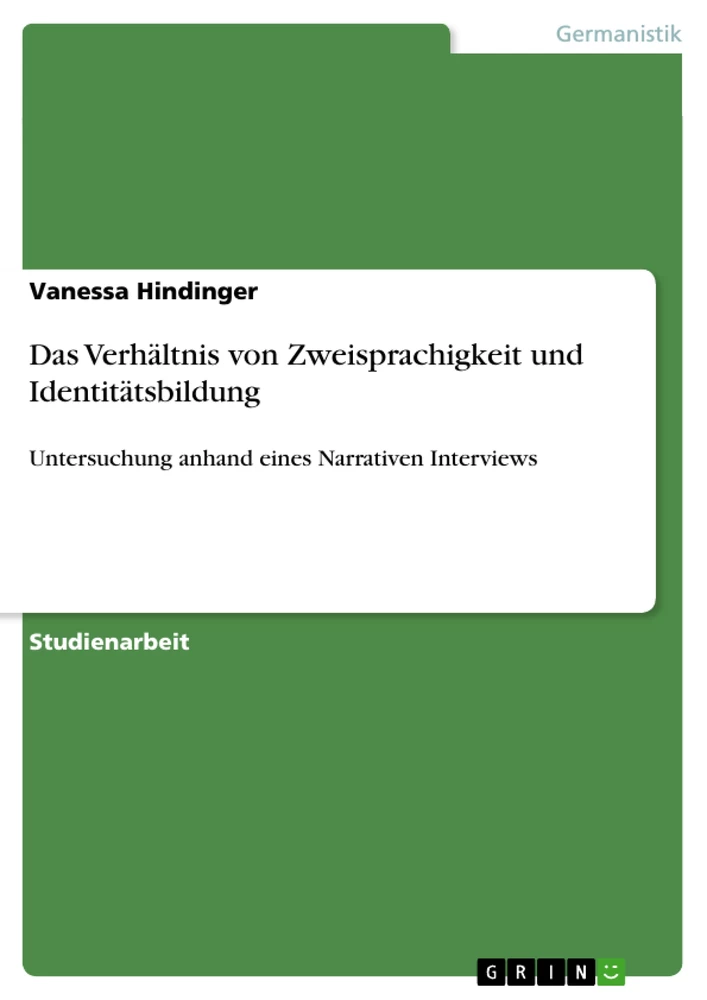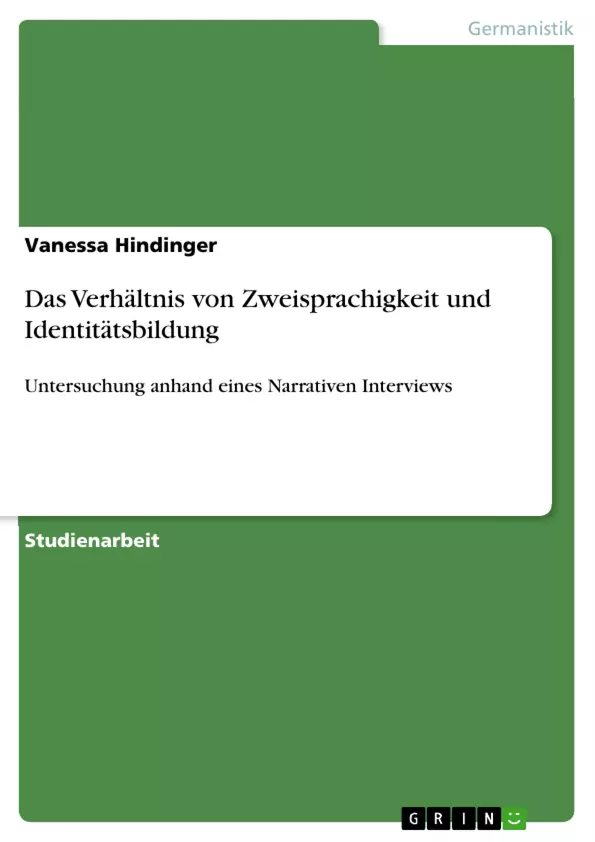Den zentralen Kern dieser Hauptseminarsarbeit bildet ein narratives Interview mit einer jungen Frau, deren Eltern von Polen nach Deutschland migriert sind. Sie ist zweisprachig erzogen und ihre Aussagen sollen hier als Forschungsgrundlage für das Verhältnis der Sprache zur Identität dienen. Ferner wird untersucht, wie die interviewte Person mit ihrer Zweisprachigkeit auch die kulturelle „Doppel-Identität“ verinnerlicht hat und wie sich der jeweilige Wortschatz und Sprachgebrauch auf die Persönlichkeit und die mögliche Wandlung ihrer auswirkt.
Inhaltsverzeichnis
Sprachidentität und Mehrsprachigkeit 1
Nach Wilhelm Oppenrieder und Maria Thurmair
Deutsch-polnische Familien nach Barbara Jańczak
Die zweite Generation von Migranten Nach Paul B. Hill
Das narrative Interview
Gesprächsanalyse
Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen
Hinweise zum geführten Interview
Erklärungen zum Transkript
Bibliografie
Sprachidentität und Mehrsprachigkeit
Den zentralen Kern dieser Hauptseminarsarbeit bildet ein narratives Interview mit einer jungen Frau, deren Eltern von Polen nach Deutschland immigriert sind. Sie ist zweisprachig erzogen und ihre Aussagen sollen hier als Forschungsgrundlage für das Verhältnis der Sprache zur Identität dienen. Ferner wird untersucht, wie die interviewte Person mit ihrer Zweisprachigkeit auch die kulturelle „Doppel-Identität“ verinnerlicht hat und wie sich der jeweilige Wortschatz und Sprachgebrauch auf die Persönlichkeit und die mögliche Wandlung ihrer auswirkt. Alle persönlichen Daten die zu einer möglichen Identifizierung der interviewten Person dienen werden aus datenschutzrechtlichen Gründen anonymisiert. So kann auch sichergestellt werden, dass lediglich die Aussagen in der Gesprächsanalyse Forschungsgegenstand sind und voreiligen Schlüssen entgegen gewirkt werden kann. Die Interpretation des Gespräches erfolgte nach der Transkription und betrachtet ausschließlich signifikante Aussagen zum Themenbereich „Sprache und deren Einfluss auf die persönliche Identität“. Unter Identität wird hierbei nach dem Sozialpsychologie-Lexikon von Günther Wiswede verstanden: „…das Wissen um eigene Charakterzüge, Fähigkeiten, Meinungen samt der damit verbundenen Gefühle und Bewertungen.“[1] Und weiter wird die Identität als „Bewusstheit des eigenen Ich“ definiert. Gerade die Eltern spielen aus sozialpsychologischer Sicht bei der Bildung einer eigenen Identität eine entscheidende Rolle, neben der einzunehmenden Rolle gegenüber anderen (nach Mead) und die Entscheidung über Gruppenzugehörigkeit(en). Im (aus deutscher, beziehungsweise europäischer Sicht) interessanten Fall der relativ untypischen Zweisprachigkeit ist eine Gesprächsanalyse über Erfahrungen mit zwei Sprachen und zwei Kulturen besonders spannend. Im Folgenden wird nach Oppenrieder und Thurmair genauer auf die Sprachidentität im Kontext von Mehrsprachigkeit eingegangen.
Nach Wilhelm Oppenrieder und Maria Thurmair
Die Sprachidentität im Kontext von Mehrsprachigkeit wird auch im gleichnamigen Essay von Wilhelm Oppenrieder und Maria Thurmair behandelt.[2] Zuerst wird hier der Begriff der Identität an sich geklärt: „Typischerweise ist eine Art Selbstähnlichkeit gemeint, die zeitliche Abschnitte einer Person miteinander verknüpft, zeitliche Abschnitte in denen sich die Person in irgendeiner Weise zeigt (z.B. durch Handlungen oder die Kundgabe von Einstellungen).“[3] Auch wird hier die gruppenbezogene Identität, die jede Person quasi als Teilidentität in sich trägt, betont. Gruppenmitglieder befolgen bestimmte Handlungsmuster oder Einstellungen und zeigen sich somit der Gruppe (Fußballclub, Deutscher, Studentin) zugehörig. Oppenrieder und Thurmair zeigen also, dass eine Identität kein feststehendes Konstrukt ist, in welches wir etwa hineingeboren werden. Vielmehr handelt es sich bei einer Identität um ein kohärentes Gefüge aus kultureller Prägung, persönlicher Neigung, angeborenem Verhalten, anerzogenen Sichtweisen und weitere.
Interessant ist hier als Forschungsgegenstand die Sprache, weil sie gerade im Hinblick auf gruppenbezogene Teil-Identitäten eine große Rolle spielt. Die kommunikativen Beziehungen innerhalb einer gleichsprachigen Gruppe sind nämlich Hauptmerkmal einer Gruppe, gerade in Bezug auf die sprachliche Selbst- und Fremdwahrnehmung. „Sprache muss nicht konstitutiv für den Aufbau einer Identität sein, aber sie ist es sehr häufig. Insbesondere bei politisch-sozialen Großgruppen wie Nationen wird typischerweise offiziell eine einzige Sprache als identitätsstiftend angesehen.“[4] Eine Sprache ist nämlich unter anderem in ihrer Funktionalität ein identitätsstiftendes Merkmal, als dass sie Menschen miteinander durch Ausdrucksweisen und Wortschatz etwa verbindet. Sie also auch ein signifikantes Symbol einer Einheit oder einer Gruppe. Daher spielt auch die Sprache, abgesehen von persönlichen Charaktereigenschaften oder Erziehung eine wichtige Rolle in der Identitätsbildung, da eben mit einer neuen Sprache auch ein neuer Habitus und eine neue Kultur mit in die eigene Person hineingenommen werden.
Laut Oppenrieder und Thurmaier muss ein Individuum selbst auch anerkennen, dass eine Sprache Gruppenzugehörigkeit markiert und somit auch das Individuum, welches der Gruppensprache mächtig ist, als Gruppenmitglied kennzeichnet. „Du bist was du Sprichst“ – könnte hier vereinfacht als Formel für die These Oppenrieder und Thurmaiers stehen. Als Teil einer Sprache bin ich quasi Teil einer Gruppe und somit auch Teil einer bestimmten Kultur. Spreche ich NUR diese Sprache, so bin ich absolut in dieser Gruppe verwurzelt, fühle mich ihr auch vollkommen zugehörig und bin mir meiner Person im Hinblick auf diese Gruppe gewiss. Interessant ist Sprache in Bezug auf die persönliche Identität und Gruppenzugehörigkeit also, wenn ich mehrere Sprachen spreche oder sprechen muss; quasi in mehreren Gruppen und Kulturen bin oder sein soll.
„Mehrsprachigkeit bei den Individuen ist nach dieser gängigen Ansicht für den Verkehr zwischen den Großgruppen zwar notwendig, aber nur auf der sicheren Basis einer einzigen Muttersprache und nach Möglichkeit kanalisiert durch gezielte Ausbildung.“[5] Eine Mehrsprachigkeit alleine erzeugt in uns selbst noch keine neuen Teilidentitäten, obwohl wir durch einen neuen und andersartigen Wortschatz auch eine neue Kultur miterleben. So bleiben wir, etwa im Englischunterricht in der Schule, in unserem sicheren Umfeld. Unser Umfeld und unsere Basis sind weiterhin deutsch und deutschsprachig, wir haben also einen klaren Standpunkt und keinerlei Konflikte mit der Zugehörigkeit zu einer Gruppe etwa, denn wir sind nach wie vor Deutsche, die zusammen eine Fremdsprache lernen, unsere Muttersprache und unsere Kultur teilen wir aber weiterhin miteinander in der Gruppe. „Wenn eine einzige Sprache als identitätsstiftend für eine Gruppe angesehen wird, so muss sie auch bei den einzelnen Mitgliedern als solche anerkannt sein […], andere Sprachen sind demgegenüber sozusagen nur geduldet…“[6]
Zu beachten ist auch die Tatsache, dass nur bestimmte Sprachen gelehrt werden. Englisch, Französisch, Spanisch oder Latein werden am häufigsten in Schulen angeboten, da diese Sprachen mit Prestige oder vermeintlichem Nutzen versehen sind. „Der allgemeine Hintergrund für die Bewertung solcher Phänomene sind Vorstellungen über den Aufbau einer gelungenen Identität bei einer Gruppe oder einem Individuum. Zentral ist hierbei, in welchem Ausmaß heterogene Komponenten der Identität toleriert werden, d.h. in welchen Bereich die Grenze für Vielfalt gezogen wird, jenseits deren ein Zerfall der Identität befürchtet wird, mit den Folgen, dass auf der einen Seite die Gruppe nicht mehr ihre wesentlichen Funktionen erfüllen kann, auf der anderen Seite das Individuum nicht mehr in bestimmte Gruppen integrierbar ist. Hinter der genannten typischen Einschätzung der Mehrsprachigkeit steht eine recht unflexible und eindimensionale Vorstellung von Identitätsbildung…“[7]
Im folgenden Interview wird besonders auf die migrationsbedingte Bilingualität eingegangen und auf die Dimension der Funktionalität, welche sich aus einer Migrationssituation notwendigerweise ergibt. Besonders soll der Fokus darauf gelegt werden, ob sich die Sprachen polnisch und deutsch voneinander in ihrer Funktionalität und in ihrer Funktionsbereichen unterscheiden. Der Fall der nicht eindeutigen Funktionsabgrenzung wirft besonders die Frage auf, „…inwieweit die Mehrsprachigkeit […] in die alltäglichen und privaten Beziehungen der Sprachbenutzer eingreift oder nicht und inwieweit die beteiligten Sprachen in Konkurrenz zueinander treten.“[8]
Weiter wichtig sind laut Oppenrieder und Thurmair auch die verschiedenen Kompetenzgrade einer Sprache, also das eigentliche Sprachniveau. In der klassischen Migrationssituation kann fast ausschließlich von unterschiedlichen Funktionsbereichen (Familie versus Arbeitsplatz) und von unterschiedlichen Kompetenzgraden (Muttersprache versus erlernte Sprache) ausgegangen werden. „Was die Bewertung dieser Situationen betrifft, so wird sie meist – von außen wie von innen – eher als problematisch gesehen und dementsprechend tendenziell negativ bewertet. Die nicht-dominante Sprache stört sozusagen die Loyalität gegenüber der dominanten Sprache, die ihrerseits zu den identitätsbildenden Konstanten der umgebenden Großgruppe gehört.“[9] Das diese Unvereinbarkeit der Identität auch andersartig wahrgenommen werden kann, wird im Folgenden an der Gesprächsanalyse des Interviews mit der zweisprachig aufgewachsenen Probandin aufgezeigt. Häufig jedoch werden im Zusammenhang mit Zweisprachigkeit Begriffe wie „Dazwischen“ oder Empfindungen wie „Unterwegs sein“ und „Sich zwischen zwei Welten befinden“ genannt. Die Mehrsprachigkeit wird also oft negativ; zumindest aber nicht neutral im Hinblick auf die Identität von Personen bewertet. „In der gleichen allgemeinen Situation – nämlich der der Migranten, zum Beispiel in Deutschland – kann aber auch eine positive Bewertung der Mehrsprachigkeit entstehen: dann nämlich, wenn der Erwerb der zweiten Sprache und der Erwerb der zweiten Kultur nicht als Gefahr für die erste gesehen wird und nicht als Notwendigkeit, eine Identität durch die andere abzulösen, sondern wenn die Mehrsprachigkeit und die Multikulturalität als Identitätsmerkmal gesehen wird. Dies scheint zumindest auf einen Teil der jungen späteren Migrantengeneration zuzutreffen: Diese sehen […] ihre Identität gerade in dieser Zweisprachigkeit und Bikulturalität.“[10]
Deutsch-polnische Familien nach Barbara Jańczak
Die Dissertation von Barbara Jańczak (2011) beschäftigt sich anhand von Befragungen und Interviews mit deutsch-polnischen Familien, deutschen Familien, die in Polen leben oder mit polnischen Familien, welche in Deutschland leben. Untersucht wurden hier hauptsächlich die bilingualen und die bikulturellen Aspekte in den Familien und deren (emotionale) Ansichten darüber. Die interessantesten und für die folgende Gesprächsanalyse wichtigsten Forschungsergebnisse sollen hier knapp zusammengefasst werden. Zum Vergleich der unterschiedlichen Kultur-Dimensionen schreibt Jańczak: „Der Vergleich der Kulturen von Polen und Deutschland weist die größten Werteunterschiede in zwei Bereichen auf, nämlich bezüglich der Machtdistanz und der Unsicherheitsvermeidung.“[11] Im Sozialpsychologie-Lexikon wird der Begriff der Machtdistanz als psychische Distanz zu Mächtigeren, beziehungsweise Ohnmächtigen definiert. „…wonach Personen bestrebt sind, die psychische Distanz zu den mächtigeren Gruppenmitgliedern zu verringern, zu den weniger mächtigen jedoch zu vergrößern.“[12] Im Hinblick auf die Familienverhältnisse bezieht sich eine Machtdistanz eher auf die Beziehungen innerhalb einer Familie, vorzugsweise auf die zwischen Eltern und deren Kindern. „In Bezug auf das Familienleben lässt sich feststellen, dass die meisten Eltern aus Ländern mit niedriger Machtdistanz (wie Deutschland) viel weniger Wert auf die Gehorsamkeit der Kinder legen als die Eltern aus Länder mit einer hohen Machtdistanz (Polen)“[13] Die allgemeine Auffassung von „Familie“ könnte hier zur unterschiedlichen Machtdistanz führen. Gemessen und in einem Balkendiagramm dargestellt von Geert Hofstede, zeigen die Werte auch eine voneinander abweichende Wahrnehmung von Sicherheit, beziehungsweise Unsicherheiten. Wie sich eine Gesellschaft gegenüber Unsicherheiten oder dem bloßen Gefühl der Unsicherheit verhält, wird durch Institutionen wie Familie, Staat, Schule definiert und tradiert. In beiden Fällen hat Polen die höheren Werte, das heißt, die Abhängigkeit der Kinder zu den Eltern ist in Polen größer als in Deutschland, ebenso wie die Bemühungen, durch Regeln und Gesetze etwa, Unsicherheiten und Risiken zu vermeiden.[14] „Andere kulturbedingte Werte sind für beide Gesellschaften vergleichbar. Der Grad an Individualismus […], die Maskulinisierung beider Kulturen…“
Zur Bilingualität in Deutsch-polnischen Familien schreibt Jańczak, dass ihrer Meinung nach Identität und Sprache eng miteinander verknüpft sind und verweist hier auf Mead, Habermas, Lambert und Goffman.[15] „Dank der Sprache kann in Folge der Selbst- und Fremddarstellung die Identität präsentiert und wahrgenommen werden.“[16] Jańczak verweist weiter auf Le Page und Tabouret-Keller, deren Begriff der Identitätsakte und die These, dass Sprechhandlungen, also das gesprochene Wort, eine hörbare und gefestigte Äußerung der Identität einer Person ist.[17] Wie Oppenrieder und Thurmair erörtert auch Jańczak das Gruppenzugehörigkeitsgefühl und die Sprache als eindeutiges Merkmal von Zugehörigkeit oder Ausgeschlossenheit in Bezug auf Gruppen (oder Kulturen/ Gesellschaften).
Gerade die zweisprachige Erziehung von Migrantenkindern ist interessant: „Diejenigen Eltern, die Wert auf eine bilinguale Erziehung ihrer Kinder legen, stehen vor der Wahl der besten Erziehungsmethode, die, gemäß ihrer Sprachkenntnisse und familiären Situation, die möglichst effektivste Erziehung gewährleisten wird. Es muss dabei klar sein, dass die Entscheidung für die Bilingualität der Kinder von Anfang an die Beziehung Kinder-Eltern beeinflusst.“[18] Es gibt diverse Modelle, ein Kind zweisprachig zu erziehen: Ein Elternteil spricht eine Sprache, es gibt eine Familiensprache (meist die Minoritätensprache) und eine Umgebungssprache oder beide Eltern sprechen beide Sprachen, „switchen“ allerdings aufgaben-, beziehungsweise situationsabhängig. Bedeutend für zweisprachige Personen ist auch die Prestige, die eine Gruppe einer Sprache zuordnet: „Einer der wichtigsten Faktoren, welche das Aufrechterhalten beider Sprachen in der jeweiligen bilingualen Familie beeinflussen kann, ist die Einstellung gegenüber der jeweiligen Sprache. Sind die Familienmitglieder negativ gegenüber der Sprache eingestellt, so werden sie nicht für den Erhalt der Sprache plädieren. Schätzen sie den Status der Sprache als hoch ein und/oder sind sie positiv zu ihr eingestellt, werden sie sich höchstwahrscheinlich dafür einsetzen, die Sprache zu pflegen.“, so Jańczak.[19] Die von Jańczak befragten deutsch-polnischen Familien gaben zum mehrheitlich an, dass Deutsch eine bedeutende Sprache in der Welt für sie sei (51 % aller Befragten) und dass das Polnische schwieriger zu erlenen sei (39 % aller Befragten).[20]
In Jańczaks Studie ergaben die Ergebnisse weiter, dass die meisten Eltern ihre Kinder zweisprachig erziehen (84 % aller Befragten), dass dies aber keine Angabe über ein gleiches Sprachniveau beider Sprachen sei. Die 16 % der Eltern, die auf die zweisprachige Erziehung verzichteten gaben als Gründe eine Kompliziertheit zweisprachiger Erziehung, sowie die Gefahr einer Andersartigkeit des Kindes an.[21]
Zum Thema Identität schreibt Jańczak, dass ihre Gesprächsanalyse mit den deutsch-polnischen Familien zu dem „Argumentationsmuster: SPRACHE UND IDENTITÄT SIND NICHT ZU TRENNEN“ geführt hätte.[22] Unter anderem verwiesen Befragte nämlich besonders häufig auf emotionale Gründe für die gewünschte Zweisprachigkeit bei Kindern (Muttersprache, Heimat) und die Kinder selbst auf ähnliche Gründe. „Für die in bilingualen Familien aufwachsenden Kinder ist Bilingualität ein natürlicher Zustand. Falls die Eltern sich an die feste Zuschreibung der jeweiligen Sprache zu ihrer eigenen Person halten, werden sie vom Kind mit der Sprache assoziiert. Das Kind weiß, dass es zwei Sprachen in der Familie gibt und hält das für selbstverständlich.“[23]
Einhergehend mit der Mehrsprachigkeit wird oft auch eine Bikulturalität zum tagtäglichen Gegenstand und zum Teil der Identität. Oft wird hier vom Umfeld und von den Eltern, als auch von der zweisprachigen Person selbst die Forderung gestellt, bewusst oder unbewusst, man möge sich doch bitte einer deutschen ODER einer polnischen Identität zuordnen. Jańczak betont, dass gerade in der Pubertät und/oder für Schulkinder die Akzeptanz in einer Gruppe eine enorme Bedeutung gewinnt und dass hier oft der Grund für eine Entscheidung der zweisprachigen Person liegt, unter anderem abhängig vom Status der „anderen Identität“. In den Gesprächsanalysen Jańczaks wird allerdings auch deutlich, dass die genaue Zuordnung zu einer Gruppe ein großes Konfliktpotential bietet, sowohl für das Umfeld, als auch für die zweisprachige Person selbst. Diese Situation, in der sich die zweisprachige Person in Entscheidungszwang wähnt wird auch im folgenden narrativen Interview mit einer jungen Frau, deren Eltern von Polen nach Deutschland emigriert sind, deutlich.
Die zweite Generation von Migranten Nach Paul B. Hill
Die zweite Generation von Migranten beschreibt Paul B. Hill als Sonderfall im Bereich der Identität. „Sie erlebe den Einfluß von zwei divergierenden Kulturen in einer Phase der noch nicht abgeschlossenen Persönlichkeitsbildung. Die Eltern und ggf. die in der Herkunftsgesellschaft verbrachte Kindheit wirke im Sinne einer traditionalen Sozialisation. Die unausweichlichen Kontakte zur Aufnahmegesellschaft […] hingegen vermittelten fremdethnische Verhaltens- und Handlungsstandards.“[24] Bill betont hier vor allem das Alter, gerade die Kindheit und entscheidend die Pubertät, welche für die Bildung einer stabilen Persönlichkeit von großer Wichtigkeit ist. Er betont weiter die Basispersönlichkeit, welche ein Kind früh entwickelt. Als Beispiel zur Veranschaulichung nennt Bill hier die Kinder, die erst zwischen 6 und 14 Jahren nach Deutschland gekommen seien: Diese Gruppe „besitzt eine an der Herkunftskultur orientierte Basispersönlichkeit. Eine fundamentale, identifikative Assimilation findet (ähnlich der ersten Generation) nicht statt; man bleibt letztlich Ausländer“[25] Entscheidend für den Einfluss der Sprache auf die Identität ist wohl also die Kontroverse, in einer Kultur geboren und aufgewachsen zu sein, innerhalb der Familie aber eine andere Kultur, inklusive Sprache, zu erleben. Offensichtlich birgt dieses Andersartig sein der eigenen Familie gegenüber der Öffentlichkeit, gerade für Kinder im Gegensatz zu anderen Gleichaltrigen, die nicht zweisprachig aufgewachsen sind, ein Konfliktpotential. „Das zentrale Problem für die Angehörigen der zweiten Generation besteht […] darin, daß sie in wechselnden Kontexten für ihre Interaktionspartner nicht mit eindeutigen Askriptionen zu kennzeichnen sind. Diese von der Umgebung induzierten Unsicherheiten spiegeln sich in inkonsistenten Selbstinterpretationen wieder.“[26] Wichtig für die eigene Selbstwahrnehmung, beziehungsweise für das Schaffen eines Selbstbildes, ist also vor allem die Fremdwahrnehmung, beziehungsweise das Bild, welches andere von einem Menschen haben. Die Fremdwahrnehmung wird auf mich als Menschen projiziert und ich fasse genau diese als meine eigene Wahrnehmung von mir selbst auf. Da in der Regel das Umfeld eines Menschen sich schnell, zumindest schneller als der Mensch selbst, ein Bild von ihm macht, wird er sich daher auch (zeitlich gesehen) immer zuerst mit der Fremdwahrnehmung auseinandersetzen, bevor er sich selbst durch sich selbst wahrnehmen kann.
Bill geht in seinen Überlegungen weiter auf die Rolle des „Streß“ ein und erklärt, dass dieser durch die ständig wechselnden Sprach- und Kulturunterschiede und die damit einhergehenden sich verändernden erwarteten Verhaltensmuster und durch die Wahrnehmung, man habe eine geteilte Identität, entstünde. Kompensiert würde das oft durch das Vernachlässigen einer von beiden Sprachen oder die ethnisch homogene Festlegung des Freundeskreises. Oft hätten Migranten der zweiten Generation das Problem, nicht beiden sprachlichen und kulturellen Bereichen gleich gerecht zu werden, was zusätzlichen Streß verbreiten würde, da an die gleich gerecht verteilte Zuwendung zu beiden Sprachen und Kulturen vor allem Erwartungen aus zwei „Lagern“ (Familie und Umfeld) geknüpft wären. Entscheidend ist dieser Punkt gerade in einer nicht-pluralistischen und einsprachigen Gesellschaft wie in Deutschland.
Die ständig wechselnden und teilweise für die Person widersprüchlichen Anforderungen, die es zu erfüllen gilt, können, wird der Stress nicht kognitiv oder durch ausgleichende Handlungen (etwa Funktionsbereiche für beide Sprachen festlegen), zu einer Identitätskrise oder gar zu einer Identitätsspaltung führen. „Eine Identität, als Vorstellung einer Person von sich selbst, kann sich mangels konstanter Orientierung und Identifizierung nicht ausbilden.“[27] Weiter betont Bill jedoch, dass solche Situationen nur als außerordentliche Stresssituationen empfunden werden, wenn sie täglich auftreten würden, da somit die Person täglich aufs neue und vermutlich ohne absehbares Ende vor schwierigen Handlungsentscheidungen stehen müsste. Bill betont jedoch auch abschließend, dass solche „Extremfälle“ doch selten seien, jedoch nicht das Gefühl des „zwischen zwei Stühlen“ Sitzens bei Migranten der zweiten Generation.[28]
Das narrative Interview
„In der empirischen Sozialforschung ist die Befragung noch immer die am häufigsten verwendete Methode der Datenerhebung. Zugleich ist sie auch dasjenige Verfahren, das am weitesten entwickelt ist. Zwar gilt das persönliche Interview nicht mehr unbestritten als der Königsweg unter den Verfahren der Datensammlung. Dennoch hat es – trotz Kritik angesichts steigender Kosten und sinkender Ausschöpfungsquoten […] seine dominierende Position in der Forschungspraxis bewahrt.“[29] Obwohl für das geführte narrative Interview der zweisprachig erzogenen Frau keine Kosten anfielen, so hat ein Interview als Methode dennoch einige Nachteile, beziehungsweise Risiken, deren Vermeidung bei unzureichender Vorbereitung der Befragung oder fehlender Kenntnisse durch mangelnde Praxiserfahrung nahezu unumgänglich sind. So werden etwa Fragen von Interviewer und Befragtem unterschiedlich verstanden, oftmals nicht beantwortet, sondern sofort interpretiert oder, der sicherlich häufigste Fehler: Der Befragende lenkt mit seinen Fragen das Gespräch zu sehr und verfälscht somit die (nicht mehr aus freien Stücken gegebenen) Antworten. Auch sind die Antworten meist aus einer sehr subjektiven Sicht dargelegt und somit ist auch die Zuverlässigkeit der Aussagen nicht immer gewährleistet. Dies tritt wohl häufig durch ein verzerrtes oder verändertes Erinnerungsvermögen ein, als auch durch den sogenannten Bekanntheitseffekt (welchen es darum auszuschließen gilt) auf. Ein weiteres Problem ist, dass Befragte oft eine „richtige Antwort“ geben wollen. Die künstliche Interview-Situation ist mitunter auch oft ein „Verzerrer“ und als Effekt eigentlich unerwünscht, aber ebenso unumgänglich.
Das im Folgenden aufgeführte narrative Interview ist unter den verschiedenen Befragungsformen den Nicht-Standardisierten zuzuordnen. „Das nicht-standardisierte Interview verzichtet vollständig auf einen Fragebogen. Vorgegeben sind nur Stichworte oder Themen, die im Interview anzusprechen sind; die Befragten können ohne Vorgabe, ohne präzise Einzelfragen dazu Stellung nehmen.“[30] Wie später deutlich wird, wurde auch im vorgelegten Interview darauf geachtet, eine möglichst natürliche Gesprächssituation durch Frageformen in unvollständigen Sätzen, Nachfragen oder als Denkanstoß formulierte Fragen zu erzeugen. Aus diesem sogenannten dialogischem setting[31] wurden durch qualitativ-interpretative Methoden der Sozialforschung jeweils Informationen und Aussagen zum Verhältnis von Sprache und Identität, besonders markant in Bezug auf Mehrsprachigkeit und Bikulturalität, extrahiert und ausgewertet.
Wichtig ist die offene Struktur eines Interviews, um den Befragten nicht zu beeinflussen – vor allem nicht in seiner subjektiven Schilderung von Ereignissen, etwa durch Korrekturen oder Gestiken wie Kopf schütteln. „Gefragt ist […] die Kompetenz der Interviewer, das mit dem Leitfaden nur gerahmte Erkenntnisinteresse im Interviewgespräch so zu präsentieren, dass die Befragten […] möglichst spezifisch und tiefgründig ihre Perspektive dazu artikulieren können.“[32] Noch spezifischer geht Kromrey auf das narrative Interview ein, wenn er schreibt: „Eine Sonderstellung im Spektrum qualitativer Interviews nimmt das narrative Interview ein, das in den späten 1970er Jahren von Fritz Schütze im rahmen der Biographie- und Gesprächsforschung entwickelt wurde […], die Interviewer beschränken sich im Hauptteil des Interviews auf einen ausführlichen, inhaltlich weitestgehend offenen Erzählstimulus, der im Erfolgsfall die Informanten dazu anregt, eine ausführliche, chronologisch-lebensgeschichtlich organisierte Erzählung selbst erlebter Ereignisse und Prozesse zu generieren, die dann später mit erzähltheoretisch begründeten, biographisch-rekonstruktiven Analysen in ihrem sozialwissenschaftliche Gehalt erschlossen werden (Hermanns 1991).“[33]
Das im Folgenden als Gesprächsanalyse und darauf aufbauender Interpretation dargestellte narrative Interview wurde neben den methodischen Grundlagen von Kromrey und Strübin auch nach Tipps und Hinweisen aus dem Seminar Sprache, Kultur und Identität konzipiert. Der hauptsächliche Forschungsgegenstand bestand in der These eines möglichen Zusammenhangs zwischen Bilingualität und einer damit einhergehenden Bikulturalität und deren Auswirkungen auf die persönliche Identität einer Person. Alle persönlichen Daten der befragten Person sind im Folgenden anonymisiert.
Gesprächsanalyse
In diesem Kapitel sollen zuerst oberflächlich und dann spezifischer die Antworten einer jungen weiblichen Person analysiert und interpretiert werden. Ihre Eltern stammen aus Polen (Vater allerdings aus Breslau) und sie ist in Deutschland geboren, also eine Migrantin der zweiten Generation. Auf die Frage nach ihrer Muttersprache, welche gleich zu Beginn im offenen Frageteil mitsamt der Frage nach dem Geburtstort gestellt wurde antwortete die befragte Person mit einer Spontanerzählung:
01 Interviewer eeh (.) ja meine Erste Frage wär‘=quasi bist DU (--) hIer gebo:rn n
(unverständlich) was=Is deine Erste MuttersprAchE
02 Befragte ähm (.) ja: also i=ch bin (--) hIEr (.) gebo=rn; ehm (.) meine Erste: (--) SprachE is
(.) eig=ntlich (-) pOLnisch (.) würd ich sagn; also s=is=immer so=n bisschEn
schwierig: we=il mein PapA kommt ja aus (.) ehm Br (.) BrEslAu (.) un des=is (-)
mh (-) ja (--) war ja frÜher irgendwie (-) DeUtschland und dann=is es irgendwie
(-) ja (--) wurd halt=dann Irgendwie zu PolEn und (-) mein Papa=kann bEIdes
Irgendwie so (.) aber grundsätzlich hat Er eig=ntlich auch=als Kind polnisch
gelernt so (--) noch (-) also (.) genAu un= deshhAlb (.) hAb ich von Kind au=ch
aUf (.) Auch Eher pOlnisch wie deUtsch gelernt aber mein (räuspert sich) mein
Papa zum=Beispiel konnte schon (.) bEsser deutsch wie=jetzt meine MAMa (.)
meine Mama hatte sE:hr la:nge (.) konnte sie nUr pOlnisch und=deswegn hab ich
mit meiner Mama zum=Beispiel nur dEut=äh nur pOlnisch geredet (.) un mit
mei=m Papa (.) so: bisschen pOlnisch un bisschen deUtsch (--) so
Zuallererst muss hier die Interviewfrage betrachtet werden, die durch die Bestimmung „erste Muttersprache“ auch impliziert, dass es eine Zweite geben muss; sprich: Beide Sprachen Muttersprachen seien. Die Befragte interpretiert allerdings dies völlig anders, indem sie lediglich von einer ersten Sprache, dem Polnischen, spricht. Im Gegensatz dazu steht die erste Äußerung der Interviewten, welche auf ihren Geburtsort (hier = Deutschland) verweist. Die Besonderheit des Geburtsortes und der mögliche Zusammenhang zwischen ihm und einer persönlichen Identität sind auch der befragten Person bewusst, indem sie das Wort „hier“ besonders betont (gedehnt, laut) und es quasi durch Pausen davor und danach in eine Sonderstellung gibt. Aber selbst in der Frage wird explizit auf den vermuteten Geburtsort („hier“) verwiesen.
Im ersten Antwortteil fällt auf, dass die Befragte mit vielen Wortdehnungen und Pausen spricht und zögert („meine Erste: (--) SprachE is (.) eig=ntlich (-) pOLnisch (.) würd ich sagn“) im Folgenden allerdings wasserfallartig erklärt, dass sie sich hier vor eine schwierige Entscheidung gestellt fühlt. Sie betont zwar durch Akzentuierung und vor- sowie nachstehenden Pausen das Polnische, zeigt aber durch den nachgestellten Einschub „würd‘ ich sagen“ ihre Unsicherheit bezüglich dieser Wahl. Die undefinierte Bestimmung, dass polnisch „eigentlich“ die erste Sprache sei, verstärkt diesen Eindruck. Möglich wäre hier ein erster Interpretationsansatz nach Bill, wonach sich die Befragte in einer für sie und für ihre Identität schwierigen „Wahlsituation“ befinden würde, welche mit ihrer bilingualen und bikulturellen Identität nicht vereinbar wäre. Im Folgenden erklärt die Befragte auch in schnellem Redefluss, weshalb die Entscheidung für sie „immer ein bisschen schwierig“ sei: „also s=is=immer so=n bisschEn schwierig: we=il mein PapA kommt ja aus (.) ehm Br (.) BrEslAu (.)“. Die schnell nachgeschobene Rechtfertigung zeigt vor allem im Variationsverfahren: Ließe man diese Stelle weg, so würde es im Text deutlicher werden, dass es nur eine erste Sprache für die Befragte gibt. Der Hinweis, der Vater stamme aus Breslau ist nur im Hinblick auf die Geschichte der Region Schlesien zu verstehen. So deutet sich in der Aussage der Befragten an, dass sie sich nicht sicher ist, welche Nationalität ihr Vater habe. Auch wird durch viele Pausen und Lückenwörter mangelndes historisches Wissen über Breslau deutlich („(.) ehm Br (.) BrEslAu (.) un des=is (-) mh (-) ja (--) war ja frÜher irgendwie (-) DeUtschland und dann=is es irgendwie (-) ja (--) wurd halt=dann Irgendwie zu PolEn“). Auch hier besteht also eine weitere Unsicherheit bezüglich der Identität, da der Vater keiner eindeutigen Nationalität und Kultur zuzuweisen ist, was wiederum die für die befragte Person eigene Identifikation erschwert. Auch die ungenaue Aussage, der Vater könne „irgendwie beides, so“ unterstützt diese Annahme.
Die interviewte Person fühlt sich wohl dazu gedrängt, eine Entscheidung zu fällen: „genAu un= deshhAlb (.) hAb ich von Kind au=ch aUf (.) Auch Eher pOlnisch wie deUtsch gelernt“. Gleichzeitig scheint die Befragte allerdings auch verwirrt zu sein, verspricht sich einmal („deswegn hab ich mit meiner Mama zum=Beispiel nur dEut=äh nur pOlnisch geredet“) und beantwortet auch die Frage nach der sprachlichen Erziehung in der frühen Kindheit eher knapp („mit meiner Mama zum=Beispiel nur dEut=äh nur pOlnisch geredet (.) un mit mei=m Papa (.) so: bisschen pOlnisch un bisschen deUtsch (--) so“).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass schon in der ersten einleitenden Frage und ihrer Beantwortung erkennbar wird, welches Stresspotential eine Zweisprachigkeit beinhalten kann; ausgelöst vor allem durch die Erwartungshaltung des Umfeldes einer zweisprachigen Person, vorzugsweise einer Migrantin der zweiten Generation. Diese Erwartungshaltung wurde durch die offene und dennoch nur zwei Möglichkeiten offerierende Fragestellung zu Beginn auch dargestellt.
Nähere Fragen zum Spracherwerb bezüglich Unklarheitsvermeidung befassten sich mit der Zeitlichkeit der Zweisprachigkeit:
03 Interviewer (.) also (-) äh (--) wie war des dann (.) äh du hast (.) erst (-) pOLnisch=gelernt un dann
spÄter deutsch=oder?
04 Befragte mhh: des war eigentlich son bisschen (--) mein papA hat ja=dann auch irgendwann
natürlich (.) Arbeiten müssen nä un: dann hat er auch natürlich dann (.) wurd immer
bEsser=also dEUsch=un des war dann son mi; mi:x irgendwie also ich würd nich sagen
dass ich des (.) ehm dass ich erst des Eine un dann des Andere sondern (atmet ein) (-)
ehm (.) wie=gesagt mit meim paPa (unverständlich) ich so=n gemixtes irgendwie
gesprO:chen un mit meiner maMa halt (-) ehm (-) wIrklich nu:r pOlnisch (atmet ein ) und
(-) ehm (.) und (.) ich würd sagen am A:nfA:ng wars (.) e:her mhh (.) (kratzt sich) der
schwErpunkt war ehe:r so auf pOLnisch un dann je: besser mein papA deutsch konnte:
ehm (-) also heut zum=beispiel kann er flüssig; je Älter ich dann auch dementsprechend
wu:rde desto me:hr (.) wurd (.) kam dann auch deutsch dazu (--) so
Eine detaillierte oder gar chronische Zeitfolge des doppelten Spracherwerbs scheint es bei befragter Person nicht gegeben zu haben. Interessant ist, dass die Interviewte zwar angibt, dass polnisch ihre erste gelernte Sprache sei, sie aber wohl mit dem Vater einen doppelten Sprachumgang (deutsch-polnisch) pflegte. Der Erwerb beider Sprachen scheint hier auch stark an die Bindungen zu den Eltern und deren jeweilige Fähigkeiten und Identität gekoppelt zu sein: Während der Vater bereits zum Zeitpunkt der Immigration deutsch spricht und sich selbst, beziehungsweise seine Tochter ihn, als Polnisch-deutschen sieht, nimmt das Kind in der Sprechbeziehung zur Mutter deren Muttersprache an, solange, bis die Mutter auf einem (sicheren) deutschen Sprachniveau angelangt ist. Von Anfang an also steht das Kind zwischen einer Polin und einem Polnisch-deutschen und spricht mit beiden die jeweilige Sprache(n). Wie Jańczak erklärt, hängt auch hier Sprache stark von den entsprechenden Bezugspersonen ab. Der Vater ist hierbei die eindeutige Verbindung zur deutschen Sprache und wichtiges Bindeglied, beziehungsweise Brücke, in der Zweisprachigkeit und der Bikulturalität.
Die häufigen Pausen, gerade was das Ein- und Ausatmen betrifft sowie die Gestik des Kratzen könnten Hinweise für die Anstrengungen sein, die es kostet, eine solche Kindheitserinnerung möglichst objektiv wiedergeben zu wollen.
Im weiteren Verlauf des Interviews erzählt die Befragte, dass sie besser deutsch als polnisch spricht und erklärt sich dies durch die stete Zunahme des deutschen Sprachgebrauchs und die damit einhergehende Vernachlässigung des Polnischen. Im Zuge der Immigration und der Sozialisation in Deutschland als direktes Umfeld, sowie als Arbeits- und Schulort wurde die Kompetenz des Deutschen stärker gefördert; hier fand also eine deutliche Funktionalisierung und eine damit einhergehende Vormachtstellung des Deutschen für die Befragte und ihre Familie statt.
05 Befragte also ich würd=sagen in dEUtsch bin ich (-) ein:deutig: bEsser (.) (lacht) also (.)
ehm (-) frÜ:her (-) war mein pOLnisch aber AUCH besser muss=ich sa:gen des=hat
sich (.) dadurch schle:chter gewo:rden (unverständlich) meine mama dann=jetzt (.)
halt Auch natürlich dEUtsch spricht=un (-) ehm (.) mhh (-) ja: (.) also: I:rgendwie
liegt der schwerpunkt jetzt überwiegend auf dEUtsch (.) also KAUM mehr
pOLnisch un=dadurch=is mein polnisch auch (.) so=n bisschen schwÄ:cher
gewo:rden (--) ehm (-)
Das Lachen nach der Erklärung, die Befragte sei „eindeutig besser in deutsch“ ist nicht genau definierbar; allerdings kann das Motiv der Ironie ausgeschlossen werden. Eventuell ist dieses Lachen eine Art Entschuldigung für die Kompetenzen in beiden Sprachen, da die anfangs geschürte Folgeerwartung (zuerst polnisch gelernt) nicht durch vermeintliche Ausführungen erfüllt wurde.
Die Befragte erläutert den Spracheinfluss des Deutschen aus einer subjektiven Sicht weiter, indem sie erklärt, weshalb ihre jüngeren Geschwister weniger polnisch sprechen können als sie selbst.
06 Befragte also ich würd sagen mittlerweile (.) i:st ei:gentlich überwiegend (--) deutsch (--) also auch
meine jÜngeren geschwister=ich hab noch jü:ngere geschwister und die=zum bEispiel (.)
mhh (-) ja: die bekommen (.) mehr dEUtsch ab wie polnisch=also bei mir wars früher
umgekehrt
Der sprachliche Ausdruck („abbekommen“) den die Interviewte gebraucht um zu erläutern, weshalb ihre jüngeren Geschwister weniger polnisch sprechen können, lässt darauf schließen, dass das Erlernen der „zweiten“ Sprache nicht aus freiwilligem Antrieb resultierte, sondern eher als eine unumgängliche Tatsache gesehen wird, der man nicht ausweichen könnte; man bekommt das Deutsche quasi „einfach ab“, ohne es zu wollen.
Die interviewte Person gab auch im Folgenden an, dass sie mit der polnischen Sprache viele emotionale Werte verbindet; etwa Traditionen wie die Essenskultur und Erinnerungen an Verwandte in Polen.
07 Befragte also (-) eh (.) eh AUch wEnn=ich ehm (-) heute (.) mir sEhr schwer tu mit dem pOLnischen
we=il da=was verlo:ren gegangen=is muss ich trOtzdem sagen dAss (.) Ich (-) ehm (-) mhh:
Es sehr scha:de finde und=auch immer wieder mal zu mei:ner bEsten frEundin weil die
eben Auch pOLnisch spricht (.) e:hm dann: (.) auch (stockt) auch (.) eh bIsschen jAmmer
HEY ich (.) mein POLNISCH GEHT VERLORN (.) ich muss: mEIn pOLnisch behalten=weil (.)
es=is halt auch son bisschen (atmet ein) (--) ja s=is halt auch mit trAdition verbunden un so
un des erinnert (.) dIch irgendwie auch an deine O:ma die zum=beispiel auch (stockt) eben
nUr pOLnisch weil sIE in pO:len le:b tun so (.) ne (--) ehm (.)
Das „Jammern“ um den Verlust der polnischen Sprache kann hier als Stresssituation nach Bill gesehen werden. Die interviewte Person scheint sich mit dem Deutschen als Funktionssprache mehr auseinander setzen zu müssen und verbringt infolgedessen weniger Zeit und Energie auf die Ausübung ihrer anderen Sprache, was zu einem „Verlust“ führt. Der Verlust der polnischen Sprache kann auch als Verlust einer Teilidentität interpretiert werden und vor allem wohl als Verlust an Erinnerungen an Polen und die Kompetenz, sich im Polnischen und in Polen selbst immer noch sprachlich zu recht finden zu können.
08 Befragte ehm (.) also=ich verbind mit de:r polnischen sprAche eigentlich=so mei:n (.) ehm (--) kErn
son=bisschen auch wÜrd ich sagen (.) also s=is schOn auch (.) ehm (-) (stockt) gehört zu
mei:ner persÖnlichkeit (.) also ich ka:nn mi:r nich (.) auch wenn ich m; mich son bi:sschen
unwOhl fühle wenn ich dann zum beIspiel mit jemandem in pOln bin (-) äh (-) Anfang mit
meim komischen pOlnisch (.) würd ich trotzdem (stockt) auch wenn ich hier in dEUtschland
lEb sagen dass ich (.) ehm (--) ja: (--) dass des einfach zu mI:r gehÖrt als mensch un irgendwie:
machts mich auch AUS (.) auch wEnn ich jetzt nich sagn würde HEY (.) ich bin (-) POLIN (.)
oder so (.) oder (--) mh (.) keine=ahnung (stockt) eh (.) ich würd sagen ich bin schOn (.) auf
alle fÄlle dEUtsch (.) ich bin hIEr aufgewAchsen
Auffällig ist, dass die befragte Person dies alles als sehr ausführliche Antwort auf die Frage gibt, ob sie es sich vorstellen könne, nur deutsch zu sprechen und ob dadurch etwas anders für sie wäre. Diese indirekte Frage nach der subjektiven Selbsteinschätzung ihrer Identität scheint die interviewte Person auch gleich als eine solche aufzufassen. Die Tatsache, dass sie die Antwort sehr ausführlich gestaltet, oft selbst aber stockt, Aussagen revidiert und Unsicherheiten aufweist, zeigt, dass für sie diese Frage nicht konkret und eindeutig zu beantworten ist. Die befragte Person reagiert nervös und unsicher, scheint sich in einer persönlichen Stresssituation zu befinden und sich, wie zu Beginn des Interviews in Abschnitt 02, gedrängt zu fühlen eine Entscheidung zu treffen.
Die befragte Person gab weiterhin an, dass es ihr für die Zukunft auch sehr wichtig sei, ihren Kindern polnisch beizubringen und die Kultur, etwa durch landestypische Küche und traditionsreiche Feste, nahezubringen. Sie begründet diesen Vorsatz mit dem Verweis auf Polen als „ihr Stück Heimat“. Die letzte Frage des Interviews zielte eigentlich auf die Frage nach einer als Bereicherung empfundenen Zweisprachigkeit ab, dennoch gab die befragte Person Auskünfte über ihre Selbstidentität.
09 Befragte gru:ndsätzlich was so die I:dentitä:t angeht muss=ich sagen find=ichs (-) mh (.) Eher (-) ja: (--)
also (--) dA: muss=ich sagn des is schon son=bisschen son (.) auch son I:nnerer kampf
Eigentlich weil (.) dU: (.) ehm (-) Dich (-) ehm (--) du HAST wie so zwei: gespAltene
identitä.ten also du=bist nIch so hU:ndertrprozentig (-) mhh (-) quasi dEUtsch und=auch nich
so hundertprozentig pOLnisch und (.) dEs is wAs (-) ehm wo eigentlich sOn grUndproblem is
(.) weil DU lEbst hie:r in dEUtschla:nd
Die befragte Person stockt häufig, überlegt lange und antwortet oft zögerlich. Dennoch klassifiziert sie ihre subjektiv wahrgenommene Identität als ein „Grundproblem“ und einen „inneren Kampf“ und verweist auch im Weiteren darauf hin, dass sie in zwei Welten lebe, da ihre Umgebung „deutsch“ sei, ihre Familie hingegen die „polnische Welt“ repräsentiere. Die Unvereinbarkeit und Verschiedenheit ihrer Umwelt und der Familienwelt scheint die befragte Person auch in sich selbst als solchen Konflikt oder gar als „Kampf“ wieder zu spiegeln. Auffällig sind auch die Betonungen sowie die umschließenden Pausen der Nominalwörter „Du“ und „Dich“: Hier spricht die Befragte über sich selbst in der zweiten Person und markiert dies entsprechend. Der Konflikt scheint für die befragte Person daraus zu resultieren, dass sie sich keiner Kultur, beziehungsweise Sprache oder gar Nation zuweisen kann oder will. Offenbar konkurriert ihr „alternatives Lebensmodell“ hier mit dem in monolingualen Nationen Gängigen, woraus ein Gefühl von Andersartigkeit entsteht, welches eine eindeutige Gruppenzugehörigkeit verhindert.
Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen
Zum Verhältnis von Sprache und Identität lässt sich am Beispiel des geführten narrativen Interviews zusammenfassend sagen, dass eine Zweisprachigkeit, vor allem für Migranten der zweiten Generation, ein großes Konfliktpotential darstellt.
Nach Oppenrieder und Thurmair etwa ist die eigene Identität ja vielmehr eine Selbstähnlichkeit, welche sich durch Erfahrungen und Erinnerungen bildet. Diese sind im Falle einer Zweisprachigkeit und der damit verbundenen doppelten Gruppenzugehörigkeit schlichtweg nicht genuin. Die Handlungen und vor allem die Sprechhandlungen einer Person daher auch nicht, sie sind zweisprachig. Folglich zieht auch die interviewte Person selbst aus ihren doppelten Sprechhandlungen den Rückschluss, sie hätte eine „doppelte Identität“ – oder zumindest eine Identität. Welche im Konflikt zur allgemeinen Vorstellung einer runden und einsprachigen Identität steht. Im Hinblick auf die gruppenbezogene Identität zeigen sich also die größten Differenzen, da die politisch-sozialen Großgruppen polnisch und deutsch sich hauptsächlich durch eine Monolingualität voneinander unterscheiden. Eine exakte Gruppenzugehörigkeit ist nicht möglich und diese als Konflikt oder als Andersartigkeit empfundene Tatsache stört das einheitliche Identitätsgefühl der befragten Person.
Der Konflikt wird in diesem speziellen Fall durch die Schaffung zweier Funktionsbereiche (öffentlich und privat) teilweise gelöst. Der absolute Stress nach Bill kann somit zumindest ausgeschlossenen werden, da keine täglichen Entscheidungen nötig sind. Auch gibt die befragte Person an, dass beide Sprachen und beide Nationen ein Teil von ihr seien, sie geht also auch den Lösungsweg, die ungenaue Gruppenzugehörigkeit, beziehungsweise die Multikulturalität als spezifisches Identitätsmerkmal zu sehen.
Auch für Jańczak stellt Sprache Identität dar. Sprechhandlungen sind die manifesten Äußerungen von Identität, da sie Emotionen, Einstellungen und Verhaltensmuster transferieren. Schwierigkeiten durch eine Zweisprachigkeit könnten sich hier durch die Vermischung von genannten Emotionen, Einstellungen und Verhaltensmustern ergeben und die damit für die Umwelt einhergehende Verwirrung über die nicht mehr mögliche exakte Zuordnung (etwa „Das ist ja wirklich typisch deutsch.“). Auch haben Jańczaks Untersuchungen weiter ergeben, dass für die meisten Befragten Sprache und Identität untrennbar sind und viele Migranten sich vor die Entscheidung „Funktionalität versus Emotionalität“ hinsichtlich der Sprachen und der damit verbundenen Identität gestellt fühlen. Dieser Entscheidungszwang störe eine Identität. Hinzu komme, dass viele Migranten der zweiten Generation, genau wie die Person im narrativen Interview, keine Basispersönlichkeit entwickelten (zwischen 6 und 14 Jahren), welche als eindeutige Identifikation für die persönliche Identität gelten könne.
Entscheidend, gerade im Hinblick auf den oft genannten Stress durch Entscheidungszwang ist auch die Tatsache einer doppelten Sozialisation, einmal innerhalb der Familienstrukturen und zum anderen aber in der Aufnahmegesellschaft. Diese doppelte Sozialisation ist gerade als einzige oder als erlebte „Erstsozialisation“ eine besonders angespannte, da hier durch die verschiedenen Fremdwahrnehmungen der Person eine genaue Selbstwahrnehmung und eine Identifikation mit einer Gruppe erschwert wird.
Entscheidend für den Einfluss der Sprache auf die Identität ist wohl also die Kontroverse, in einer Kultur geboren und aufgewachsen zu sein, innerhalb der Familie aber eine andere Kultur, inklusive Sprache, zu erleben. Offensichtlich birgt dieses Andersartig sein der eigenen Familie gegenüber der Öffentlichkeit, ein Konfliktpotential. Dass man beiden Sprachen und Kulturen nicht gleich gerecht sein kann, das schildert auch die befragte Person als großen Stress. Die wechselnden Sprach- und Kulturunterschiede und Verhaltensmuster könnten die Ursache sein für die Wahrnehmung, man habe eine geteilte Identität. Dem entgegen wirken kann man laut Bill durch das Vernachlässigen einer Sprache, im Fall der befragten Person das vernachlässigen des Polnischen oder durch die Zuweisung von Funktionsbereichen. Auch dies hat die befragte Person so geregelt und entgeht damit teilweise dem Konflikt einer Unmöglichkeit der genauen Identitätsbildung. Allerdings bleibt auch für die befragte Person das Gefühl, sie sitze „zwischen den Stühlen“.
Hinweise zum geführten Interview
Die befragte Person wurde über den Nutzen des geführten Interviews vollständig informiert und zeigte sich mit der Verwendung ihrer Aussagen unter der Prämisse der Anonymisierung privater Daten einverstanden.
Als Anweisung für das Transkriptionsschema des Interviews dienten Textbeispiele aus dem Seminar sowie die Einführung Gespräche analysieren von Arnulf Deppermann. Auf (vermeintliche) Satzzeichen wurde verzichtet, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
Erklärungen zum Transkript
(.) kurze Pause
(-) Pause
(--) lange Pause
: Dehnung
= Verschleifung
kUrz Akzentuierung
(stockt) Anmerkungen
Bibliografie
Hill, Paul B.: Kulturelle Inkonsistenz und Streß bei der zweiten Generation. In: Generation und Identität. Theoretische und empirische Beiträge zur Migrationssoziologie, Opladen. 1990
Jańczak, Barbara: Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschlandund Polen, Frankfurt (Oder). 2011
Kromrey, Helmut und Strübing, Jörg: Empirische Sozialforschung, Stuttgart. 2009
Oppenrieder, Wilhelm und Thurmair, Maria: Sprachidentität im Kontext von Mehrsprachigkeit. In:
Sprachidentität – Identität durch Sprache, hrsg. von Nina Janich und Christiane Thim-Mabrey, Tübingen. 2003
Wiswede, Günther unter Mitarbeit von Gabriel, Matthias, Gresser, Franz und Haferkamp, Alexandra :
Sozialpsychologie-Lexikon, München. 2004
[...]
[1] Wiswede, Günther unter Mitarbeit von Gabriel, Matthias, Gresser, Franz und Haferkamp, Alexandra :
Sozialpsychologie-Lexikon, München. 2004, S. 245
[2] Oppenrieder, Wilhelm und Thurmair, Maria: Sprachidentität im Kontext von Mehrsprachigkeit. In: Sprachidentität – Identität durch Sprache, hrsg. von Nina Janich und Christiane Thim-Mabrey, Tübingen. 2003. Im Folgenden Oppenrieder/Thurmair zitiert.
[3] Oppenrieder/Thurmair. S. 40
[4] Oppenrieder/Thurmair. S. 42
[5] Oppenrieder/Thurmair. S. 43
[6] Oppenrieder/Thurmair. S. 43
[7] Oppenrieder/Thurmair. S. 44
[8] Oppenrieder/Thurmair. S. 45
[9] Oppenrieder/Thurmair. S. 47
[10] Oppenrieder/Thurmair. S. 50
[11] Jańczak, Barbara: Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschland und Polen, Frankfurt (Oder). 2011, S.25. Im Folgenden Jańczak.
[12] Wiswede, Günther unter Mitarbeit von Gabriel, Matthias, Gresser, Franz und Haferkamp, Alexandra : Sozialpsychologie-Lexikon, München. 2004, S. 359
[13] Jańczak. S. 26
[14] Jańczak. S. 26
[15] Jańczak. S. 28
[16] Jańczak. S. 29
[17] Jańczak. S. 29
[18] Jańczak. S. 38
[19] Jańczak. S. 110
[20] Jańczak. S. 111
[21] Jańczak. S. 142 und 143
[22] Jańczak. S. 153
[23] Jańczak. S. 195
[24] Hill, Paul B.: Kulturelle Inkonsistenz und Streß bei der zweiten Generation. In: Generation und Identität. Theoretische und empirische Beiträge zur Migrationssoziologie, Opladen. 1990, S. 101. Im Folgenden Bill zitiert.
[25] Bill. S. 102
[26] Bill. S. 102
[27] Bill. S. 125
[28] Bill. S. 125 und 126
[29] Kromrey, Helmut und Strübing, Jörg: Empirische Sozialforschung, Stuttgart. 2009, S. 336. Im Folgen Kromrey/Strübin zitiert.
[30] Kromrey/Strübin. S. 365
[31] Kromrey/Strübin. S. 386
[32] Kromrey/Strübin. S. 388
Häufig gestellte Fragen zu Sprachidentität und Mehrsprachigkeit
Worum geht es in dieser Arbeit?
Diese Hauptseminarsarbeit beschäftigt sich mit der Sprachidentität und Mehrsprachigkeit, insbesondere im Kontext der Migration. Im Zentrum steht ein narratives Interview mit einer jungen Frau, deren Eltern aus Polen nach Deutschland immigriert sind. Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Sprache zur Identität, die Verinnerlichung einer kulturellen "Doppel-Identität" durch Zweisprachigkeit und die Auswirkungen von Wortschatz und Sprachgebrauch auf die Persönlichkeit.
Wie wird der Begriff Identität in dieser Arbeit definiert?
Identität wird im Sinne des Sozialpsychologie-Lexikons von Günther Wiswede als "das Wissen um eigene Charakterzüge, Fähigkeiten, Meinungen samt der damit verbundenen Gefühle und Bewertungen" und als "Bewusstheit des eigenen Ich" definiert. Die Rolle der Eltern bei der Identitätsbildung wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt Sprache bei der Identitätsbildung?
Sprache spielt eine bedeutende Rolle bei der Identitätsbildung, insbesondere im Hinblick auf gruppenbezogene Teil-Identitäten. Kommunikative Beziehungen innerhalb einer gleichsprachigen Gruppe sind ein Hauptmerkmal dieser Gruppe. Eine Sprache kann identitätsstiftend sein, da sie Menschen durch Ausdrucksweisen und Wortschatz verbindet und ein Symbol einer Einheit oder Gruppe darstellt.
Wie wird Mehrsprachigkeit im Hinblick auf die Identität betrachtet?
Mehrsprachigkeit kann eine zusätzliche Komplexität zur Identitätsbildung hinzufügen. Während eine Sprache die Zugehörigkeit zu einer Gruppe markiert, kann die Beherrschung mehrerer Sprachen dazu führen, dass man sich "zwischen zwei Welten" befindet. Die Arbeit untersucht, ob Mehrsprachigkeit als Bereicherung oder als Belastung für die Identität wahrgenommen wird.
Welche Erkenntnisse liefert die Dissertation von Barbara Jańczak?
Barbara Jańczaks Dissertation über deutsch-polnische Familien untersucht bilinguale und bikulturelle Aspekte. Sie zeigt, dass Polen und Deutschland sich insbesondere in der Machtdistanz und der Unsicherheitsvermeidung unterscheiden. Jańczak betont die enge Verknüpfung von Identität und Sprache und die Bedeutung der Sprache für die Selbst- und Fremddarstellung.
Was sind die Besonderheiten der zweiten Generation von Migranten laut Paul B. Hill?
Paul B. Hill beschreibt die zweite Generation von Migranten als Sonderfall im Bereich der Identität, da sie den Einfluss zweier divergierender Kulturen in einer Phase der Persönlichkeitsbildung erlebt. Er betont die Rolle der traditionellen Sozialisation durch die Eltern und die Kontakte zur Aufnahmegesellschaft. Dies kann zu Unsicherheiten und inkonsistenten Selbstinterpretationen führen.
Was ist ein narratives Interview und wie wurde es in dieser Arbeit eingesetzt?
Ein narratives Interview ist eine Form des nicht-standardisierten Interviews, bei dem die Befragten ausführlich und chronologisch über selbst erlebte Ereignisse und Prozesse erzählen. In dieser Arbeit wurde ein narratives Interview mit einer zweisprachigen Frau geführt, um Informationen über das Verhältnis von Sprache und Identität zu gewinnen.
Was sind die Hauptergebnisse der Gesprächsanalyse?
Die Gesprächsanalyse zeigt, dass Zweisprachigkeit, insbesondere für Migranten der zweiten Generation, ein großes Konfliktpotential darstellen kann. Die befragte Person empfindet einen "inneren Kampf" und fühlt sich zwischen zwei Kulturen hin- und hergerissen. Die Analyse deutet darauf hin, dass die Erwartungshaltung des Umfelds und die Schwierigkeit einer eindeutigen Gruppenzugehörigkeit zu diesen Konflikten beitragen.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Zweisprachigkeit die Identitätsbildung beeinflussen kann, indem sie zu einem Gefühl der Andersartigkeit und einer ungenauen Gruppenzugehörigkeit führt. Die Schaffung von Funktionsbereichen für die verschiedenen Sprachen und die Akzeptanz der Multikulturalität als Identitätsmerkmal können helfen, Konflikte zu reduzieren. Letztendlich bleibt jedoch oft das Gefühl, "zwischen den Stühlen" zu sitzen.
- Quote paper
- Vanessa Hindinger (Author), 2013, Das Verhältnis von Zweisprachigkeit und Identitätsbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294850