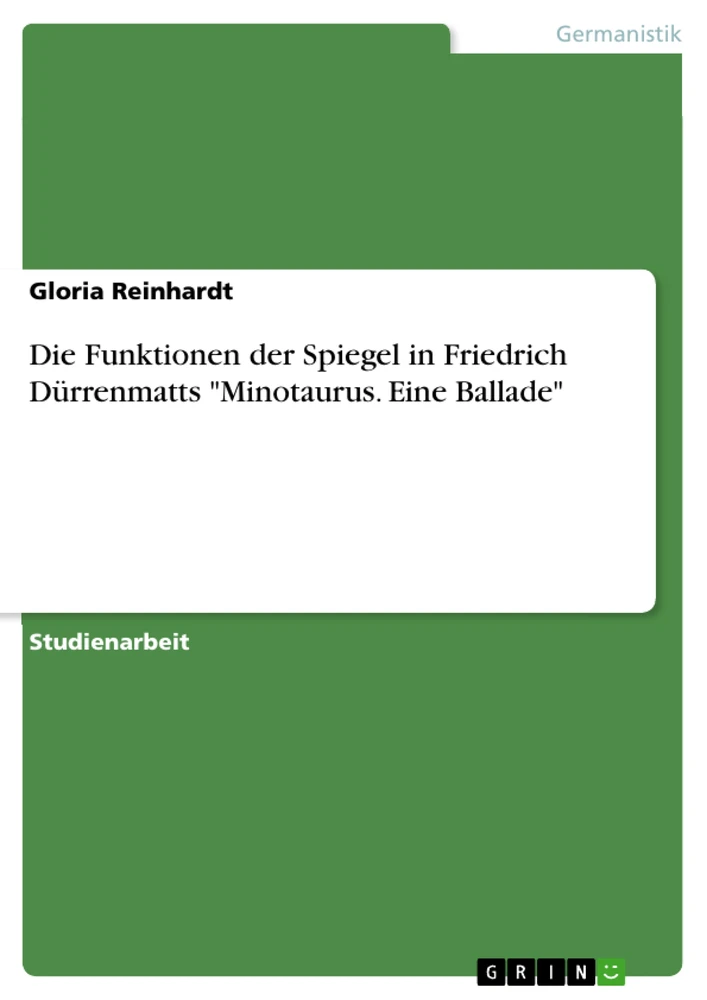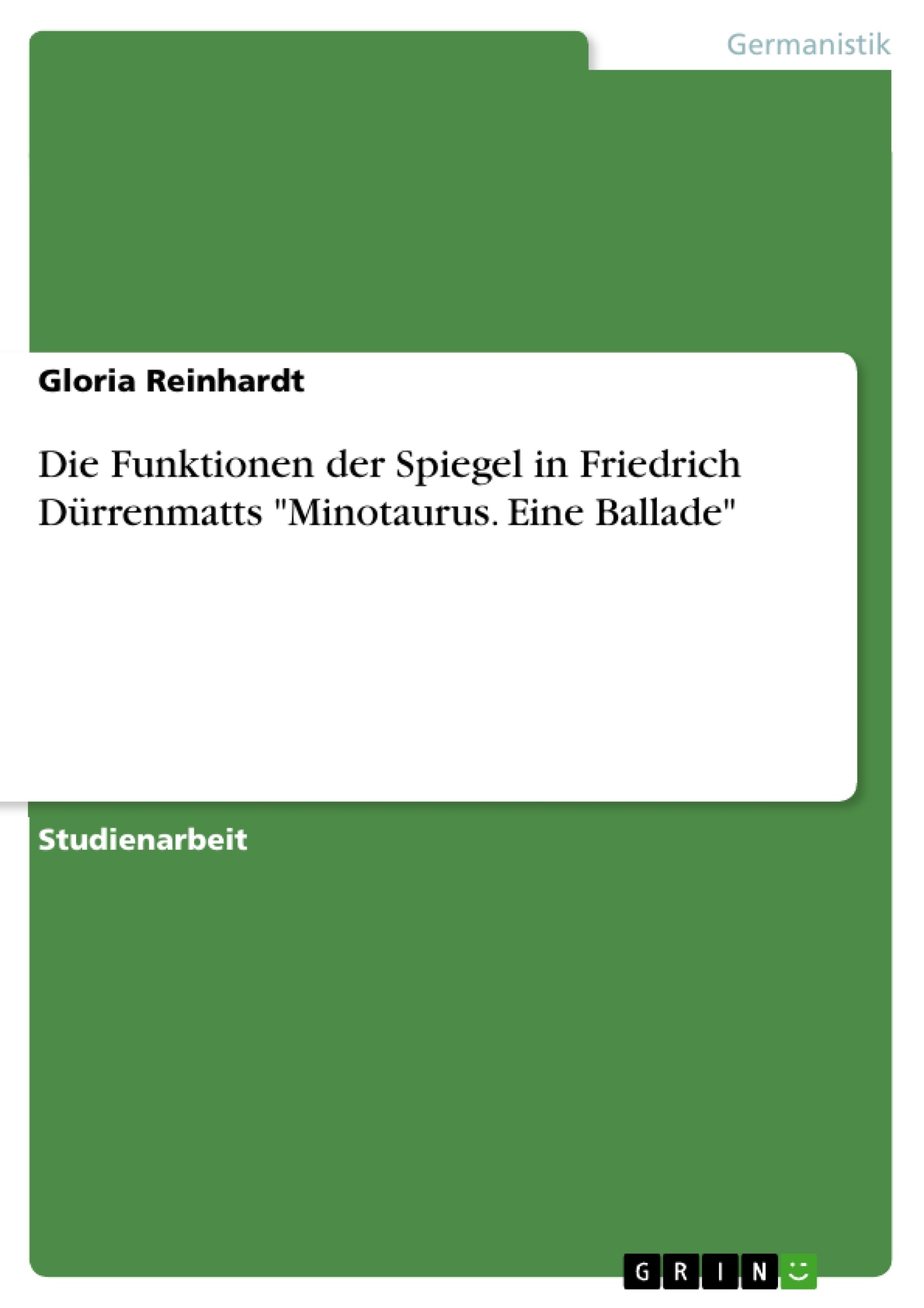Friedrich Dürrenmatt schafft mit Minotaurus (1985) eine Entdramatisierung des antiken Mythos. In seiner Ballade wird das Monstrum im Labyrinth zum Gefangenen des Labyrinths. Es wird nicht weggesperrt, weil es eine Bedrohung für Menschen darstellt, vielmehr ist es durch die Menschen gefährdet. Der Minotaurus wandelt sich zum Sympathieträger und dekonstruiert den Heldenmythos von Theseus. Der Stiermensch wird in ein gläsernes Labyrinth gesperrt und sieht sich plötzlich seinen eigenen unzähligen Spiegelbildern ausgesetzt. Für ihn beginnt der Prozess der Ich-Findung, indem er zuerst sein eigenes Spiegelbild erkennen muss. Gilt das Beschreiten des Labyrinths doch auch als Initiation, wird hier die Komplexitäterfahrung zur Autonomieerfahrung.
Die Umdeutung des Mythos steht im Dienste einer Metapher. Denn Dürrenmatt erwählt das Labyrinth-Motiv zum Gleichnis, das die Welt wiederspiegelt, in der wir leben. Er führt das Labyrinthische der Welt vor Augen und entlarvt die ewige Suche nach Erkenntnis als hoffnungsloses Unterfangen. Durch den ohnmächtigen Blickwinkel eines Tieres, das auch Mensch ist, wird das Labyrinth zur Welt. Dabei wird das Labyrinth-Motiv in der Ballade potenziert: Zum einen allein durch die multiplen Spiegelungen der Glaswände, dann durch die verschachtelt formulierten Sätze, die das Labyrinthische vertiefen und nicht zuletzt durch das Wesen des Minotaurus. Dürrenmatt erkennt die Polyvalenz der Mythenfigur des Minotaurus und beleuchtet sie. Sie birgt in sich eigene Oppositionen, eine gespaltene Identität. Im Minotaurus kämpfen Göttliches gegen Menschliches und das Menschliche wiederum gegen das triebhafte Tierische.
In dieser Arbeit wird Dürrenmatts Umdeutung des Mythos aufgezeigt. Es wird seine Dramaturgie des Labyrinths skizziert, um sein Weltverständnis zu erläutern und den Zusammenhang von Weltwirklichkeit und Labyrinth zu erklären. Den Schwerpunkt werden die Funktionen der Spiegel im Labyrinth, die die Ich-Findung des Minotaurus initiieren, bilden. Zu diesem Zweck wird Jacques Lacans Theorie des Spiegelstadiums angeführt, die als Folie für die einzelnen Erkenntnisstufen des Minotaurus dient. Ziel ist es zu zeigen, dass das Schicksal des Labyrinthbewohners sinnbildlich für den Menschen steht, der versucht seine Welt aus der Distanz zu sehen, um sie zu reflektieren. Als Einführung wird der antike Mythos der Analyse der Ballade voran gestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mythos vom Minotaurus
- Die Dramaturgie des Labyrinths - zum labyrinthischen Begriffs Dürrenmatts
- Dürrenmatts Variante des daidalischen Labyrinths
- Funktionen der Spiegel
- Der Tanz
- Auf dem Weg zum Ich - Lacans Theorie des Spiegelstadiums
- Die Erkenntnisstufen des Minotaurus
- Begegnung mit Theseus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Friedrich Dürrenmatts Ballade „Minotaurus“ (1985) und beleuchtet seine Umdeutung des antiken Mythos. Sie skizziert Dürrenmatts Dramaturgie des Labyrinths, um sein Weltverständnis und den Zusammenhang von Weltwirklichkeit und Labyrinth zu erläutern. Der Schwerpunkt liegt auf den Funktionen der Spiegel im Labyrinth, die die Ich-Findung des Minotaurus initiieren. Hierzu wird die Theorie Jacques Lacans zum Spiegelstadium herangezogen, um die einzelnen Erkenntnisstufen des Minotaurus zu analysieren.
- Dürrenmatts Umdeutung des Minotaurus-Mythos
- Die Dramaturgie des Labyrinths als Metapher für die Welt
- Funktionen der Spiegel und die Ich-Findung des Minotaurus
- Anwendung der Theorie des Spiegelstadiums nach Lacan
- Das Scheitern des Erkenntnisprozesses und die Unüberschaubarkeit der Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangspunkte von Dürrenmatts „Minotaurus“ vor und erläutert die Intentionen des Autors, den Mythos vom Minotaurus neu zu erzählen. Anschließend wird der antike Mythos des Minotaurus dargestellt, um einen Vergleich mit Dürrenmatts Interpretation zu ermöglichen. Im dritten Kapitel wird Dürrenmatts Dramaturgie des Labyrinths skizziert und seine Sicht auf die Welt als Labyrinth erläutert. Es werden verschiedene Perspektiven auf das Labyrinth betrachtet, darunter die des Minotaurus, des Daidalos und des Theseus. Im vierten Kapitel werden die Funktionen der Spiegel im Labyrinth untersucht und ihre Bedeutung für den Erkenntnisprozess des Minotaurus analysiert. Dabei wird die Theorie des Spiegelstadiums nach Lacan herangezogen, die das Erkennen des Ichs anhand des Spiegelbildes beschreibt. Schließlich wird im fünften Kapitel die Begegnung des Minotaurus mit Theseus dargestellt, die gleichzeitig den Höhepunkt und das Ende seiner Ich-Findung darstellt.
Schlüsselwörter
Dürrenmatt, Minotaurus, Labyrinth, Spiegel, Spiegelstadium, Lacan, Ich-Findung, Erkenntnis, Weltverständnis, Mythos, Dramaturgie, Metapher, Weltwirklichkeit, Gesellschaft, Bewusstwerdung, Individuum, Identität, Isolation, Existenz, Wahrnehmung, Sprache.
- Quote paper
- Gloria Reinhardt (Author), 2012, Die Funktionen der Spiegel in Friedrich Dürrenmatts "Minotaurus. Eine Ballade", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294849