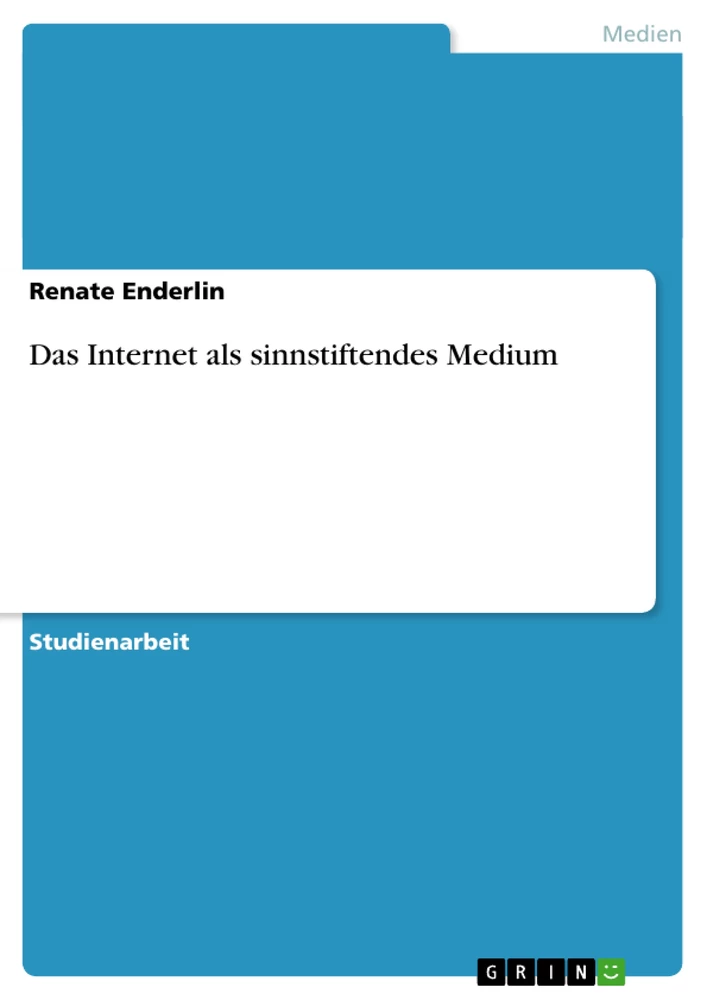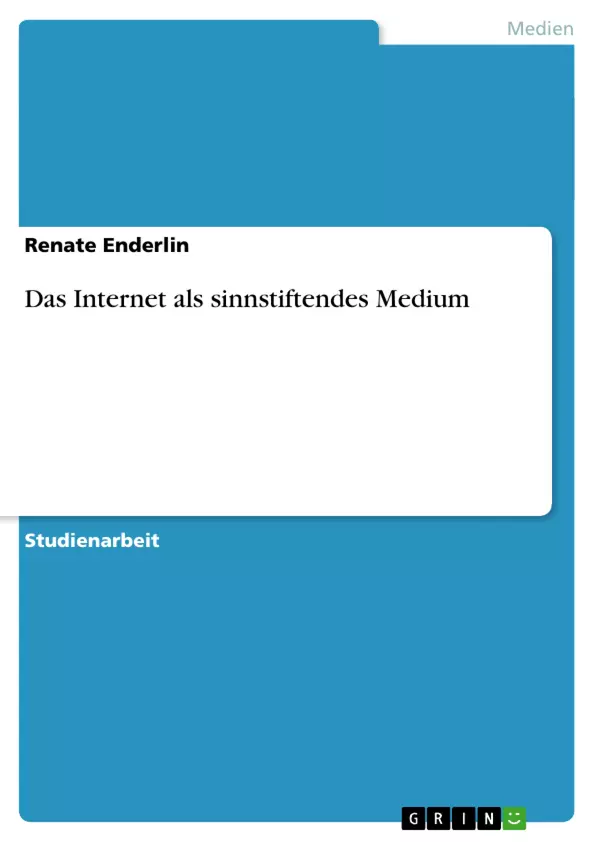Die Autorin beginnt die Arbeit mit einer Vorbemerkung, in der sie die notwendige Einschränkung der vorgegebenen Thematik auf den Bereich „Sinnstiftung im Inter-net?“ begründet.
In den folgenden Teilen 1 bis 3 stellt sie zunächst die Phänomene der modernen Me-dien dar, erläutert dann die grundsätzliche mediale Verfasstheit des Menschen (der ein „homo medialis“ ist) und die Vermitteltheit jeglicher Form von Wahrnehmung und Kommunikation. Dabei erfährt sich der Mensch nicht nur als bloßes Gegenüber einer medialen Welt, sondern ist selbst Teil dieses medialen Netzes, das sich aus den Pri-märmedien Sprache und Bild, aber eben auch aus den technischen Medien bildet.
Im ausführlichen vierten Teil geht die Autorin der Frage nach „Sinn“ und „Sinnstif-tung“ nach. Hier begibt sie sich auf den dornigen Weg der Definition dieser Begriffe, den sie jedoch souverän und anspruchsvoll meistert. Die mehrfachen Bedeutungs-ebenen werden erläutert (z.B. „Sinn“ als identitätsstiftende Übereinkunft des Men-schen mit sich selbst u. seiner Welt, letztlich mit Gott, aber auch als Ziel, auf das hin ich mein Leben in einer bewussten Entscheidung ausrichte) und gut auseinander gehalten. Hierbei widersteht die Autorin der Versuchung nach einfachen bzw. verein-fachenden Antworten (etwa eine zu rasche Gleichsetzung der Frage nach dem Sinn des Lebens mit der Gottesfrage). As hilfreich erweist sich ferner die Unterscheidung von „Sinn“ und „Teilsinn“.
Neben den begrenzten Möglichkeiten, in denen das Medium Internet als sinnstiften-des bzw. besser teilsinn-vermittelndes Medium interpretiert werden kann, erwähnt die Autorin mögliche Quellen von Sinnverlust: Illusionsstörung im Text bzw. Informa-tionsflut.
Schließlich zieht die Autorin den Schluss, dass Sinnstiftung letztlich immer als Eigen-leistung der Person, also als Beantwortung der (eigenen) Existenzfrage: Wozu bin ich? – Wozu sind wir? zu verstehen ist: „Sinn findet jeder nur für sich (allerdings nicht aus Egoismus, sondern) durch und am Anderen und auch für den Anderen“.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Vorbemerkung
- 1. Das Dilemma der modernen Medien
- 2. Medialität des Menschen
- 3. Prägungen zum Sein
- 4. Sinnstiftung oder Sinnvermittlung oder Sinn(zer)störung
- 4.1 Was heißt „stiften“?
- 4.2 Was verbirgt sich hinter „Sinn“?
- 4.3 Sinnverlust durch Illusionsstörung im Text
- 4.4 Sinnverlust durch Info-Flut
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Frage, ob das Internet als eine sinnstiftende Instanz betrachtet werden kann. Die Autorin beleuchtet die Rolle von Medien in der Gesellschaft und erörtert die anthropologischen Grundlagen einer Internetethik. Dabei wird die Frage gestellt, ob Medien überhaupt in der Lage sind, Sinn zu stiften, oder ob diese Aufgabe allein dem Individuum obliegt.
- Die Ambivalenz der modernen Medien zwischen Instrumentalität und Chaos
- Die mediale Verfassung des Menschen als homo medialis
- Die Rolle von Symbolen und Zeichen in der Sinnstiftung
- Die Frage, ob das Internet Welt und Sinn schaffen kann
- Die Notwendigkeit einer anthropologischen Grundlage für eine Internetethik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangsfrage der Arbeit dar und erläutert die Notwendigkeit einer ethischen Betrachtung von Medien im Hinblick auf ihre sinnstiftende Funktion. Kapitel 1 beleuchtet das Dilemma der modernen Medien, die zwar eine Instrumentalität und Effizienz versprechen, gleichzeitig aber auch Chaos und Unwissenheit erzeugen können. Kapitel 2 befasst sich mit der Medialität des Menschen, die durch Sprache, Symbole und andere Medien geprägt ist. Es wird argumentiert, dass der Mensch als „homo medialis“ verstanden werden kann, da er zur Schöpfung und Auslegung von Zeichen fähig ist. Kapitel 3 untersucht die Prägungen zum Sein durch Zeichen und Medien und erläutert, wie diese unser Selbstverständnis und unsere Welterfassung beeinflussen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Medienethik, Internetethik, Anthropologie, Symboltheorie, Sinnstiftung, Sinnverlust, Medialität des Menschen, Welt und Wirklichkeit. Die zentralen Fragestellungen drehen sich um die Fähigkeit von Medien, insbesondere des Internets, Sinn zu stiften, sowie um die anthropologischen Grundlagen einer Internetethik. Wichtige Konzepte sind die mediale Verfassung des Menschen und die Rolle von Symbolen und Zeichen in der Sinnstiftung.
- Quote paper
- Renate Enderlin (Author), 2003, Das Internet als sinnstiftendes Medium, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29484