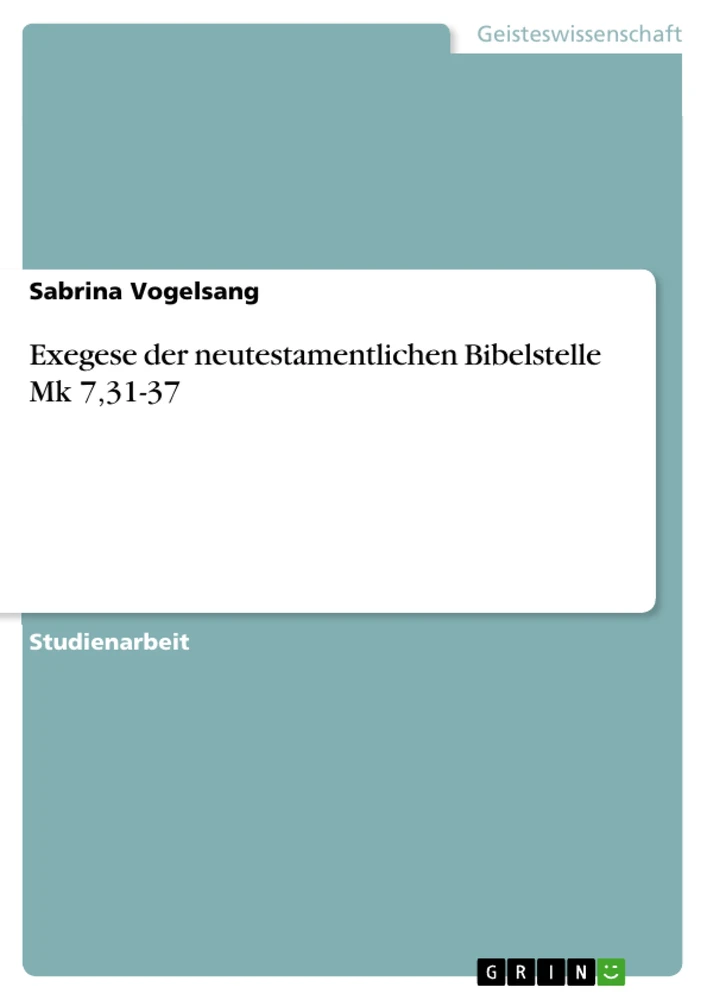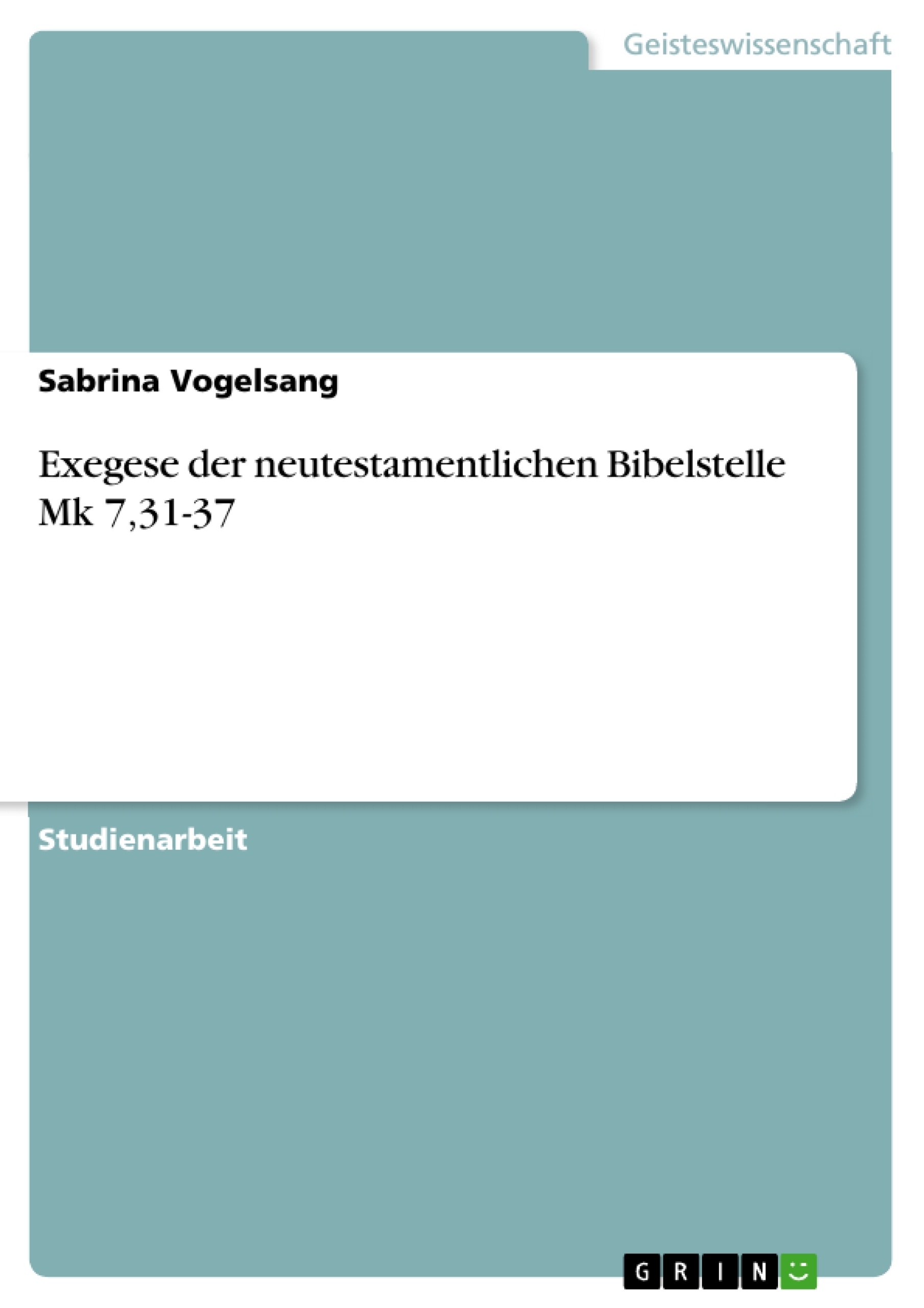Die Ihnen vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der exegetischen Analyse der neutestamentlichen Bibelstelle Mk 7, 31-37. Zunächst stelle ich die Vorgehensweise und die einzelnen Analyseschritte vor.
Begonnen wird mit der Einordnung und Gliederung in den Kontext. Hierbei wird die Struktur, der Rahmen und das Zentrum des Textes erörtert: „An welcher Stelle finde ich den Text?“ oder „Gibt es Bezüge?“ (etc.), werden die Leitfragen sein. Hierauf folgt die linguistische Textanalyse von Mk 7, 31-37, in der syntaktische, semantische, pragmatische und narrative Besonderheiten auf der Wort-, Satz- und Textebene herausgearbeitet werden. Diese können dann für weitere Analyseschritte Verwendung finden.
Anschließend beschäftigt sich die Hausarbeit mit der Literarkritik. Ziel hierbei ist es literarische Schichten aufzudecken und literarische Formen voneinander zu unterscheiden. Man untersucht den Text zum Beispiel auf Doppelungen und Wiederholungen, oder auch auf Spannungen und Widersprüche (etc.).
Im Rahmen der Formkritik werden dann zwei Themen unterschieden. Zum einen die Gattungskritik, in der versucht wird, der Bibelstelle ein bestimmtes Schema zuzuordnen. Und zum anderen den Sitz im Leben. Bei dieser Art der Untersuchung soll herausgefunden werden, in welcher historischen Situation der Text geschrieben wurde.
Anschließend soll die Traditionskritik dabei helfen zu verstehen, in welchem Maß der Autor auf geprägtes Gut (Zitate, Motive, etc.) zurückgreift.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gliederung und Einordnung in den Kontext
- Stellung im Kontext
- Gliederung
- Linguistik
- Syntaktische Analyse
- Semantische Analyse
- Pragmatische Analyse
- Narrative Analyse
- Literarkritik
- Formkritik
- Gattung
- Sitz im Leben
- Traditionskritik
- Redaktionskritik
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der exegetischen Analyse des neutestamentlichen Bibeltextes Mk 7,31-37. Ziel ist es, durch verschiedene Analyseschritte den Text in seiner Struktur, Bedeutung und historischen Einordnung zu verstehen.
- Einordnung und Gliederung des Textes im Kontext
- Linguistische Analyse der sprachlichen Besonderheiten
- Erörterung der literarischen und formalen Aspekte
- Untersuchung der Überlieferung und Entstehung des Textes
- Analyse der Redaktion des Textes und seiner Adressaten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung präsentiert den Umfang und die Methode der Hausarbeit. Die Analyse beginnt mit der Einordnung des Textes in den Kontext, gefolgt von der linguistischen Analyse. Anschließend werden die literarkritischen und formkritischen Aspekte betrachtet, bevor die Traditions- und Redaktionskritik analysiert werden.
Gliederung und Einordnung in den Kontext
Stellung im Kontext
Die Bibelstelle Mk 7, 31-37 ist die einzige Erzählung im Neuen Testament über die Heilung eines tauben und stummen Menschen und wird von zwei weiteren Wunderheilungen umrahmt (Mk 7, 24-30, Mk 8, 1-10). Beide Erzählungen finden in einem Gebiet statt, das mehrheitlich von Heiden bewohnt wird, ähnlich wie in Mk 7, 31-37. Mk 7, 31-37 scheint jedoch inhaltlich kaum mit dem Kontext der vorherigen und folgenden Erzählung verbunden zu sein, da es nicht auf das Verhältnis zwischen Nichtjuden und Juden eingeht und auch die Motive „Essen“ bzw. „Brot“ nicht aufgreift. Ein Kontextbezug lässt sich erst für Mk 8,14-21 ausmachen, der auch einen Bezug zu Mk 8, 1-10 hat. Obwohl direkte Verbindungen fehlen, deuten Anhaltspunkte auf eine gewisse Verbundenheit der Bibelstellen hin. Mk 7, 31 beginnt mit einer einleitenden Ortsangabe, die die Episode mit der vorherigen Perikope (Mk 7, 24-30) verknüpft, da auch der Exorzismus des Mädchens auf heidnischem Gebiet stattfand. Die Perikope Mk 7, 31-37 wird durch die Verbreitung des Wunders abgeschlossen. Mk 8, 1-10 beginnt hingegen mit einer veränderten Figurenkonstellation und einer neuen Zeitangabe. Der gesamte Abschnitt von Mk 7, 24 - Mk 8, 10 befasst sich mit der Konfrontation der Botschaft und der Person Jesu mit der heidnischen Kultur, wobei sich die Heiden mit dem Glauben an Gott auseinandersetzen.
Gliederung
Die Erzählung Mk 7, 31-37 lässt sich anhand der handelnden Personen wie folgt gliedern:
V. 31a/b: Ortsangabe/ Einführung Jesu
V. 32 a/b/c/d: Situationsschilderung/ Einführung des Kranken und seiner Begleiter
V.33/34 a/b/c: Beschreibung des heilenden Handelns Jesu
V.35 a/b/c: Beschreibung des Prozesses und des Resultats der heilenden Handlung
V.36 a/b/c/d: Forderung Jesu
V.37 a/b/c: Reaktion der Begleiter auf Jesu Handeln
Die Lokalisierung des Geschehens in Mk 7, 31 und das den Erzählfluss unterbrechende Geheimhaltungsgebot in Mk 7, 36 lassen auf markinische Zusätze schließen. Ohne diese Zusätze lässt sich der Text als „Wundergeschichte“ klassifizieren.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen dieser Arbeit sind exegetische Analyse, neutestamentlicher Bibeltext, Mk 7,31-37, Einordnung in den Kontext, linguistische Analyse, literarische und formale Aspekte, Traditionskritik, Redaktionskritik, Heilung, Taubstumme, Wundergeschichte, markinische Zusätze.
- Quote paper
- Sabrina Vogelsang (Author), 2014, Exegese der neutestamentlichen Bibelstelle Mk 7,31-37, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294561