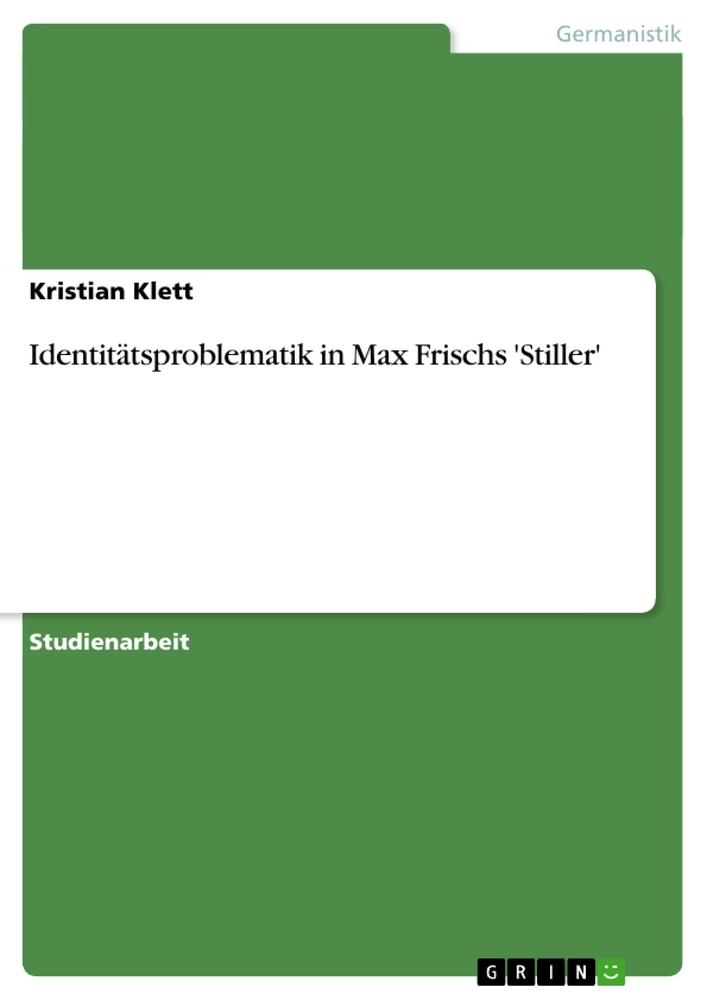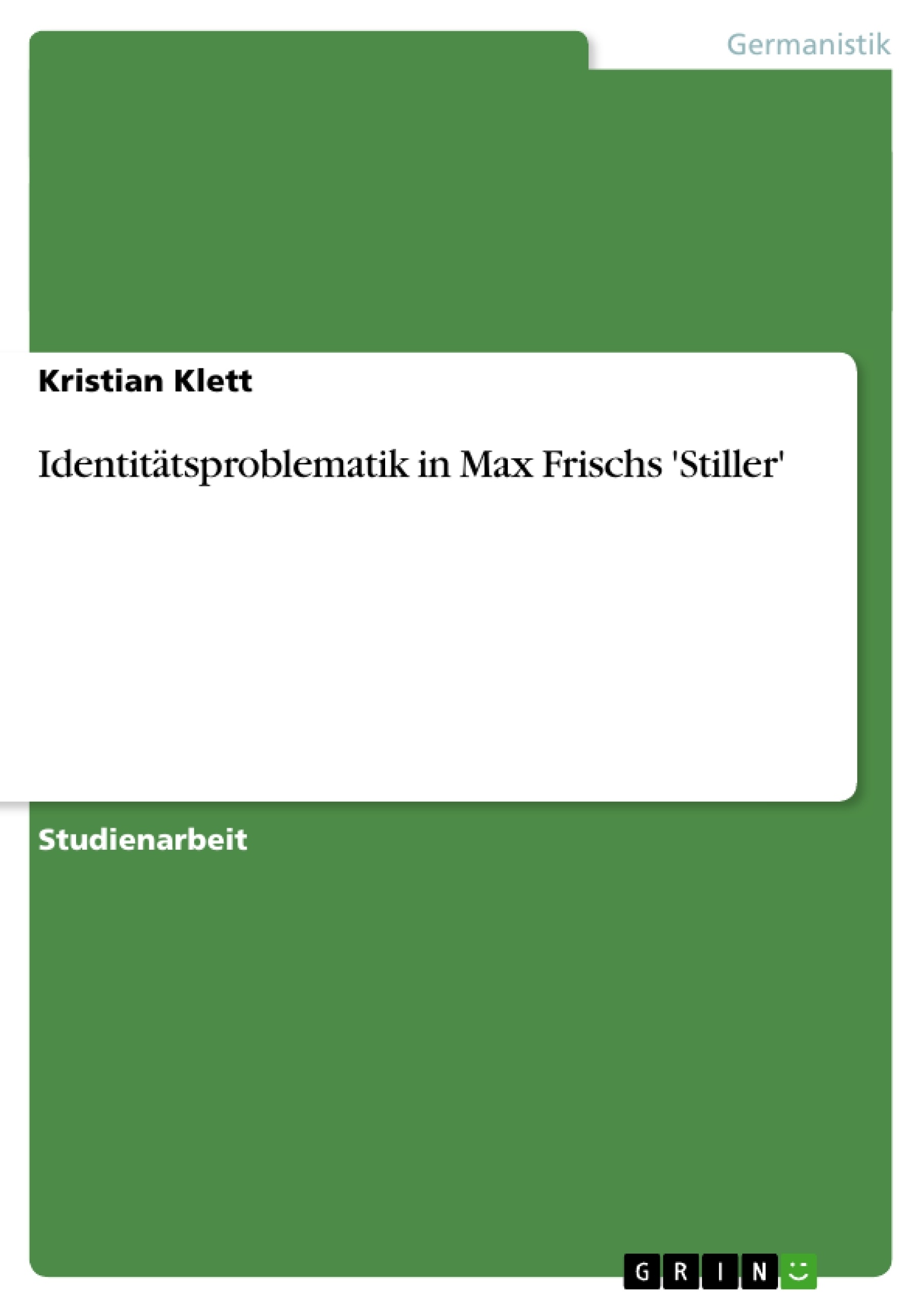"Ich bin nicht Stiller“ (III,361), ist der Ausruf des Protagonisten dieses Romans, eines Häftlings, der seine Identität nicht zu kennen vorgibt. Der Amerikaner James Larkin White wird bei seiner Heimreise in die Schweiz als der verschollenen Stiller erkannt und verhaftet; seine Papiere sind gefälscht. Er soll sein Leben aufschreiben, um seine Behauptung, nicht der Gefangenen zu sein, wider alle Fakten zu belegen. Es entsteht eine Art Tagebuch, das White sowohl mit Geschichten aus seiner Vergangenheit bereichert, als auch mit Berichten über den Verschollenen Stiller, die ihm seine Besucher, darunter ehemalige Bekannte und Verwandte, erzählen. Auf diese Weise tritt die Suche nach seiner wirklichen Identität in den Vordergrund.
Im Gegensatz zur wissenschaftlichen oder psychologischen Denk- und Vorgehensweise setzt Frisch die Suche nach dem Ich in den Spannungsbogen zwischen Erinnerungen von White und Aussagen von Stillers Freunden. Es ist ein Herantasten an die Zusammenhänge zwischen Identität und Rolle, Bildnis und Wirklichkeit, Selbstbetrachtung und Fremdbetrachtung aus verschiedenen Blickrichtungen. Dies macht den Roman zu einem interessanten Zugang zu solchen Themen, deren Reiz eine wirklichkeitsgetreue Geschichte als Grundlage voraussetzt.
Gegenstand dieser Arbeit soll es sein, Stillers Lebensverlauf in seinem Wandel aufzuzeigen, und Ursachen für sein Handeln zu ergründen, um Einblicke in sein Identitätsverständnis zu erlangen. Es ist zu zeigen, daß der Weg zum Ich nichts anderes ist, als das Identischwerden des erscheinenden Ichs mit der Idee des Ichs.1 Ferner soll herausgestellt werden, wie eng die Identitätssuche mit der Rollen-, Bildnis- und Geschlechterproblematik zusammenhängt. Whites Reflexionen über die Schwierigkeit, eine Identität in Worte zu fassen, einen Menschen also mit Worten abzubilden, sowie die Untat sich überhaupt Bilder von Menschen zu machen, spielen dabei eine zentrale Rolle.
1 LÜTHI: DU SOLLST DIR KEIN BILDNIS MACHEN (S. 10)
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG: IDENTITÄTSPROBLEMATIK ALS LITERARISCHES THEMA
- B. IDENTITÄTSPROBLEMATIK IM STILLER
- I. Wer ist Stiller
- 1. Der Mensch - Der Mann
- 2. Der Künstler
- 3. Der Kämpfer
- 4. Der Ehemann
- 5. Der Liebhaber
- 6. Die Flucht
- a) Gründe der Flucht
- b) Der Selbstmord
- c) Die,,Wiedergeburt“
- II. Wer ist Mr. White
- 1. Whites Identitätslosigkeit
- a) Whites Nicht-Identität
- b) Whites Wunsch nach Persönlichkeit
- c) Whites Angst vor Wiederholung
- 2. Gründe der Rückkehr
- 3. Hoffnung auf Julika
- 4. Das,,Geständnis“
- III. Das Nachwort
- 1. Stiller aus der Sicht des Staatsanwalts
- 2. Das Gespräch über die Liebe
- C. SCHLUBBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, Stillers Lebensverlauf und dessen Wandel aufzuzeigen und die Ursachen für sein Handeln zu ergründen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich Stillers Identitätsverständnis entwickelt und welche Faktoren darauf einwirken. Es soll gezeigt werden, dass der Weg zum Ich mit dem Identischwerden des erscheinenden Ichs mit der Idee des Ichs zusammenhängt. Darüber hinaus soll die enge Verbindung zwischen der Identitätssuche und der Rollen-, Bildnis- und Geschlechterproblematik beleuchtet werden. Ein zentraler Aspekt der Arbeit ist die Analyse von Whites Reflexionen über die Schwierigkeit, eine Identität in Worte zu fassen und die Untat sich überhaupt Bilder von Menschen zu machen.
- Identitätsproblematik als literarisches Thema
- Die Suche nach der wahren Identität
- Die Beziehung zwischen Identität und Rolle
- Der Einfluss von Bildern und Idealen auf die Identität
- Die Problematik der Selbstbetrachtung und Fremdbetrachtung
Zusammenfassung der Kapitel
A. EINLEITUNG: IDENTITÄTSPROBLEMATIK ALS LITERARISCHES THEMA
Die Einleitung stellt die Identitätssuche als zentrales Thema des Romans „Stiller“ vor und führt in die Thematik des Textes ein. Dabei wird der Konflikt zwischen dem erscheinenden Ich und der Idee des Ichs hervorgehoben, sowie die Rolle von Selbstbetrachtung und Fremdbetrachtung bei der Identitätsfindung beleuchtet. Die Einleitung skizziert den Ansatz, Stillers Lebensverlauf zu analysieren und die Ursachen seines Handelns zu erforschen, um Einblicke in sein Identitätsverständnis zu gewinnen.
B. IDENTITÄTSPROBLEMATIK IM STILLER
I. Wer ist Stiller
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Frage nach Stillers Identität, indem er ihn aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet: als Mensch, als Künstler, als Kämpfer, als Ehemann und als Liebhaber. Es wird gezeigt, wie Stiller von Ideal-Bildern beeinflusst wird, die ihn zugleich anziehen und gleichzeitig in ein Spannungsfeld zwischen Realität und Rolle führen. Seine Flucht nach Spanien wird als Flucht vor dem eigenen Selbstbild und der drohenden Erkenntnis seiner Selbsttäuschung interpretiert.
II. Wer ist Mr. White
Dieser Abschnitt widmet sich der Frage nach der Identität von Mr. White, der unter dem Namen Stiller verhaftet wird. Es werden Whites Identitätslosigkeit, sein Wunsch nach Persönlichkeit und seine Angst vor Wiederholung analysiert. Die Gründe für seine Rückkehr in die Schweiz und seine Hoffnung auf Julika werden beleuchtet. Auch das „Geständnis“ von White wird in diesem Abschnitt untersucht.
III. Das Nachwort
Der letzte Teil dieses Kapitels befasst sich mit Stillers Identität aus der Sicht des Staatsanwalts Rolf und analysiert das Gespräch zwischen Stiller und seiner Frau Julika über die Liebe.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Identitätsproblematik, der Suche nach dem Ich, der Rolle, dem Bildnis, der Geschlechterproblematik, der Selbstbetrachtung, der Fremdbetrachtung, der Selbsttäuschung, dem Größenwahn und der Flucht. Zentrale Figuren sind Stiller und Mr. White.
- Quote paper
- Kristian Klett (Author), 1996, Identitätsproblematik in Max Frischs 'Stiller', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29417