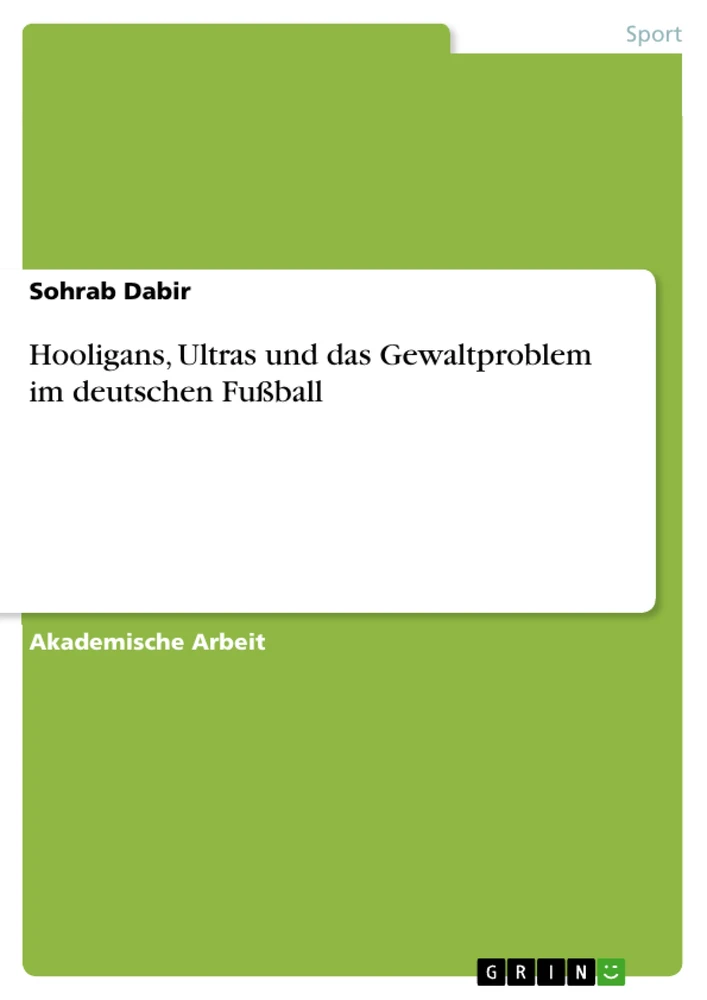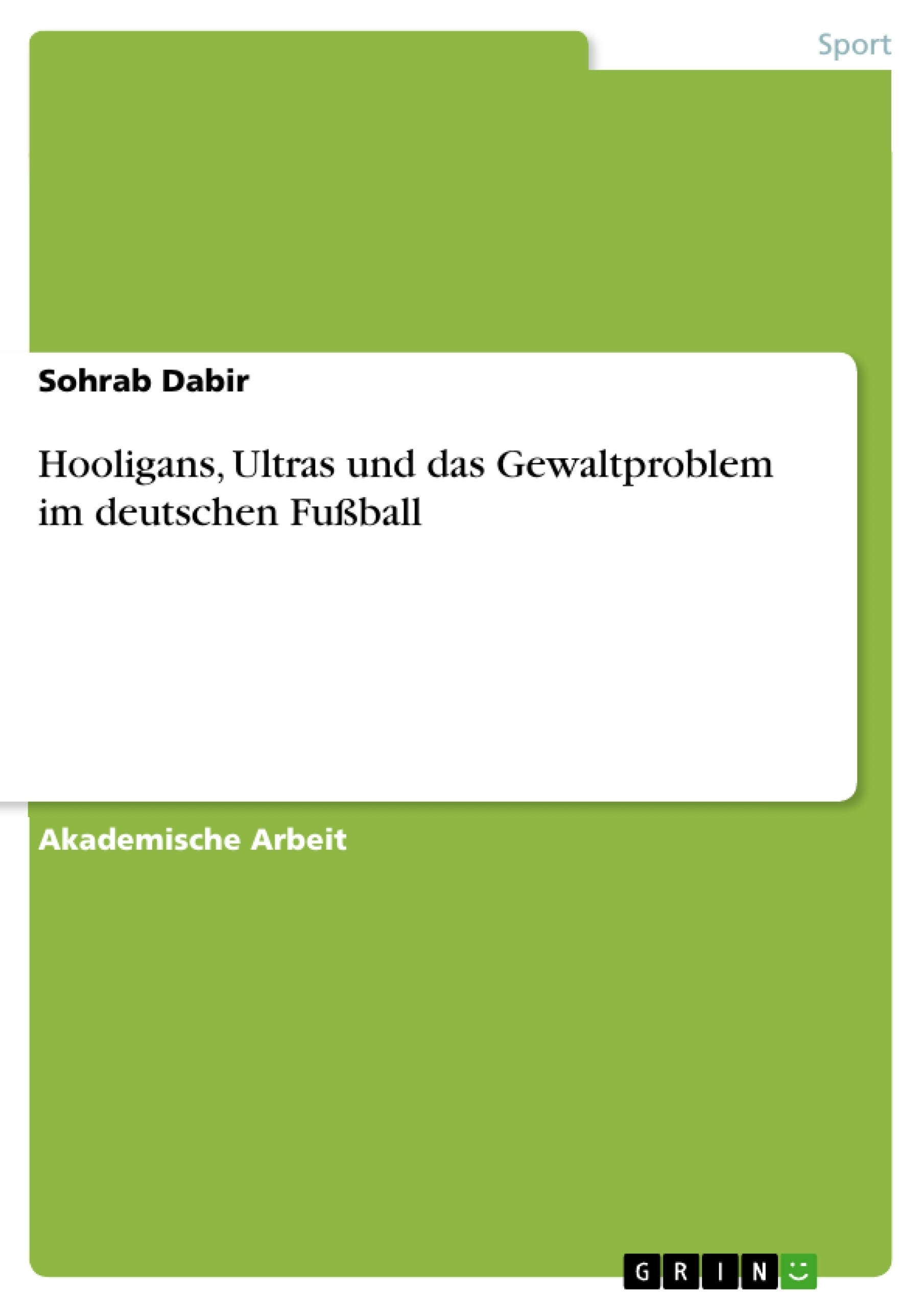Der Fußball und der Stadionbesuch gehören ohne Frage zur Persönlichkeitsentwicklung eines jeden jugendlichen Fußballfans. Wilhelm Heitmeyer spricht hierbei von einem „Sozialisationsprozess […] durch wechselseitige Beeinflussung des Individuums und der gesellschaftlichen Umwelt.“ Die wechselseitige Beeinflussung der Individuen meint hierbei den Umgang der Fans untereinander. Deren gesellschaftliche Umwelt sind der Verein, das Stadion oder auch die Polizei.
Denn abseits des Spielgeschehens muss sich der Fußball auch mit unschönen Entwicklungen auseinandersetzen. Seit Beginn des Aufkommens von Hooliganismus in den deutschen Stadien beschäftigt man sich mit der Frage, was der Auslöser für derartige Verhaltensweisen sein könnte. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit dem Gewalt- und Rassismusproblem im deutschen Fußball.
Eingangs werde ich mich einigen Agressionstheorien widmen. Diese sollen zeigen, welche Gründe die Wissenschaft für die Ausübung von Gewalt zwischen Fußballfans sieht und ob sie auf das Problem wirklich anwendbar sind oder nicht. Im darauffolgenden Abschnitt wird eine Einteilung der Fangruppen vorgenommen. Worin unterscheiden sich friedliebende Zuschauer von denen, die nur nach Gewalt suchen? Weiterhin wird in diesem Kapitel die Entstehung und Entwicklung der Fanszenen in Deutschland untersucht. Von den Kuttenfans bis zu den Ultras. Anschließend wird das Gewaltproblem im deutschen Fußball behandelt. Dabei soll zunächst das Phänomen im heutigen Fußball beleuchtet werden. Hat Deutschland noch ein Gewaltproblem und wie hat es sich im Laufe der Jahre entwickelt? Auch die Rolle der Ultras wird und muss im Bezug auf Gewalt im Fußball betrachtet werden. Worin unterscheiden sich Ultras von Hooligans? Sind Ultras gewalttätiger oder werden sie zu Unrecht kriminalisiert? Im letzten Abschnitt wird auf das Gewaltproblem im ostdeutschen Fußball eingegangen und dabei zu erklären versucht, wieso die neuen Bundesländer weitaus mehr unter dem Hooliganproblem zu leiden haben als die Vereine der alten Bundesländer.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorien zur Gewaltausübung von Fußballfans
- 2.1 Die sozialisationstheoretische Perspektive
- 2.2 Frustrations-Aggressions-Hypothese
- 2.3 Weitere Erklärungsversuche
- 3. Einteilung und Entstehung der Fangruppen in Deutschland
- 3.1 Kategorie A, B und C
- 3.2 70er Jahre – Die Entstehung der Kuttenfans
- 3.3 80er Jahre - Hooligans
- 3.4 Seit Mitte der 90er – Ultras und ihr Kampf gegen die Kommerzialisierung des Fußballs
- 4. Gewalt im deutschen Fußball
- 4.1 Hooliganismus und Gewalt im heutigen Fußball
- 4.2 Die Rolle der Ultras
- 4.3 'Im Osten nichts Neues' – Das Gewaltproblem der neuen Bundesländer
- 5. Rassismus in deutschen Stadien
- 5.1 Die Entstehung und Entwicklung von Rassismus im deutschen Fußball
- 5.2 Rassismusproblem in Ostdeutschland
- 5.3 Der Fall Adebowale Ogungbure
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Gewalt- und Rassismusproblem im deutschen Fußball. Ziel ist es, verschiedene Theorien zur Gewaltausübung von Fußballfans zu beleuchten und deren Anwendbarkeit zu überprüfen. Die Entstehung und Entwicklung verschiedener Fangruppen (Kuttenfans, Hooligans, Ultras) wird ebenso analysiert wie die Rolle dieser Gruppen im Kontext von Gewalt und Rassismus. Die Arbeit betrachtet das Gewaltproblem im heutigen Fußball, insbesondere im Vergleich zwischen Ost- und Westdeutschland.
- Theorien zur Gewaltausübung von Fußballfans
- Entstehung und Entwicklung verschiedener Fangruppen
- Gewalt im deutschen Fußball (Hooliganismus und die Rolle der Ultras)
- Rassismus in deutschen Stadien
- Regionale Unterschiede im Gewaltproblem (Ost- und Westdeutschland)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Gewalt- und Rassismusproblems im deutschen Fußball ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie betont die Bedeutung des Fußballs für die Persönlichkeitsentwicklung Jugendlicher und den gesellschaftlichen Kontext, in dem Gewaltphänomene auftreten. Der Autor kündigt die Auseinandersetzung mit Aggressionstheorien, die Einteilung von Fangruppen, die Entwicklung der Fanszenen und die Analyse des Gewaltproblems, inklusive der Rolle der Ultras und regionaler Unterschiede, an.
2. Theorien zur Gewaltausübung von Fußballfans: Dieses Kapitel analysiert verschiedene soziologische und psychologische Theorien, die versuchen, gewalttätiges Verhalten von Fußballfans zu erklären. Die Sozialisationstheorie betont die Kommerzialisierung des Fußballs als Entwertungsfaktor. Die Frustrations-Aggressions-Hypothese verknüpft Frustration durch drohende Niederlagen mit Aggression. Weitere Erklärungsansätze betrachten die Rolle der Medienberichterstattung, die Familiensituation der Fans und die Katharsis-These. Das Kapitel zeigt die Komplexität der Ursachen und die Notwendigkeit eines multifaktoriellen Ansatzes auf.
3. Einteilung und Entstehung der Fangruppen in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung und die unterschiedlichen Kategorien von Fangruppen im deutschen Fußball. Es zeichnet den historischen Verlauf von den Kuttenfans der 70er Jahre über die Hooligans der 80er Jahre bis hin zu den Ultras ab Mitte der 90er Jahre nach. Die Einteilung in Kategorien (A, B, C) und die jeweiligen Charakteristika der Gruppen werden erläutert. Der Fokus liegt auf den Veränderungen der Fanszenen und ihren jeweiligen Ausprägungen im Hinblick auf Gewalt und gesellschaftliche Einstellungen.
4. Gewalt im deutschen Fußball: Dieses Kapitel analysiert das aktuelle Gewaltproblem im deutschen Fußball, mit einem besonderen Fokus auf Hooliganismus und die Rolle der Ultras. Es beleuchtet die Entwicklung des Gewaltproblems im Laufe der Jahre und untersucht die Unterschiede im Verhalten und den Zielen von Hooligans und Ultras. Ein wichtiger Aspekt ist die Betrachtung des Gewaltproblems in den neuen Bundesländern, das als besonders gravierend dargestellt wird.
5. Rassismus in deutschen Stadien: Der letzte analysierte Abschnitt beschäftigt sich mit dem Rassismusproblem in deutschen Fußballstadien. Er beschreibt die Entstehung und Entwicklung von Rassismus im Kontext des Fußballs, untersucht die Besonderheiten in Ostdeutschland und beleuchtet ein konkretes Beispiel (Adebowale Ogungbure). Das Kapitel verdeutlicht die Verknüpfung von Gewalt und Rassismus im Stadion und deren soziale und gesellschaftliche Auswirkungen.
Schlüsselwörter
Hooliganismus, Ultras, Gewalt, Rassismus, Fußballfans, Fangruppen, Kommerzialisierung, Sozialisation, Frustrations-Aggressions-Hypothese, Ostdeutschland, Westdeutschland, Medienberichterstattung, Polizeimaßnahmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gewalt und Rassismus im deutschen Fußball
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Gewalt- und Rassismusproblem im deutschen Fußball. Sie beleuchtet verschiedene Theorien zur Gewaltausübung von Fußballfans, analysiert die Entstehung und Entwicklung verschiedener Fangruppen (Kuttenfans, Hooligans, Ultras) und deren Rolle im Kontext von Gewalt und Rassismus. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich des Gewaltproblems zwischen Ost- und Westdeutschland.
Welche Theorien zur Gewaltausübung von Fußballfans werden behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene soziologische und psychologische Theorien, darunter die Sozialisationstheorie (mit Fokus auf die Kommerzialisierung des Fußballs), die Frustrations-Aggressions-Hypothese und weitere Erklärungsansätze wie die Rolle der Medienberichterstattung, die Familiensituation der Fans und die Katharsis-These. Die Komplexität der Ursachen und die Notwendigkeit eines multifaktoriellen Ansatzes werden hervorgehoben.
Welche Fangruppen werden untersucht und wie werden sie eingeteilt?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung und die unterschiedlichen Kategorien von Fangruppen im deutschen Fußball, von den Kuttenfans der 70er Jahre über die Hooligans der 80er Jahre bis hin zu den Ultras ab Mitte der 90er Jahre. Eine Einteilung in Kategorien (A, B, C) und die jeweiligen Charakteristika der Gruppen werden erläutert. Der Fokus liegt auf den Veränderungen der Fanszenen und ihren Ausprägungen im Hinblick auf Gewalt und gesellschaftliche Einstellungen.
Wie wird Gewalt im deutschen Fußball analysiert?
Das Kapitel über Gewalt im deutschen Fußball analysiert das aktuelle Problem, insbesondere den Hooliganismus und die Rolle der Ultras. Es beleuchtet die Entwicklung des Gewaltproblems im Laufe der Jahre und untersucht die Unterschiede im Verhalten und den Zielen von Hooligans und Ultras. Ein wichtiger Aspekt ist der Vergleich des Gewaltproblems zwischen Ost- und Westdeutschland, wobei das Problem in den neuen Bundesländern als besonders gravierend dargestellt wird.
Wie wird das Thema Rassismus im deutschen Fußball behandelt?
Der Abschnitt über Rassismus beschreibt dessen Entstehung und Entwicklung im Kontext des Fußballs. Er untersucht die Besonderheiten in Ostdeutschland und beleuchtet ein konkretes Beispiel (Adebowale Ogungbure). Das Kapitel verdeutlicht die Verknüpfung von Gewalt und Rassismus im Stadion und deren soziale und gesellschaftliche Auswirkungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hooliganismus, Ultras, Gewalt, Rassismus, Fußballfans, Fangruppen, Kommerzialisierung, Sozialisation, Frustrations-Aggressions-Hypothese, Ostdeutschland, Westdeutschland, Medienberichterstattung, Polizeimaßnahmen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theorien zur Gewaltausübung von Fußballfans, Einteilung und Entstehung der Fangruppen in Deutschland, Gewalt im deutschen Fußball und Rassismus in deutschen Stadien. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Themas.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Theorien zur Gewaltausübung von Fußballfans zu beleuchten und deren Anwendbarkeit zu überprüfen. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung verschiedener Fangruppen und deren Rolle im Kontext von Gewalt und Rassismus, sowie regionale Unterschiede im Gewaltproblem (Ost- und Westdeutschland).
- Quote paper
- Sohrab Dabir (Author), 2010, Hooligans, Ultras und das Gewaltproblem im deutschen Fußball, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294097