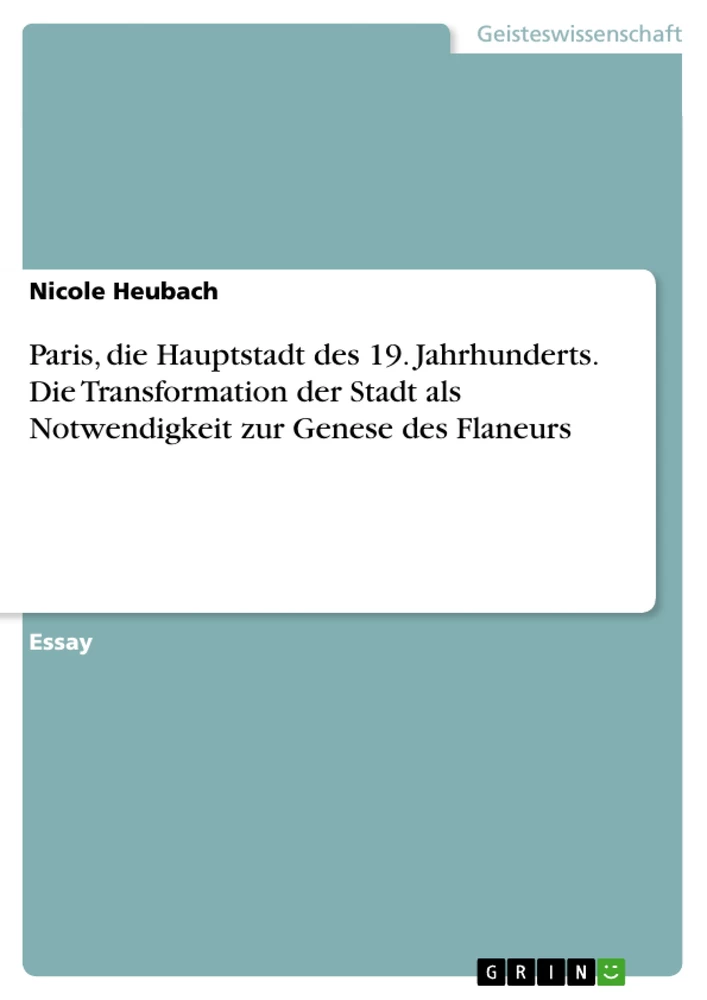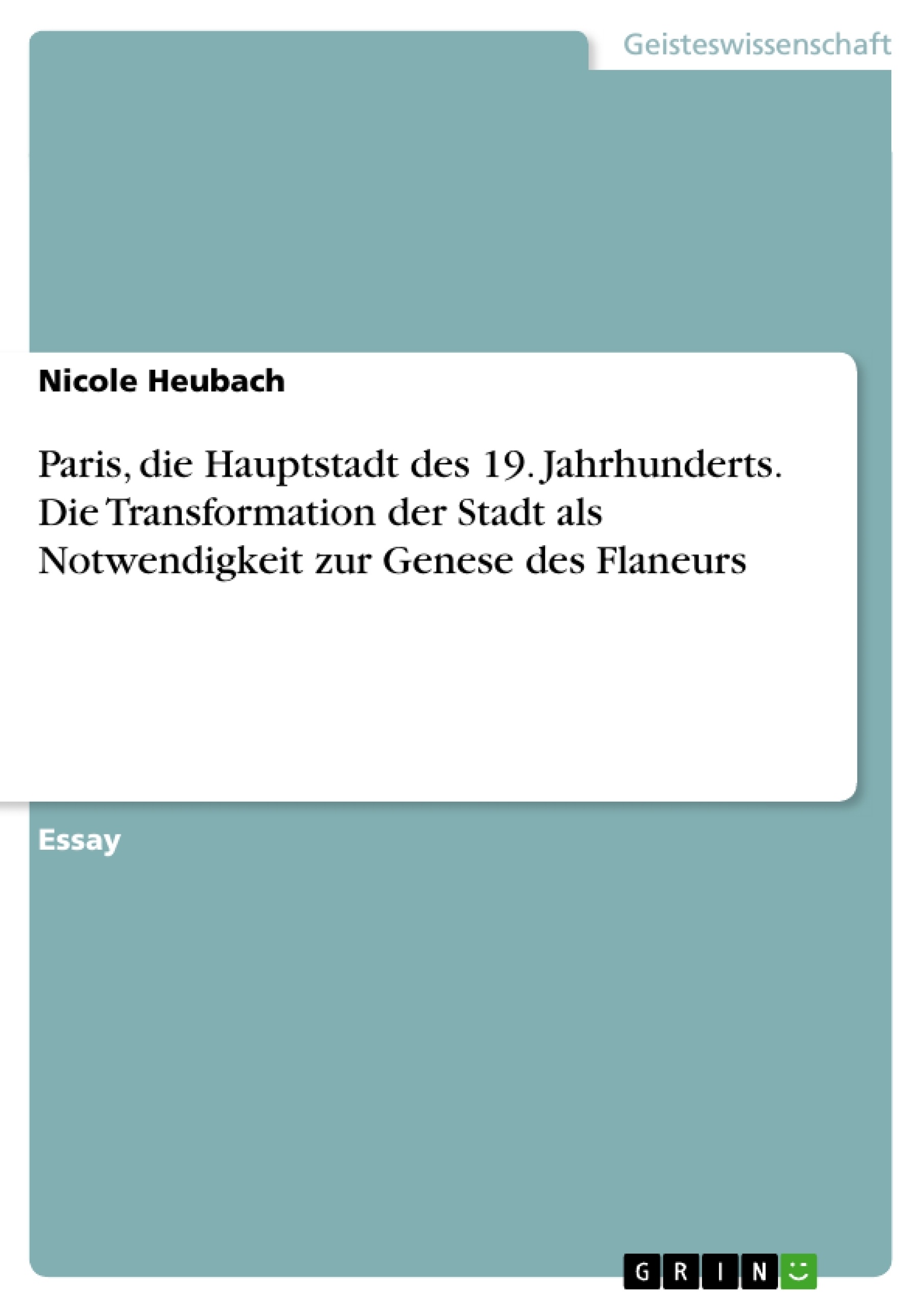Die vorliegende Arbeit möchte aufzeigen, welche Entwicklungen nötig waren, um eine für das 19. Jahrhundert typische Kulturfigur wie den Flaneur auf den Plan zu rufen. Dabei bezieht sie sich vor allem auf Walter Benjamins Passagenwerk sowie Texte von Charles Baudelaire, um diese Entwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen an Beispielen festzumachen. Die "Haussmannisierung" der Stadt Paris und die darauf folgende Möblierung der Stadt schufen den notwendigen Platz und das Ambiente für diesen sozialen Charakter.
Inhaltsverzeichnis
- Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts: Die Transformation der Stadt als Notwendigkeit zur Genese des Flaneurs
- Die Großstadt und die Moderne
- Die Figur des Flaneurs
- Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts
- Das mittelalterliche Paris
- Die Passagen
- Die Boulevards
- Der Flaneur der Straße
- Baudelaire und der Flaneur
- Die Intention der Umstrukturierung
- Hausmann und die Gestaltung des Stadtraums
- Die Straßenbeleuchtung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entstehung des Flaneurs im 19. Jahrhundert und stellt die enge Verbindung zwischen der Genese der Großstadt und der Entwicklung dieser Figur heraus. Der Fokus liegt auf der Transformation von Paris, die durch die Industrialisierung und die zunehmende Urbanisierung geprägt war. Die Arbeit analysiert die Rolle der Passagen und Boulevards als Orte des öffentlichen Lebens und zeigt, wie diese Entwicklungen die Lebensweise und die Kultur des Flaneurs beeinflussten.
- Die Entstehung der Großstadt im 19. Jahrhundert
- Die Figur des Flaneurs als Phänomen der Moderne
- Die Transformation von Paris als Schauplatz der Flanerie
- Die Rolle der Passagen und Boulevards als Orte des öffentlichen Lebens
- Die Kultur und Lebensweise des Flaneurs
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die enge Verbindung zwischen der Entstehung der Großstadt und der Moderne im 19. Jahrhundert. Die Industrialisierung und die zunehmende Landflucht führten zu einem rasanten Wachstum der Städte, das den Lebensrhythmus und die Lebensweise der Menschen veränderte. Die Figur des Flaneurs wird als ein Phänomen dieser Zeit vorgestellt, das ohne die Genese der Großstadt vermutlich nicht entstanden wäre.
Das zweite Kapitel widmet sich der Figur des Flaneurs und seiner Lebensweise. Der Flaneur ist ein Beobachter und Beobachteter, der durch die Straßen der Stadt streift und die Eindrücke des urbanen Lebens aufnimmt. Seine bewußte Langsamkeit steht im Kontrast zur Schnelllebigkeit der Moderne und signalisiert ein Übermaß an Zeit, das er in den Müßiggang investieren kann.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Entwicklung von Paris im 19. Jahrhundert. Die Stadt erfuhr eine tiefgreifende Umgestaltung, die das mittelalterliche Paris mit seinen engen Gassen in eine moderne Metropole verwandelte. Die Entstehung der Passagen und Boulevards bot dem Flaneur neue Orte des öffentlichen Lebens, an denen er konsumieren, sich vergnügen und sich präsentieren konnte.
Das vierte Kapitel analysiert die Rolle der Passagen und Boulevards als Orte des öffentlichen Lebens. Die Passagen waren wahre Konsumtempel, die den Eintritt in eine glänzende Welt des Konsums ermöglichten und gleichzeitig vor den Gefahren des Alltags schützten. Die Boulevards boten dem Flaneur weite Flächen, auf denen er sehen und gesehen werden konnte.
Das fünfte Kapitel widmet sich der Figur des Flaneurs im Kontext der Modernisierung von Paris. Die Umgestaltung der Stadt durch Georges Eugène Hausmann führte zur Entstehung neuer Prachtstraßen, die den Flaneur in ihren Bann zogen. Die Straßencafés wurden zu einem neuen Attraktionspunkt für den Spazierenden und die Flanerie erfuhr einen Paradigmenwechsel.
Das sechste Kapitel beleuchtet die Rolle von Baudelaire als Vertreter des Flaneurs. Baudelaire beschreibt den Flaneur als „optisches Gerät“, das die Stadt speichert und die Schönheit des Augenblicks in der sich rasend schnell wandelnden Stadt erkennt und festhält.
Das siebte Kapitel analysiert die Intention der Umstrukturierung von Paris durch Napoléon III. Die geraden und breiten Straßen boten Platz für pompöse militärische Aufmärsche und Paraden und ermöglichten eine bessere Kontrolle der Stadt.
Das achte Kapitel widmet sich der Gestaltung des Stadtraums durch Hausmann. Die Straßen wurden kanalisiert und makadamisiert, um sie für Kutschen und Droschken besser befahrbar zu machen. Den Fußgängern sollten breite Gehwege das Promenieren und Bummeln schmackhaft machen.
Das neunte Kapitel beleuchtet die Rolle der Straßenbeleuchtung in der Entwicklung von Paris. Die Straßenbeleuchtung sorgte dafür, dass die Belebtheit der Stadt kein reines Tagesphänomen blieb. Paris wurde zur „Ville lumière“, zur „Astralwelt“ und Stadt, die niemals schläft.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Großstadt, die Moderne, den Flaneur, Paris, die Transformation der Stadt, die Passagen, die Boulevards, die Straßenbeleuchtung, die Kultur des 19. Jahrhunderts und die Lebensweise des Flaneurs.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Nicole Heubach (Author), 2014, Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Die Transformation der Stadt als Notwendigkeit zur Genese des Flaneurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294086