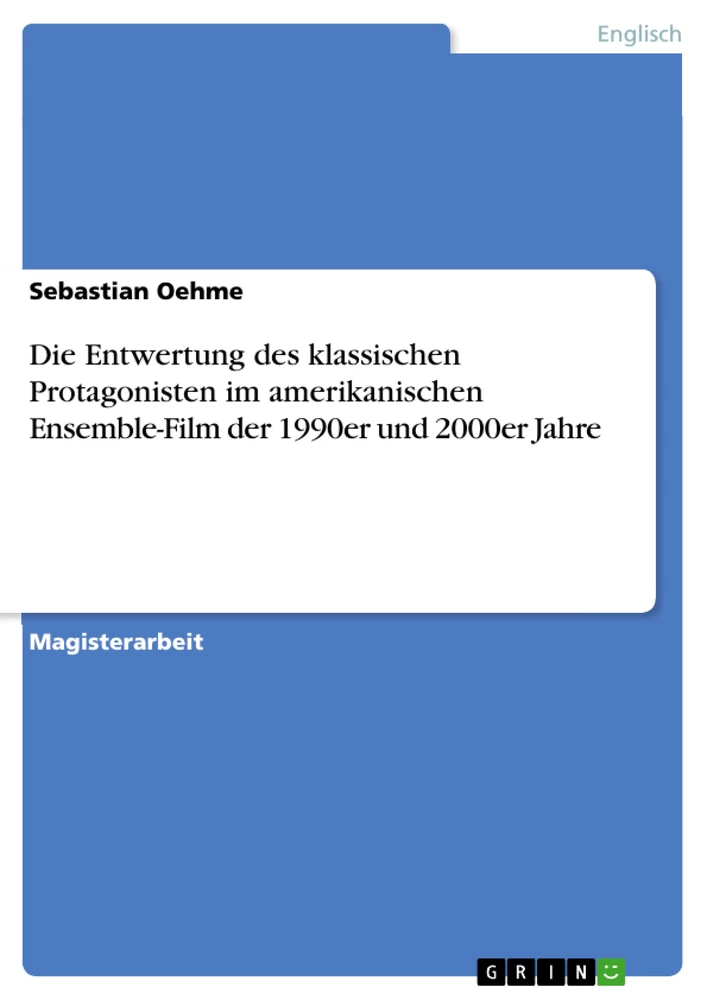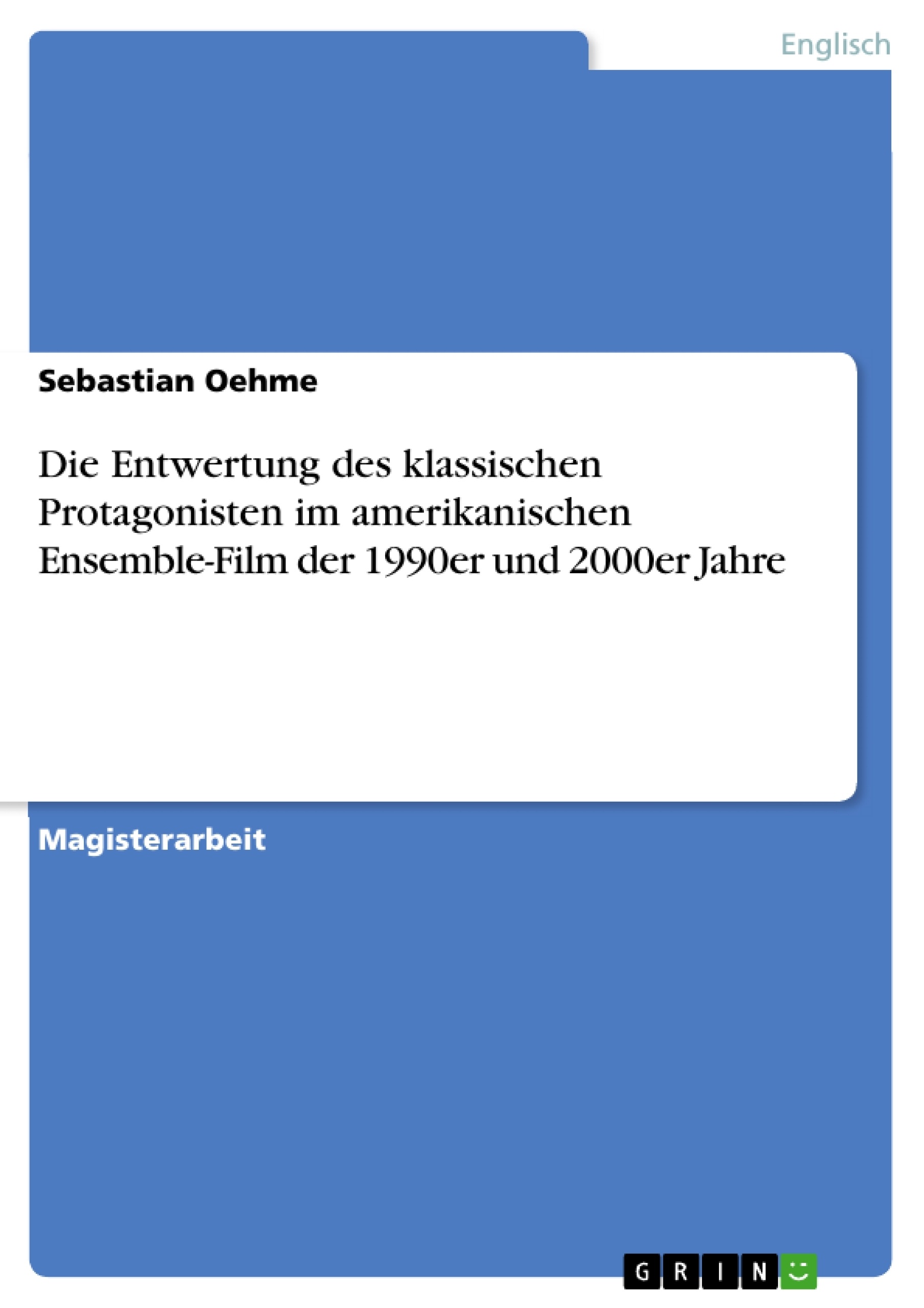Die Traumfabrik Hollywood steht seit den Anfängen des Films gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Blickpunkt eines jeden Cineasten. Assoziiert man heutzutage gemeinhin vor allem große Blockbuster mit amerikanischen Filmproduktionen, so unterschlägt man dabei das ebenfalls enorm einflussreiche Alternativ-Kino „Made in USA“. Dieser auch als Independent-Kino bekannte Produktionszweig bezeichnet in seiner ursprünglichen Bedeutung Filme, die ohne finanzielle Unterstützung durch die großen Produktionsstudios hergestellt werden. Heutzutage ist dieser Begriff nur noch schwer definierbar, da die Grenzen zwischen Mainstream- und Alternativ-Film spätestens seit dem Boom des amerikanischen Independent-Kinos in den 1990er Jahren immer mehr ineinander verfließen. Kreative Produktionen wie sex, lies, and videotape (1989) und Pulp Fiction (1994) ebneten den Weg für Machwerke, die trotz eines niedrigen Budgets große Erfolge sowohl in der Gunst der Filmkritiker als auch an den Kinokassen feiern konnten. Infolge dieses Popularitätsschubs entstand in den 1990ern sowie im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre eine Vielzahl an Filmen, die oft klassische Sujets auf ungewöhnliche Art und Weise erzählten. Sei es das unzuverlässige Erzählen in Kultfilmen wie The Usual Suspects (1995) oder Fight Club (1999), ein rückwärts erzählter Plot wie in Christopher Nolans Memento (2000) oder Ensemble-Filme mit episodenhafter Gliederung und einer großen Menge an Charakteren – sie alle haben gemeinsam, dass sie einen oftmals traditionellen Plot mithilfe alternativer Erzählformen zum Leben erwecken. Das Publikum wird somit vor die Herausforderung gestellt, bestimmte Ereignisse auf ungewohnte Art und Weise präsentiert zu bekommen; alteingesessene Sehgewohnheiten werden dadurch aufgebrochen und dekonstruiert.
Im Mittelpunkt dieser Magisterarbeit sollen letztgenannte Ensemble-Filme stehen, in denen nicht mehr der eine, klassische Protagonist den Fokus des Geschehens bildet, sondern die Last der Erzählung auf viele Schultern verteilt wird. Der Plot kann und wird unter diesen Umständen also nicht in Form eines singulären Handlungsstrangs präsentiert, sondern wird als eine Verwebung verschiedener – auf den ersten Blick oft zusammenhangsloser – Versatzstücke mit unterschiedlichen, allesamt involvierten Charakteren dargestellt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte
- Theoretische Vorüberlegungen
- Erzählstrukturen im klassischen Hollywood-Film
- Der Boom des Independent-Films in den 1990er und 2000er Jahren
- Inszenatorische Merkmale des Alternativ-Kinos
- Grundlagen des Ensemble-Films
- Definition, narrativer Aufbau und Abgrenzung
- Parallelen und Vorläufer des Ensemble-Films
- Crash und Rassismus
- Der Rassismus-Diskurs in Crash
- Ambiguität in der Darstellung der Handlungsträger
- Die Besonderheiten des L.A.-Ensemble-Films
- Der Einfluss von Drogen in Traffic
- Die lokale Segmentierung des Ensembles
- Wie die Multidimensionalität des Sujets eine Ensemble-Darstellung notwendig macht
- Die problematische Vergangenheitsbewältigung der Charaktere in Magnolia
- Das spiegelbildliche Ensemble in Magnolia
- Stilmittel als Verbindungsbrücken in Andersons Film
- Zusammenführung der gewonnenen Erkenntnisse
- Narrative Besonderheiten des Ensemble-Films
- Ein übergeordnetes Thema und untergeordnete Charaktere
- Die Struktur der Parallelmontage
- Die Komplexität des Sujets
- Zusammenhalt im segmentierten Film durch räumliche, zeitliche, inhaltliche und akzidentielle Kohärenz
- Implikationen, Einflüsse und Ausblicke
- Wirtschaftliche und künstlerische Implikationen rund um den Ensemble-Film
- Weitere Beispiele für multiprotagonistisch-mehrsträngige Narration im Kino
- Der Ensemble-Gedanke in anderen Medien
- Narrative Besonderheiten des Ensemble-Films
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit der Entwertung des klassischen Protagonisten im amerikanischen Ensemble-Film der 1990er und 2000er Jahre. Sie analysiert, wie die narrative Struktur dieser Filme die Betonung auf ein übergeordnetes Thema verlagert und die individuellen Charaktere in den Hintergrund rückt. Die Arbeit untersucht, wie die Vielzahl an Handlungssträngen und Charakteren in Ensemble-Filmen zu einer komplexen und vielschichtigen Erzählung führt, die die traditionellen Erzählmuster des klassischen Hollywood-Films in Frage stellt.
- Die Entwicklung des Ensemble-Films im Kontext des amerikanischen Independent-Kinos
- Die narrative Struktur des Ensemble-Films und die Rolle des übergeordneten Themas
- Die Entwertung des klassischen Protagonisten und die Bedeutung der Gemeinschaft
- Die Verwendung von Parallelmontage und anderen narrativen Kniffen zur Schaffung von Kohärenz
- Die kulturellen und gesellschaftlichen Implikationen des Ensemble-Films
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 legt den theoretischen Grundstein für die Analyse der Ensemble-Filme. Es beleuchtet die Erzählstrukturen des klassischen Hollywood-Films und die Entstehung des Independent-Kinos in den 1990er Jahren. Außerdem werden die Merkmale des Ensemble-Films definiert und seine Parallelen zu anderen literarischen Gattungen aufgezeigt.
Kapitel 3 analysiert den Film Crash (2004) und untersucht, wie das Thema Rassismus die Handlungsstränge der einzelnen Charaktere miteinander verbindet. Es wird die Ambiguität in der Darstellung der Handlungsträger und die Besonderheiten des L.A.-Ensemble-Films beleuchtet.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Film Traffic (2000) und analysiert, wie die Darstellung des Drogenhandels die Essenz des Films bildet. Es wird die lokale Segmentierung des Ensembles und die Notwendigkeit einer Ensemble-Darstellung aufgrund der Multidimensionalität des Sujets untersucht.
Kapitel 5 analysiert den Film Magnolia (1999) und untersucht, wie die problematische Vergangenheitsbewältigung der Charaktere den Mittelpunkt des Films bildet. Es wird das spiegelbildliche Ensemble in Magnolia und die Verwendung von Stilmitteln als Verbindungsbrücken in Andersons Film beleuchtet.
Kapitel 6 fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und zieht allgemeine Rückschlüsse auf die Filmgattung des Ensemble-Films. Es werden die Signifikanz der Einheit auf lokaler und temporaler Ebene sowie durch ein übergeordnetes Thema zum Herstellen von Kohärenz untersucht. Außerdem wird ein Blick auf aktuelle Ensemble-Film-Vertreter, ihren Einfluss auf filmische Erzählweisen im Allgemeinen sowie narrative Parallelen in anderen Medienformaten im Speziellen geworfen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Ensemble-Film, den klassischen Protagonisten, den amerikanischen Independent-Film, die 1990er und 2000er Jahre, die narrative Struktur, das übergeordnete Thema, die Parallelmontage, die Entwertung des Individuums, die Bedeutung der Gemeinschaft, die kulturellen und gesellschaftlichen Implikationen des Ensemble-Films.
- Citar trabajo
- M.A. Sebastian Oehme (Autor), 2011, Die Entwertung des klassischen Protagonisten im amerikanischen Ensemble-Film der 1990er und 2000er Jahre, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293963