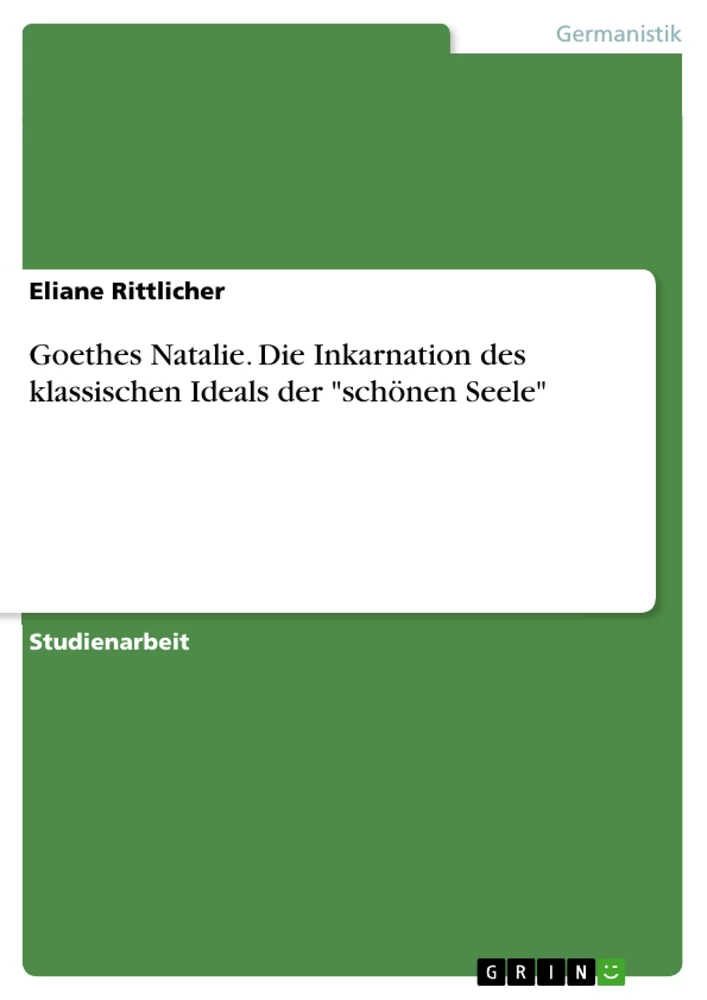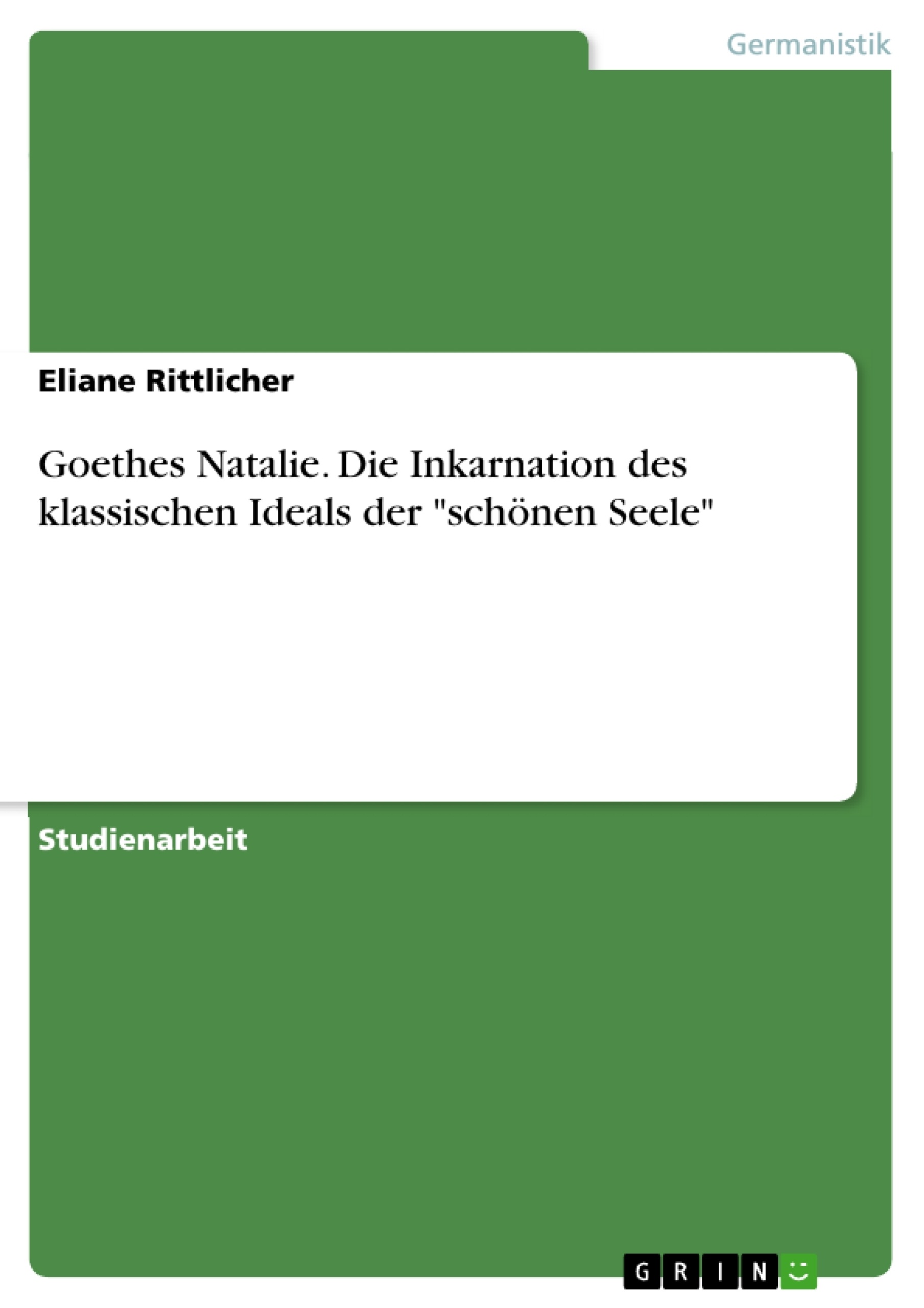Goethes Natalie…
„Unerreichbar wird immer die Handlungsweise bleiben, welche die Natur dieser schönen Seele vorgeschrieben hat. Ja sie verdient diesen Ehrennamen vor vielen anderen, mehr, wenn ich sagen darf, als unsre edle Tante selbst“, so Lothario über seine Schwester Natalie in Goethes 1795/96 erschienenen Romans Wilhelm Meisters Lehrjahre.
Der Begriff der schönen Seele und die damit einhergehenden Vorstellungen des Typus haben eine lange Entwicklungsgeschichte zu verzeichnen. Die Vorstellung von einer inneren Schönheit wurde bereits von Platon, Plotin, Augustinus, der spätmittelalterlichen und spanischen Mystik und der italienischen Renaissance ausgebildet. Diese innere Schönheit eines „reinen, edlen, harmonischen, tugendhaften, aus eigenem Antrieb nach dem Guten strebenden Gemüts“ wird als Seelenschönheit bzw. Kalokagathie bezeichnet.
Den Höhepunkt seiner Ausbreitung erlangt der Begriff in der 2. Hälfte des 18. Jh., wo er in der deutschen Literatur zum Modetypus wird. Dafür ist besonders Goethe verantwortlich, der den Begriff der „schönen Seele“ populär machte. […] Durchschlagende Popularität erlangte er jedoch mit Goethes „Bekenntnissen einer schönen Seele“ im 6. Buch von Wilhelm Meisters Lehrjahre…
Der letzte Höhepunkt der Begriffsentwicklung ist in Schillers Definition der schönen Seele zu sehen, die er in der 1793 erscheinenden Abhandlung Über Anmut und Würde entwickelt: Er überträgt die im Kallias-Fragment formulierte Definition von Schönheit als „Freiheit in der Erscheinung“ auf den Menschen; die Definition der schönen Seele wird als der ästhetische Höhepunkt dieser Abhandlung betrachtet. (dazu 2. Kap.)
Nach der Analyse der Figur der Natalie aus Goethes Wilhelm Meister im 3. Kap. Wird im 4. Kap. erörtert, inwiefern es Goethe gelungen ist, Natalie auf verschiedenen Ebenen „gemäß Schillers Intention als Inkarnation des klassischen Ideals der ‚schönen Seele’“ zu gestalten. - Darüber, dass Natalie die schöne Seele im Sinne Schillers ist, besteht unter Literaturwissenschaftlern kein Zweifel, zumal Goethe und Schiller in diesem Punkt übereinstimmten.
Die ausführliche Gegenüberstellung der Theorie der schönen Seele und ihrer Umsetzung in der Figur der Natalie in den Lehrjahren macht deutlich, inwiefern es Goethe gelungen ist, eine schöne Seele im Sinne Schillers zu erschaffen: In allen wesentlichen Punkten kann Natalie als eine solche schöne Seele bezeichnet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Schillers Definition einer schönen Seele
- Andeutungen zur schönen Seele im Kallias-Fragment
- Schillers Definition in Über Anmut und Würde
- Die Figur Natalie in Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre
- Wilhelms erste Begegnung mit der „,schönen Amazone"
- Natalie aus der Sicht der Stiftsdame
- Natalie im Kreise der Turmgesellschaft
- Natalie als Ideal
- Natalie als schöne Seele im Sinne Schillers
- Voraussetzung für eine schöne Seele: Natalie ist weiblichen Geschlechts
- Natalie,,die barmherzige Samariterin"
- Leichtigkeit im Handeln
- Neigungen als Bestimmungsgrund des Willens
- Harmonie von Sinnlichkeit und Vernunft, bzw. Pflicht und Neigung
- Natalies äußeres Erscheinungsbild
- Natalie als Ideal
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Figur der Natalie in Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre und untersucht, ob sie als „schöne Seele“ im Sinne Schillers verstanden werden kann. Die Arbeit analysiert Schillers Definition der „schönen Seele“ und setzt diese in Bezug zu Natalies Charakter und Handlungen im Roman.
- Schillers Definition der „schönen Seele“
- Natalies Charakter und Handlungen in Wilhelm Meisters Lehrjahre
- Die Verbindung zwischen Schillers Definition und Natalies Figur
- Die Rolle der „schönen Seele“ in der Literatur des 18. Jahrhunderts
- Die Bedeutung der „schönen Seele“ für die Entwicklung der weiblichen Figur in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der „schönen Seele“ ein und beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs. Sie stellt die Bedeutung von Schillers Definition für die Analyse der Figur Natalie in Wilhelm Meisters Lehrjahre heraus.
Das zweite Kapitel widmet sich Schillers Definition der „schönen Seele“. Es analysiert Schillers Ausführungen in seinen Briefen an Christian Gottfried Körner (Kallias-Fragment) und in seiner Abhandlung Über Anmut und Würde.
Das dritte Kapitel stellt die Figur der Natalie in Wilhelm Meisters Lehrjahre vor. Es beschreibt Wilhelms erste Begegnung mit Natalie, beleuchtet Natalies Charakter aus der Sicht der Stiftsdame und zeigt, wie sie im Kreise der Turmgesellschaft wahrgenommen wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die „schöne Seele“, Schillers Definition, Natalie, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Goethe, Anmut, Würde, Ideal, weibliche Figur, Literatur des 18. Jahrhunderts, Kalokagathie, Empfindsamkeit, Romantik.
- Citar trabajo
- Eliane Rittlicher (Autor), 2014, Goethes Natalie. Die Inkarnation des klassischen Ideals der "schönen Seele", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293803