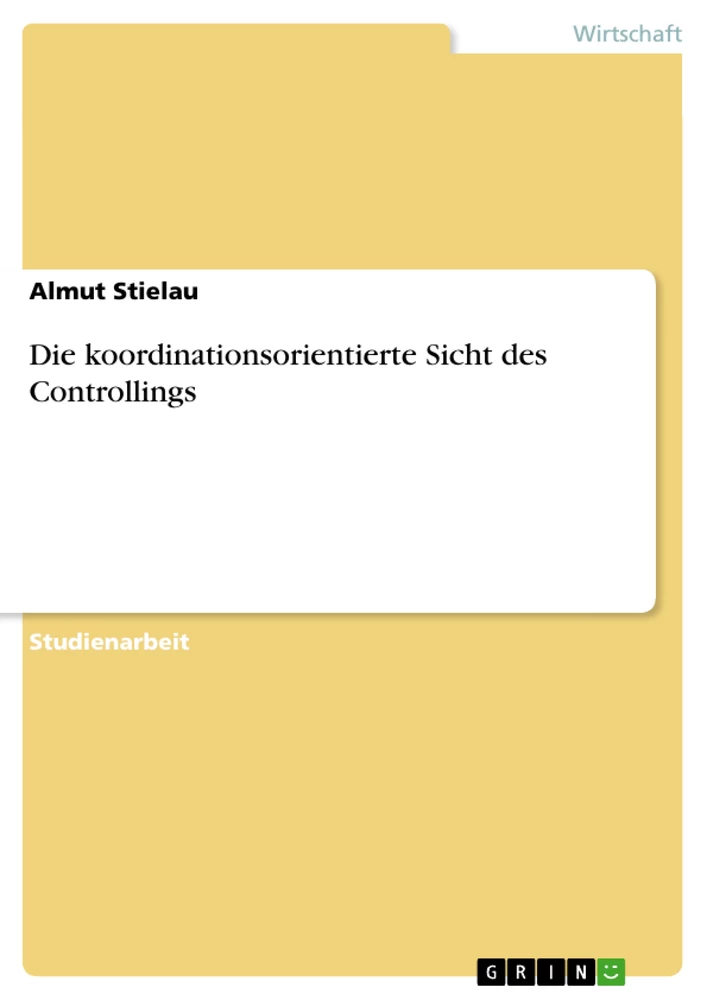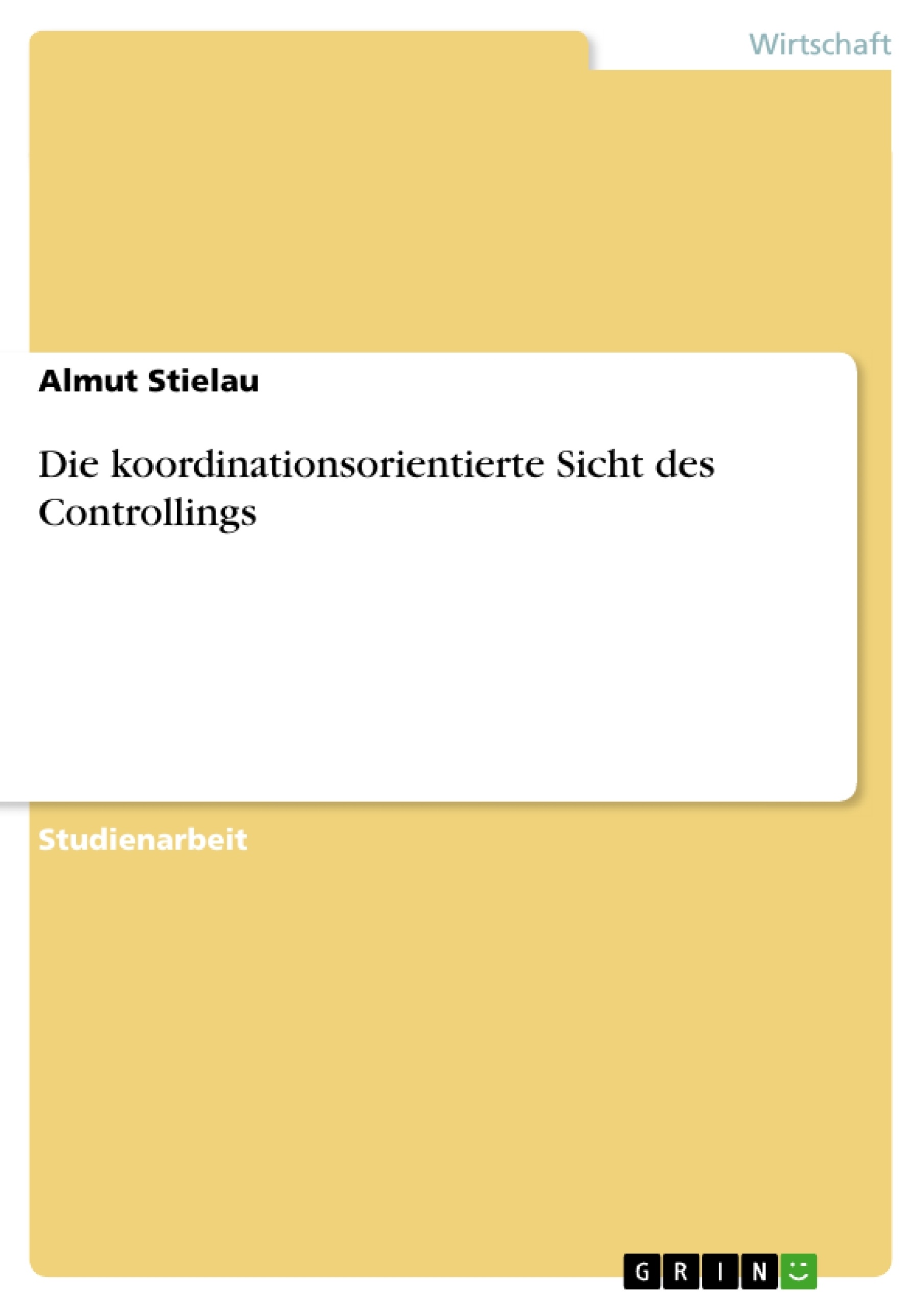Controlling kann nicht mit "Kontrolle" übersetzt werden; vielmehr ist die Kontrollfunktion nur ein Teilbereich des Controllers. Bis heute ist jedoch kein einheitlicher Controlling-Begriff definiert. Zwei Sichten werden diskutiert: Die Koordinationssicht und – damit verbunden - die strategische Sicht.
Mit zunehmender Komplexität des Führungssystems und der Führungsinstrumente wächst auch der Bedarf an Koordination. Das Controlling selbst wandelt sich dabei von einem weitgehend vergangenheitsbezogenen, buchhaltungsorientierten Instrument zu einem umfassenden, zukunftsorientierten und managementsystemorientierten Instrument.
Mit der wachsenden Bedeutung der strategischen Führung gewinnt auch das strategische Controlling an Gewicht. Der Übergang vom operativen zum strategischen Controlling ist dabei geprägt durch das Kriterium der Zukunftsausrichtung / Feedforward-Denken.
In Hinblick auf die zunehmende Komplexität und Dynamik der Unternehmensprobleme und -entscheide kann der Aufbau und Einsatz eines strategischen, vorwärtsorientierten Controlling-Systems einen wertvollen Beitrag leisten.
Inhalt
I. Das Controlling im Führungssystem (Schaubild)... 3
II. Der Controller: vom Informations- zum Koordinationsmanager?... 4
III. Vom operativen zum strategischen Controlling?... 6
Literatur... 8
I. Das Controlling im Führungssystem (Schaubild)
[Dies ist eine Leseprobe. Abbildungen und Grafiken werden nicht dargestellt.]
Eigene Darstellung auf Grundlage der angegebenen Literatur
II. Der Controller: vom Informations- zum Koordinationsmanager?
Vorbemerkung
Controlling kann nicht mit "Kontrolle" übersetzt werden. Vielmehr ist die Kontrollfunktion nur ein Teilbereich des Controllers.
Die Ableitung des Controlling-Begriffes aus "to control" umfasst auch das Regeln, Beherrschen oder Steuern eines Vorganges. Controlling wird meist im Sinne von "Controllership", d.h. als Tätigkeit des Controllers, verstanden. Das tatsächliche Controlling, das Anwenden, "macht" jeder Manager (bei dem auch die Handlungsverantwortung liegt) selbst. Der Controller liefert dem Manager hierzu die Voraussetzungen.
Bis heute ist jedoch kein einheitlicher Controlling-Begriff definiert, da je nach Ansatz die Zielorientierung, die Entscheidungsvorbereitung, die Informations- bzw. die Führungsfunktion hervorgehoben wird.
Controlling als Führungshilfe
Das Controlling ist eine Komponente der Führung sozialer Systeme. Es unterstützt die Führung bei ihrer Lenkungsaufgabe. Die (traditionelle) Controlling-Funktion besteht insbesondere in der Gestaltung und Überwachung des Planungs-, Kontroll- und Informationssystems:
Planungsaufgabe (z.B. Entwicklung von Planungsverfahren und Durchführung des Planungsprozesses)
Informations- und Berichtsaufgabe (z.B. Datenerfassungs-/ Informationsversorgungsprozess)
Steuerungs- und Kontrollaufgabe (z.B. Toleranzwertfestlegung, Soll-Ist-Vergleiche, Abweichungsanalysen, Prognosen/Hochrechnungen, Gegensteuerungsmaßnahmen)
Entwicklungstendenzen des Controlling:
Gerade in Hinblick auf die zunehmende Komplexität und Dynamik der Unternehmensprobleme und -entscheide scheint der Aufbau und Einsatz eines effizienten Controlling-Systems das richtige Instrument zu sein, um möglichst schnell und gezielt kritischen Entwicklungen begegnen zu können. Durch den Vorlauf eines rechtzeitigen Signals über sich anbahnende Tendenzen soll die Unternehmung ihre Handlungsflexibilität behalten.
Das Controlling selbst wandelt sich dabei von einem weitgehend vergangenheitsbezogenen, buchhaltungsorientierten Instrument zu einem umfassenden, zukunftsorientierten und managementsystemorientierten Instrument:
statt unternehmenserhaltende mehr innovationsfördende Sicht.
Anpassungsfähigkeit / Steuerungsfähigkeit statt Konservierung von Zuständen.
stärkere Entscheidungsbeteiligung.
stärkere Integration in die dezentralisierte und prozessorientierte Organisation (Center-, Team- und Self-Controlling, Prozess- und Projektcontrolling).
Erweiterung und Verlagerung der Koordinations- und Informationsaufgaben, mehr strategische Planung statt Tagesgeschäft.
Mit zunehmender Komplexität des Führungssystems und der Führungsinstrumente wächst auch der Bedarf an Koordination.
In der Koordination des Führungsgesamtsystems zur Sicherstellung einer zielgerichteten Lenkung liegt eine eigenständige Aufgabe des Controlling, die von keinem anderen Führungsteilsystem abgedeckt wird. Bei der zielorientierten Koordination handelt es sich um eine typische Führungsaufgabe. Durch den Ausbau der Führungssysteme kann sie vielfach jedoch nicht mehr allein von der Systemleitung wahrgenommen werden. Dennoch behält diese wie bei den anderen Führungsteilsystemen die letzte Verantwortung. Das Controlling hat damit eine Beratungs- und Servicefunktion. Der Stellenwert, der dem Controlling bei der Koordinierungsaufgabe zugemessen wird, wird jedoch unterschiedlich beurteilt.
Kritik an der Delegation der Koordinationsaufgabe an das Controlling:
Koordination als originäre Führungsaufgabe schlechthin ist nicht delegierbar.
Die Bedeutung der Koordination innerhalb der Managementfunktionen wird verkannt. Die Fähigkeit zu Koordination und Integration stellt nur eine der grundlegenden Fähigkeiten dar, die das Management beherrschen muss. (Weitere Fähigkeiten z.B. Lern- und Wandlungsfähigkeit sowie Fähigkeit zur Bewältigung von Komplexität).
Controlling ist kein "omnipotentes" Meta-Führungskonzept (verborgener Anspruch auf Leitung), sondern eine führungsunterstützende Querschnittsfunktion.
III. Vom operativen zum strategischen Controlling?
Das Controlling im operativen Bereich bezieht sich auf die Lenkung sozialer Systeme in einem weitgehend festgelegten Ziel- und Mittelrahmen. Mit der wachsenden Bedeutung der strategischen Führung gewinnt auch das strategische Controlling an Gewicht.
operatives Controlling Zielerreichung (Kosten und Erträge)
Auf kurz- und mittelfristige Lenkung ausgerichteter Teilbereich des Controlling.
Durch Koordination der Führungsteilsysteme soll es das Unternehmen innerhalb eines gegebenen Ziel-, Ressourcen- und Handlungsalternativen-Rahmens optimal ausrichten und damit eine Verbesserung des Systemverhaltens erzielen.
strategisches Controlling Zielfindung (Chancen/Risiken und Erfolgspotentiale)
Unterstützt die Führung, das Unternehmen auf Dauer zielorientiert auszurichten. Es trägt dazu bei, die Anpassungs- und Innovationsfähigkeit zu erhöhen.
Das Umfeld wird nicht mehr als gegeben angenommen, sondern problematisiert und systematisch in Frage gestellt. Die Führung soll zu rechtzeitigem, bewusstem Reagieren auf exogene und endogene Änderungen bewegt werden.
Der Übergang vom operativen zum strategischen Controlling ist geprägt durch das Kriterium der Zukunftsausrichtung / Feedforward-Denken.
Kontrolle (als Vergleich zwischen zwei Größen) wird oftmals in Form eines Ist-Soll-Vergleiches durchgeführt und bezieht sich in erster Linie auf vorhandene Ergebnisse (Feedback-Prinzip). Die Abweichungsanalyse als feedbackorientiertes Instrumentarium liefert Informationen über die Gründe der Abweichungen und ermöglicht, daraufhin Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten, die allerdings weitgehend nur noch eine Kompensation bereits entstandener Abweichungen bewirken.
Die traditionelle Methode der Finanzbuchhaltung als "Rückschau-Rechnung" ist für eine zukunftsorientierte Steuerung jedoch nicht geeignet. Die Unternehmung benötigt ein Frühwarnsystem, das interne und externe Faktorenentwicklungen aufgreift, lange bevor sie sich als Kosten und Erträge niederschlagen. Für die Bewältigung der primär am Feedforward-Prinzip ausgerichteten Planungs- und Entscheidungsprobleme werden zukunftsbezogene Informationen sowohl über das geltende Zielsystem als auch über das Entscheidungsfeld des Unternehmens benötigt.
Durch die Antizipation von Abweichungen sollen mögliche Abweichungen bereits erkannt werden, bevor sie entstanden sind, um sie noch vermeiden zu können.
Die Schwerpunktverlagerung zu einem mehr strategisch orientierten Controlling bringt eine Aufwertung des Controlling mit sich und eröffnet die Chance, über die Definition neuer Ziele, Aufgabeninhalte, Methoden und Instrumente einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der komplexen Unternehmensprobleme zu leisten.
Was strategisches Controlling genau beinhaltet, und ob die strategische Controlling-Aufgabe von der operativen zu trennen ist, ist jedoch strittig. Kritik:
Wird strategisches Controlling als Managementfunktion verstanden, müssten die entsprechenden strategischen Funktionen entwickelt und implementiert sein und entsprechende Instrumente bereitstehen. Strategische Kontrolle und strategische Früherkennungssysteme befinden sich jedoch erst in der Entwicklung. Verlässliche Instrumente zur Potentialerfassung oder gar besondere Instrumente eines strategischen Controlling sind nicht bekannt. Strategisches Controlling als Managementfunktion ist im derzeitigen Entwicklungstand des strategischen Managements der 3. vor dem 1. Schritt. Erst müssen die einzelnen strategischen Managementfunktionen überhaupt weiter entwickelt und implementiert werden!
Schaffung und Erhaltung von Erfolgspotentialen durch das strategische Controlling ist durch eine effiziente Nutzung der vorhandenen Instrumente im Rahmen des operativen Controlling zu unterstützen. Eine organisatorische und personelle Trennung würde diese enge sachliche Beziehung erheblich beeinträchtigen. Darüber hinaus nehmen die Probleme der wechselseitigen Abstimmung, Koordination und Information erheblich zu.
Bei strategischen Fragestellungen schwingt immer auch die Frage der operativen Machbarkeit mit. Umgekehrt erhalten operative Fragestellungen ihren Sinn erst im Licht einer Strategie. Daraus ergeben sich die Forderungen: Planung, Steuerung und Kontrolle müssen als integriertes Gesamtsystem gestaltet und betrieben werden.
Literatur
Peters, S.: Betriebswirtschaftslehre (6. Aufl.) München, 1994
à Controlling als Abstimmungssystem zwischen Informationsverwendung und -versorgung
Küpper, Weber, Zünd: Zum Verständnis und Selbstverständnis des Controlling. In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1990, S. 281-293.
à Thesen als Fundament einer allgemeinen Theorie des Controlling
Hopfenbeck, W.: Allgemeine Betriebswirtschafts- und Managementlehre (11. Aufl.) Landsberg, 1997
à Darstellung unterschiedlicher Controlling-Ansätze
Häufig gestellte Fragen
Was ist Controlling im Führungssystem laut dieser Leseprobe?
Controlling ist eine Komponente der Führung sozialer Systeme, die die Führung bei ihrer Lenkungsaufgabe unterstützt. Die traditionelle Controlling-Funktion umfasst die Gestaltung und Überwachung des Planungs-, Kontroll- und Informationssystems.
Welche Aufgaben hat der Controller laut dieser Leseprobe?
Der Controller ist kein reiner Kontrolleur, sondern übernimmt Aufgaben in der Planung, Informationsversorgung und Steuerung. Er liefert Managern die Voraussetzungen für das tatsächliche Controlling, das diese selbst ausüben.
Wie wandelt sich das Controlling laut dieser Leseprobe?
Das Controlling wandelt sich von einem vergangenheitsbezogenen, buchhaltungsorientierten Instrument zu einem umfassenden, zukunftsorientierten und managementsystemorientierten Instrument. Es wird innovationsfördernder, anpassungsfähiger und stärker in die dezentralisierte Organisation integriert.
Welche Kritik gibt es an der Delegation der Koordinationsaufgabe an das Controlling laut dieser Leseprobe?
Kritiker argumentieren, dass Koordination eine originäre Führungsaufgabe ist, die nicht delegierbar ist. Sie sehen Controlling nicht als "omnipotentes" Meta-Führungskonzept, sondern als führungsunterstützende Querschnittsfunktion.
Was ist der Unterschied zwischen operativem und strategischem Controlling laut dieser Leseprobe?
Operatives Controlling bezieht sich auf die Lenkung in einem festgelegten Zielrahmen (Zielerreichung, Kosten und Erträge), während strategisches Controlling die Führung unterstützt, das Unternehmen auf Dauer zielorientiert auszurichten (Zielfindung, Chancen/Risiken und Erfolgspotentiale).
Was bedeutet "Feedforward-Denken" im Zusammenhang mit strategischem Controlling laut dieser Leseprobe?
Feedforward-Denken bedeutet, dass strategisches Controlling zukunftsorientiert ist und versucht, Abweichungen zu antizipieren, bevor sie entstehen, um sie zu vermeiden. Dies steht im Gegensatz zum Feedback-Prinzip des operativen Controllings, das sich auf die Analyse vergangener Ergebnisse konzentriert.
Welche Kritik gibt es am strategischen Controlling laut dieser Leseprobe?
Kritiker bemängeln, dass strategisches Controlling oft als Managementfunktion verstanden wird, ohne dass die entsprechenden strategischen Funktionen und Instrumente ausreichend entwickelt und implementiert sind. Sie sehen es als zu früh, strategisches Controlling als separate Funktion zu etablieren, bevor die strategischen Managementfunktionen selbst weiterentwickelt sind.
Welche Literatur wird in dieser Leseprobe erwähnt?
Es werden folgende Werke erwähnt: Peters, S.: Betriebswirtschaftslehre (6. Aufl.) München, 1994; Küpper, Weber, Zünd: Zum Verständnis und Selbstverständnis des Controlling. In: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 1990, S. 281-293; Hopfenbeck, W.: Allgemeine Betriebswirtschafts- und Managementlehre (11. Aufl.) Landsberg, 1997.
- Quote paper
- MBA, M.A. Almut Stielau (Author), 1997, Die koordinationsorientierte Sicht des Controllings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293690