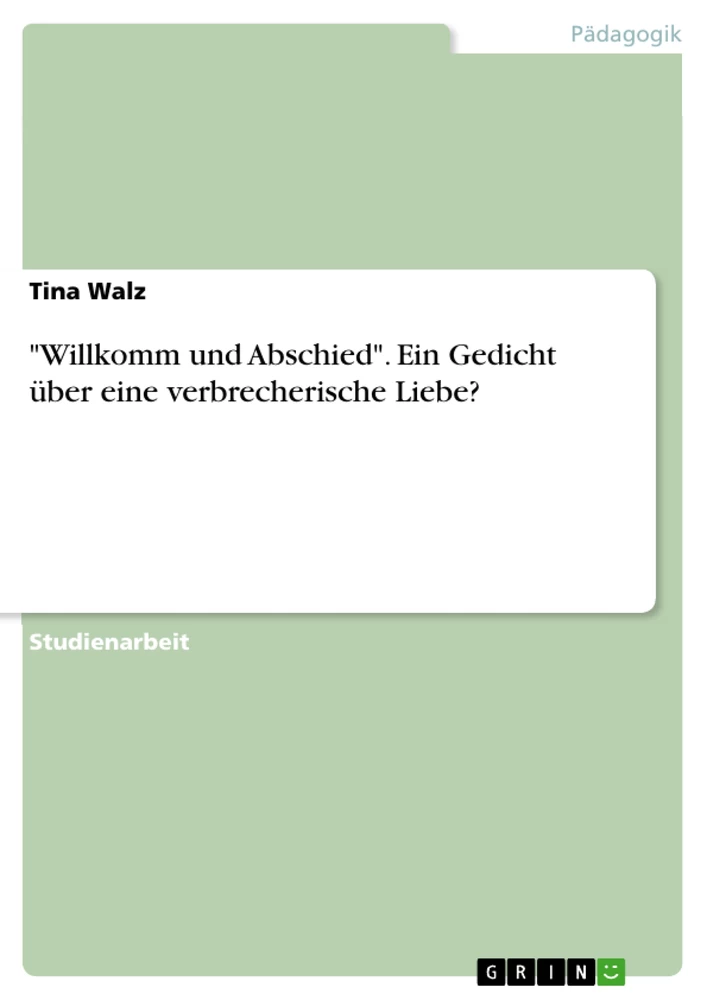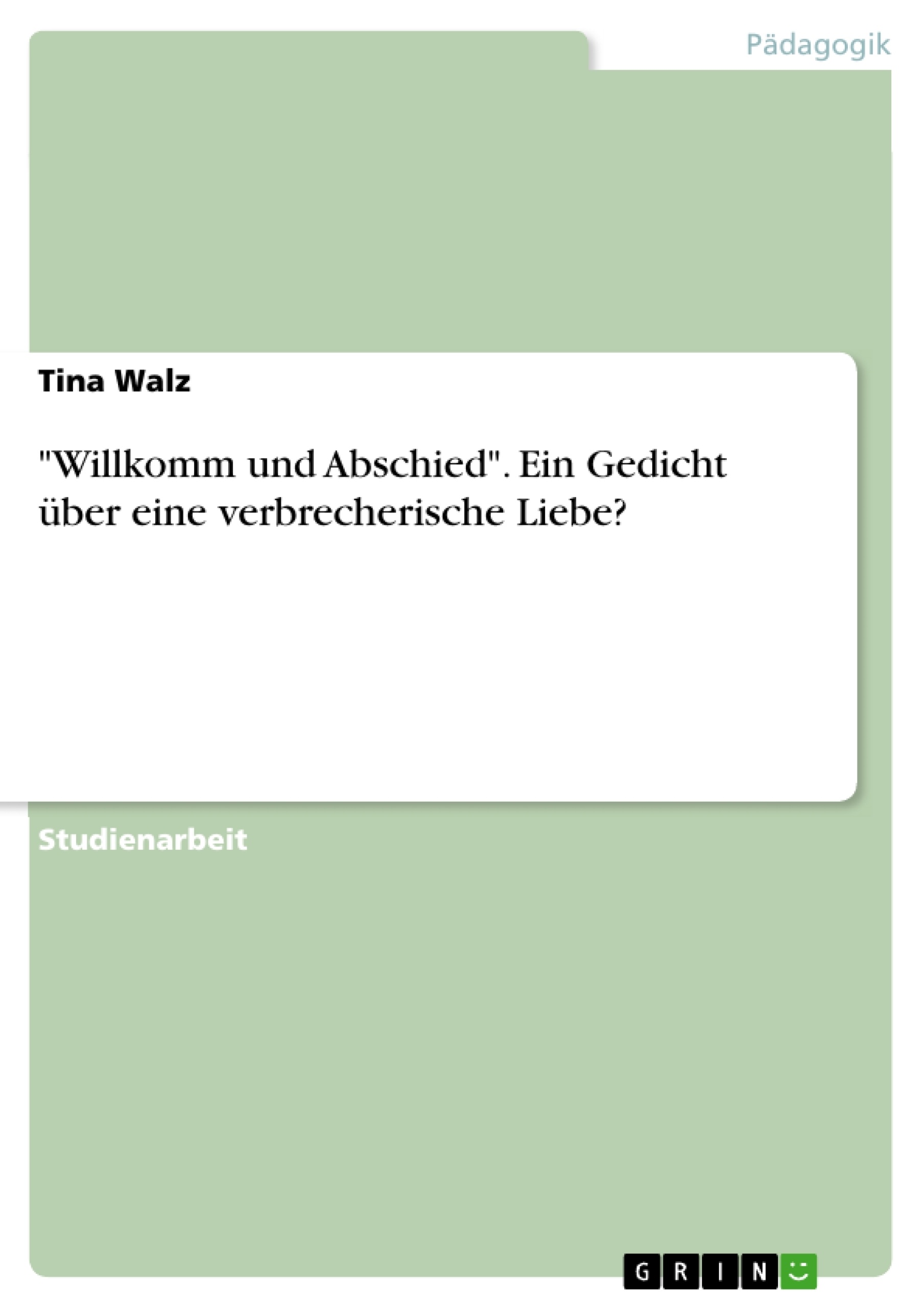Das Gedicht „Willkommen und Abschied“ wird nicht nur als eines der berühmtesten Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe angesehen, sondern „als eines der bekanntesten Gedichte der deutschen Literatur überhaupt“. Dabei ist vielen Lesern nicht bekannt, dass dieses Gedicht von Goethe mehrmals überarbeitet wurde. Während Volker Neuhaus in seinem Werk „Andre verschlafen ihren Rausch, meiner steht auf dem Papiere“ zwar anmerkt, dass Goethes „leichte Änderungen durchweg Verbesserungen sind“, bleibt die Frage nach dem Grund der Umänderungen offen.
Das Gedicht wird in seiner endgültigen Fassung als Beginn der Erlebnislyrik angesehen und innerhalb der Sesenheimer Lieder als Inbegriff des Liebesgedichts. Der Germanist Benno von Wiese bezeichnet das Gedicht sogar als eine „Ballade des Herzens und ihrer Schicksale“ Nicht selten werden dabei die Sesenheimer Lieder, welche zu Goethes Zeit in Straßburg entstanden sind, auch autobiographisch interpretiert. Goethes damaliges Liebesverhältnis zur Sesenheimer Pfarrerstochter Friederike Brion legen diese Vermutung nahe. Auch die Tatsache, dass das im Gedicht behandelte Treffen in Goethes Autobiographie „Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit“ geschildert wird, stützen die biographische Interpretation.
Die Änderung der Überschrift, welche im Jahr 1789 „Willkomm und Abschied“ lautet und rund zwanzig Jahre später zu „Willkommen und Abschied“ umgeändert wird, erscheint auf den ersten Blick unbedeutend. Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass es sich bei der zuerst gewählten Überschrift um einen feststehenden und geläufigen juristischen Begriff handelt, welcher zu Zeiten Goethes auch in der Alltagssprache fest verankert war. Mit dem Terminus „Willkomm und Abschied“ wird nämlich zu jener Zeit eine Zusatzstrafe für Gefängnisinsassen beschrieben.
Dies wirft die Frage auf, welche Assoziationen Zeitgenossen mit dem ursprünglichen Titel verbunden haben. Schwingen in dem vorliegenden Gedicht stillschweigende Voraussetzungen mit, wenn man die Überschrift in ihrer ursprünglichen, juristischen Bedeutung liest? Stellt das Gedicht in seiner Fassung von 1789 also eine verbrecherische Liebe dar? Gesteht sich Goethe möglicherweise bei einer autobiographischen Interpretation unzüchtiges Verhalten ein? Auf diese Fragen sollen in der vorliegenden Hausarbeit Antworten gefunden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Eine Überschrift, die Fragen aufwirft
- Ein Gedicht - mehrere Fassungen: Die wesentlichen Unterschiede
- Der „Willkomm und Abschied“ im rechtskundigen Kontext
- Die Geschlechterrollen in Deutschland im 18. Jahrhundert
- Gesellschaftlicher Aspekt
- Sexueller Aspekt
- Goethes Beziehung zu Friederike Brion
- Strafvollzug oder Erlebnisdichtung: Stellt das Gedicht eine verbrecherische Liebe dar?
- Fazit und eigene Meinung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes Gedicht „Willkomm und Abschied“ und seine verschiedenen Fassungen, um die Frage zu beantworten, ob das Gedicht eine verbrecherische Liebe darstellt. Die Analyse betrachtet die juristische Bedeutung des ursprünglichen Titels, die gesellschaftlichen und sexuellen Normen des 18. Jahrhunderts, sowie Goethes Beziehung zu Friederike Brion.
- Die unterschiedlichen Fassungen des Gedichts und deren Bedeutung
- Die juristische Konnotation des Titels „Willkomm und Abschied“
- Die Geschlechterrollen im 18. Jahrhundert und ihre Relevanz für die Interpretation des Gedichts
- Die biographische Komponente: Goethes Beziehung zu Friederike Brion
- Die Frage nach der Deutung des Gedichts als Darstellung verbrecherischer Liebe
Zusammenfassung der Kapitel
Eine Überschrift, die Fragen aufwirft: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Darstellung verbrecherischer Liebe in Goethes Gedicht „Willkomm und Abschied“ vor. Sie hebt die Vielschichtigkeit des Gedichts hervor, insbesondere die unterschiedlichen Fassungen und die vieldeutige Bedeutung des ursprünglichen Titels im Kontext der juristischen Terminologie des 18. Jahrhunderts. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die Analyse der verschiedenen Fassungen, die Erörterung der gesellschaftlichen und rechtlichen Bedingungen sowie die Betrachtung der biographischen Hintergründe umfasst. Die Einleitung legt den Grundstein für eine umfassende Untersuchung, die weit über eine oberflächliche Interpretation des Gedichts hinausgeht.
Ein Gedicht - mehrere Fassungen: Die wesentlichen Unterschiede: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Fassungen von Goethes „Willkommen und Abschied“, beginnend mit der ersten, überschriftslosen Version von 1775, und vergleicht sie mit den späteren Versionen von 1789 und 1810. Die Analyse konzentriert sich auf konkrete sprachliche und stilistische Veränderungen, die Auswirkungen auf die Gesamtdeutung des Gedichts haben. Es wird gezeigt, wie die Veränderungen des lyrischen Ichs, der Betonung des Mutes und der Darstellung des Abschieds die Interpretation beeinflussen und die Ambivalenz der Liebesgeschichte unterstreichen. Der Vergleich der Fassungen liefert wichtige Hinweise auf Goethes Entwicklung als Dichter und seine Intentionen.
Der „Willkomm und Abschied“ im rechtskundigen Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet die juristische Bedeutung des Titels „Willkomm und Abschied“ im 18. Jahrhundert. Es wird dargelegt, dass dieser Ausdruck eine spezifische Bedeutung im Kontext des Strafvollzugs hatte und als Zusatzstrafe für Gefängnisinsassen verwendet wurde. Die Untersuchung dieser juristischen Konnotation ist zentral für die Interpretation des Gedichts, da sie die Möglichkeit aufzeigt, dass der Titel eine implizite Verbindung zu verbrecherischen Handlungen herstellt. Die Analyse des historischen Kontextes ermöglicht eine tiefere Einsicht in die mögliche Intention Goethes.
Die Geschlechterrollen in Deutschland im 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel untersucht die gesellschaftlichen und sexuellen Normen des 18. Jahrhunderts in Deutschland, um das Verständnis des Gedichts im Kontext der damaligen Zeit zu erweitern. Es werden die eingeschränkten Möglichkeiten von Frauen und die gesellschaftliche Bewertung von außerehelichen Beziehungen analysiert. Diese Analyse liefert den Hintergrund, um die Handlung des Gedichts und die impliziten gesellschaftlichen Konsequenzen einer solchen Beziehung zu bewerten. Die Betrachtung der Geschlechterrollen ist essenziell für die Interpretation des Gedichts als Darstellung einer potentiell „verbrecherischen“ Liebe.
Goethes Beziehung zu Friederike Brion: Dieser Abschnitt analysiert Goethes Beziehung zu Friederike Brion, um die biographischen Elemente im Gedicht „Willkomm und Abschied“ zu beleuchten. Es wird der Frage nachgegangen, inwieweit die biografischen Fakten die Interpretation des Gedichts beeinflussen und ob das Gedicht als autobiographische Darstellung ihrer Beziehung betrachtet werden kann. Diese biographische Perspektive liefert weitere wichtige Aspekte für das Verständnis der emotionalen Dynamik und der möglichen moralischen Implikationen der geschilderten Liebesbeziehung.
Schlüsselwörter
Goethe, Willkomm und Abschied, Willkommen und Abschied, Erlebnislyrik, Sesenheimer Lieder, Friederike Brion, Juristische Terminologie, Geschlechterrollen, 18. Jahrhundert, Liebesgedicht, Autobiographische Interpretation, Verbrecherische Liebe.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Willkomm und Abschied"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Goethes Gedicht "Willkomm und Abschied" in seinen verschiedenen Fassungen und untersucht, ob es eine "verbrecherische Liebe" darstellt. Die Analyse berücksichtigt juristische, gesellschaftliche, sexuelle und biographische Aspekte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die unterschiedlichen Fassungen des Gedichts und deren Bedeutung, die juristische Konnotation des Titels, die Geschlechterrollen im 18. Jahrhundert, Goethes Beziehung zu Friederike Brion und die Frage nach der Deutung des Gedichts als Darstellung verbrecherischer Liebe.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, die die Forschungsfrage stellt und den methodischen Ansatz beschreibt. Es folgen Kapitel zur Analyse der verschiedenen Gedichtfassungen, zur juristischen Bedeutung des Titels, zu den Geschlechterrollen des 18. Jahrhunderts, zu Goethes Beziehung zu Friederike Brion und ein Fazit mit einer eigenen Meinung. Schlüsselwörter werden ebenfalls angegeben.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Kapitel behandeln jeweils einen Aspekt der Analyse: Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage. Ein Kapitel analysiert die verschiedenen Fassungen des Gedichts und deren Unterschiede. Ein weiteres Kapitel beleuchtet die juristische Bedeutung des Titels "Willkomm und Abschied". Ein Kapitel widmet sich den Geschlechterrollen im 18. Jahrhundert. Ein weiteres Kapitel untersucht Goethes Beziehung zu Friederike Brion. Abschließend gibt es ein Kapitel mit Fazit und eigener Meinung.
Welche juristische Bedeutung hat der Titel "Willkomm und Abschied"?
Der Titel "Willkomm und Abschied" hatte im 18. Jahrhundert eine spezifische Bedeutung im Kontext des Strafvollzugs und wurde als Zusatzstrafe für Gefängnisinsassen verwendet. Diese juristische Konnotation ist wichtig für die Interpretation des Gedichts, da sie eine implizite Verbindung zu verbrecherischen Handlungen suggerieren könnte.
Welche Rolle spielen die Geschlechterrollen im 18. Jahrhundert?
Die Analyse der eingeschränkten Möglichkeiten von Frauen und der gesellschaftlichen Bewertung außerehelicher Beziehungen im 18. Jahrhundert liefert den Kontext, um die Handlung des Gedichts und die impliziten gesellschaftlichen Konsequenzen einer solchen Beziehung zu bewerten. Dies ist essenziell für die Interpretation des Gedichts als Darstellung einer potentiell "verbrecherischen" Liebe.
Wie wird Goethes Beziehung zu Friederike Brion berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert Goethes Beziehung zu Friederike Brion, um die biographischen Elemente im Gedicht zu beleuchten. Es wird untersucht, inwieweit die biografischen Fakten die Interpretation des Gedichts beeinflussen und ob das Gedicht als autobiographische Darstellung ihrer Beziehung betrachtet werden kann.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen Goethe, Willkomm und Abschied, Erlebnislyrik, Sesenheimer Lieder, Friederike Brion, Juristische Terminologie, Geschlechterrollen, 18. Jahrhundert, Liebesgedicht, Autobiographische Interpretation und Verbrecherische Liebe.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob Goethes Gedicht "Willkomm und Abschied" eine verbrecherische Liebe darstellt.
Wie wird die Vielschichtigkeit des Gedichts behandelt?
Die Vielschichtigkeit des Gedichts wird durch die Analyse der verschiedenen Fassungen, die Erörterung der gesellschaftlichen und rechtlichen Bedingungen sowie die Betrachtung der biographischen Hintergründe umfassend untersucht.
- Quote paper
- Tina Walz (Author), 2013, "Willkomm und Abschied". Ein Gedicht über eine verbrecherische Liebe?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293686