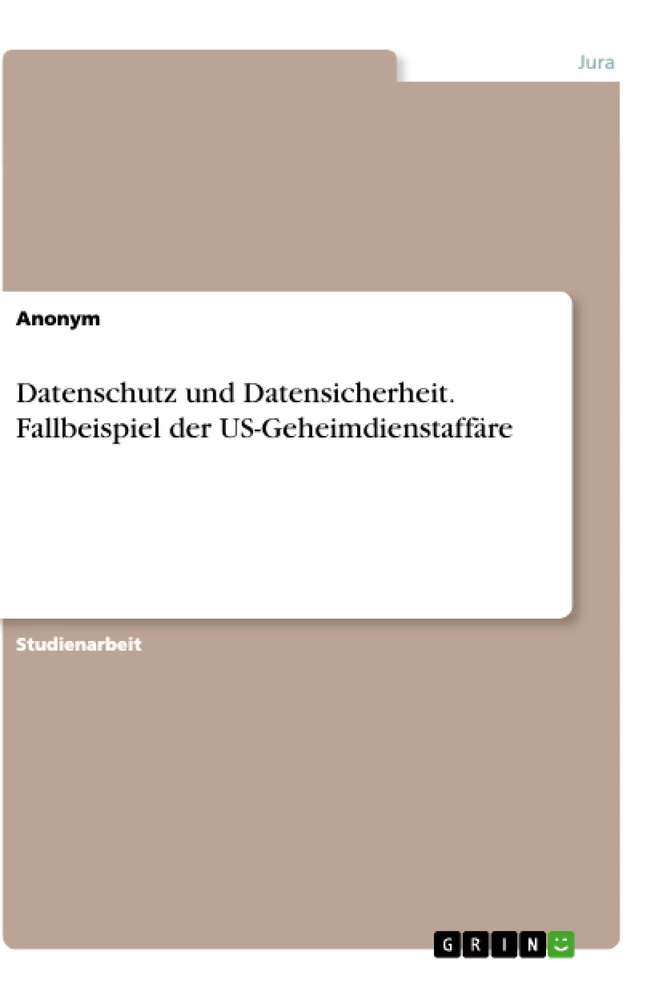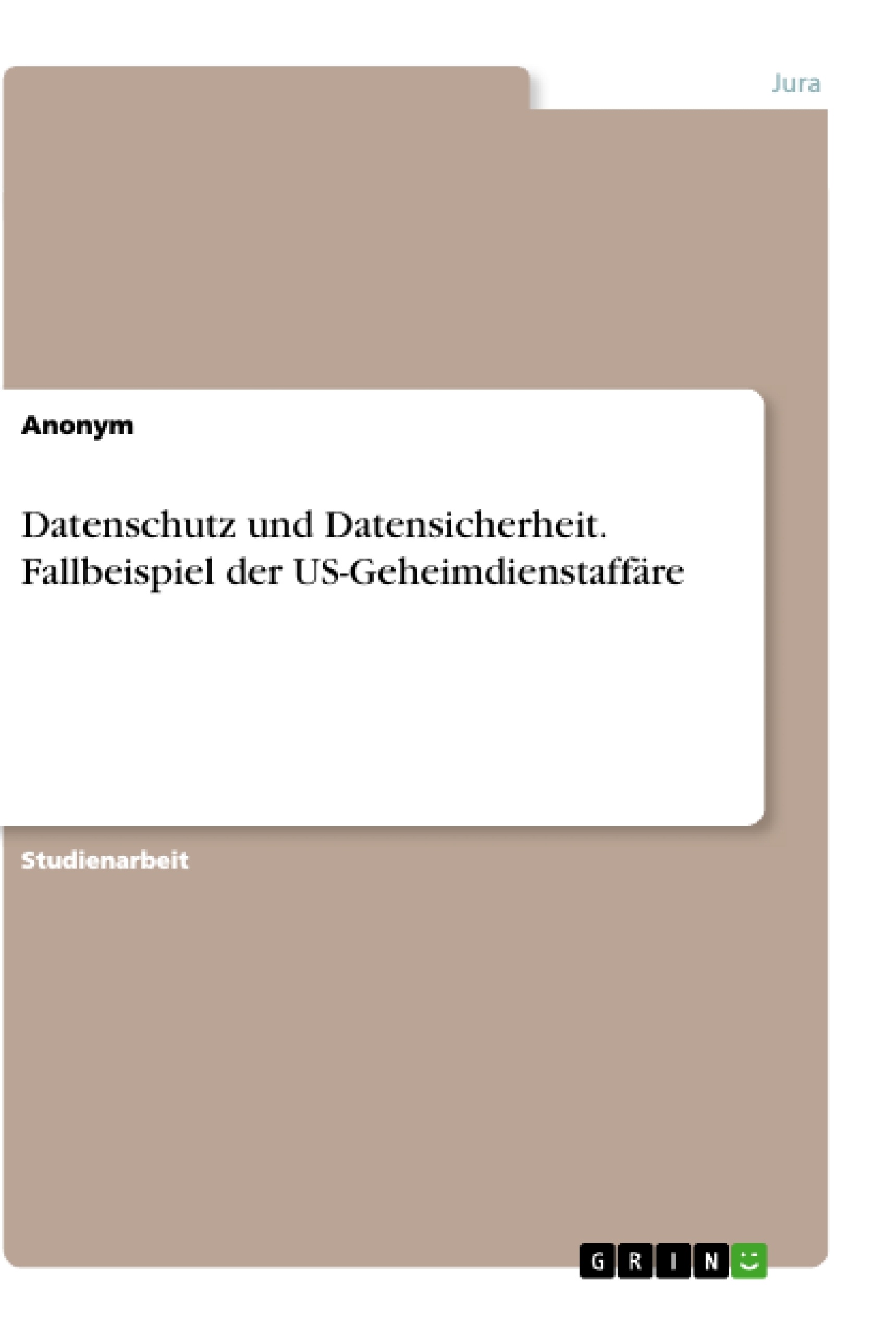In der folgenden Studienarbeit wird das Thema des Datenschutzes und der Datensicherheit, vertieft durch das Fallbeispiel der US-Geheimdienstaffäre, behandelt.
Da Daten in immer zunehmenden Maße elektronisch gespeichert und übermittelt werden sowie orts- und zeitunabhängig zusammengeführt werden können, kann es zu einer außerordentlichen Gefahr oder Bedrohung der eigenen Persönlichkeitsbewahrung werden. Deshalb ist dieses Thema auch im aktuellen Kontext von besonderer Relevanz (waste.informatik, 2013, S. 3).
Die Ausarbeitung ist folgendermaßen strukturiert. Beginnend mit einer Definition von Datenschutz und Datensicherheit, worauf im Anschluss die Unterschiede zwischen den beiden Begriffen festgelegt werden und ebenfalls auf die informationelle Selbstbestimmung näher eingegangen wird. Darüber hinaus wird die Thematik durch das Fallbeispiel der US-Geheimdienstaffäre und dessen Folgen sowie kontroversen Ansichten von Experten und bekannten Persönlichkeiten verstärkt. Abschließend wird ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Datenschutz und Datensicherheit
- Abgrenzung von Datenschutz und Datensicherheit
- Informationelle Selbstbestimmung
- Fallbeispiel: US-Geheimdienstaffäre
- Folgen
- Kontroverse Ansichten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht Datenschutz und Datensicherheit am Beispiel der US-Geheimdienstaffäre. Ziel ist es, die Begriffe abzugrenzen, die informationelle Selbstbestimmung zu beleuchten und die Implikationen des NSA-Skandals zu analysieren.
- Abgrenzung von Datenschutz und Datensicherheit
- Informationelle Selbstbestimmung als Grundrecht
- Das NSA-Überwachungsprogramm „Prism“ und seine Folgen
- Kontroverse Meinungen zum Datenschutz im digitalen Zeitalter
- Relevanz des Themas im Kontext der zunehmenden Digitalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Datenschutz und Datensicherheit ein und erläutert die Relevanz im Kontext der zunehmenden elektronischen Datenverarbeitung. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit, der von Definitionen über ein Fallbeispiel bis hin zu einem Fazit reicht. Die Arbeit hebt die besondere Bedeutung des Schutzes der Persönlichkeitsrechte im Zeitalter der digitalen Vernetzung hervor und betont die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit den damit verbundenen Gefahren.
Datenschutz und Datensicherheit: Dieses Kapitel definiert Datenschutz im weiteren und engeren Sinne, wobei der Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch im Fokus steht. Es betont die Rolle des Einzelnen und staatlicher Institutionen bei der Kontrolle der Datenverarbeitung und verweist auf das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Der Unterschied zu Datensicherheit wird deutlich herausgearbeitet: Datenschutz schützt die Person, Datensicherheit die Daten selbst vor Verlust, Zerstörung und unberechtigtem Zugriff. Techniken der Datensicherheit, wie z.B. Antivirusprogramme und Backups, werden kurz erwähnt. Die Bedeutung der Kontrolle der Datenverarbeitung durch den Einzelnen wird unterstrichen, insbesondere im Hinblick auf die Gefahren des Internets.
Abgrenzung von Datenschutz und Datensicherheit: Dieser Abschnitt differenziert klar zwischen Datenschutz und Datensicherheit. Während Datenschutz den Schutz der Person vor Verletzungen des Persönlichkeitsrechts durch Datenmissbrauch gewährleistet, schützt die Datensicherheit die Daten selbst vor Verlust, Zerstörung und unberechtigtem Zugriff. Die Verletzung des Datenschutzes kann zu einer Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts führen, während die Verletzung der Datensicherheit zu Datenverlust, -zerstörung und -missbrauch führt. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verbindet beide Aspekte. Das Kapitel erläutert die Ziele des BDSG, die auf die Vermeidung und Kontrolle der Datenverarbeitung sowie die Wahrung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung abzielen. Internationale Standards für die IT-Sicherheit, basierend auf Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen, werden ebenfalls erwähnt.
Informationelle Selbstbestimmung: Dieser Abschnitt behandelt die informationelle Selbstbestimmung als ein wichtiges Ziel des Bundesdatenschutzgesetzes. Es wird als Grundrecht beschrieben, das jeder Person die Kontrolle über die Preisgabe und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten ermöglicht. Das Prinzip der informationellen Gewaltenteilung, das einen kontrollierten Datenaustausch zwischen Stellen gewährleistet, wird erklärt. Der Abschnitt thematisiert auch Bedrohungen dieser Selbstbestimmung, wie die Vorratsdatenspeicherung und die Auswertung von Daten zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle.
Fallbeispiel: US-Geheimdienstaffäre: Dieses Kapitel analysiert den Fall der US-Geheimdienstaffäre, insbesondere das Überwachungsprogramm „Prism“. Es beschreibt den Zugriff der NSA auf Daten großer Internetkonzerne und die Möglichkeiten der Datenanalyse, die es erlaubt, Verbindungen zwischen Personen und deren Aktivitäten über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Die Erhebung der Daten über transatlantische Kabel wird erwähnt. Die ethischen und rechtlichen Implikationen des Programms bleiben, ohne eine vollständige Diskussion der Kontroversen, angedeutet.
Schlüsselwörter
Datenschutz, Datensicherheit, informationelle Selbstbestimmung, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), US-Geheimdienstaffäre, NSA, Prism, Überwachung, Persönlichkeitsrechte, Datenmissbrauch, digitale Vernetzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studienarbeit: Datenschutz und Datensicherheit am Beispiel der US-Geheimdienstaffäre
Was ist der Inhalt dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit befasst sich mit Datenschutz und Datensicherheit, insbesondere am Beispiel der US-Geheimdienstaffäre (NSA-Skandal). Sie definiert die Begriffe, beleuchtet die informationelle Selbstbestimmung als Grundrecht und analysiert die Implikationen des NSA-Überwachungsprogramms „Prism“. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Datenschutz und Datensicherheit, zur Abgrenzung beider Begriffe, zur informationellen Selbstbestimmung, ein Kapitel zum Fallbeispiel der US-Geheimdienstaffäre und ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Wie werden Datenschutz und Datensicherheit abgegrenzt?
Die Arbeit grenzt Datenschutz und Datensicherheit klar voneinander ab. Datenschutz schützt die Person vor Verletzungen des Persönlichkeitsrechts durch Datenmissbrauch, während Datensicherheit den Schutz der Daten selbst vor Verlust, Zerstörung und unberechtigtem Zugriff gewährleistet. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verbindet beide Aspekte. Während Datenschutzverletzungen zu Beeinträchtigungen des Persönlichkeitsrechts führen können, resultieren Datensicherheitsverletzungen in Datenverlust, -zerstörung und -missbrauch.
Was ist informationelle Selbstbestimmung?
Informationelle Selbstbestimmung wird als Grundrecht beschrieben, das jeder Person die Kontrolle über die Preisgabe und Verwendung ihrer personenbezogenen Daten ermöglicht. Es ist ein zentrales Ziel des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die Arbeit thematisiert auch Bedrohungen dieser Selbstbestimmung, wie die Vorratsdatenspeicherung und die Auswertung von Daten zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle.
Welche Rolle spielt die US-Geheimdienstaffäre in der Arbeit?
Die US-Geheimdienstaffäre, insbesondere das Überwachungsprogramm „Prism“, dient als Fallbeispiel. Die Arbeit beschreibt den Zugriff der NSA auf Daten großer Internetkonzerne und die Möglichkeiten der Datenanalyse, die es erlaubt, Verbindungen zwischen Personen und deren Aktivitäten über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Die ethischen und rechtlichen Implikationen werden angesprochen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Datenschutz, Datensicherheit, informationelle Selbstbestimmung, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), US-Geheimdienstaffäre, NSA, Prism, Überwachung, Persönlichkeitsrechte, Datenmissbrauch, digitale Vernetzung.
Welche Ziele verfolgt die Studienarbeit?
Die Studienarbeit zielt darauf ab, Datenschutz und Datensicherheit abzugrenzen, die informationelle Selbstbestimmung zu beleuchten und die Implikationen des NSA-Skandals zu analysieren. Sie betont die Relevanz des Themas im Kontext der zunehmenden Digitalisierung und des Schutzes der Persönlichkeitsrechte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Datenschutz und Datensicherheit, Abgrenzung von Datenschutz und Datensicherheit, Informationelle Selbstbestimmung, Fallbeispiel: US-Geheimdienstaffäre und Fazit. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Datenschutz und Datensicherheit. Fallbeispiel der US-Geheimdienstaffäre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293427