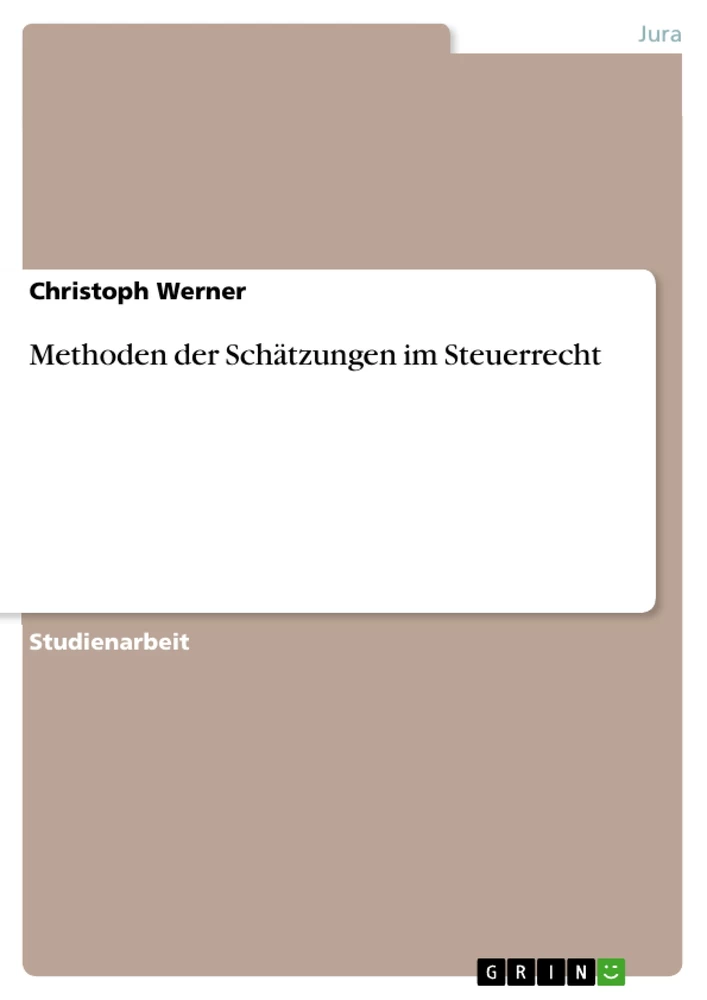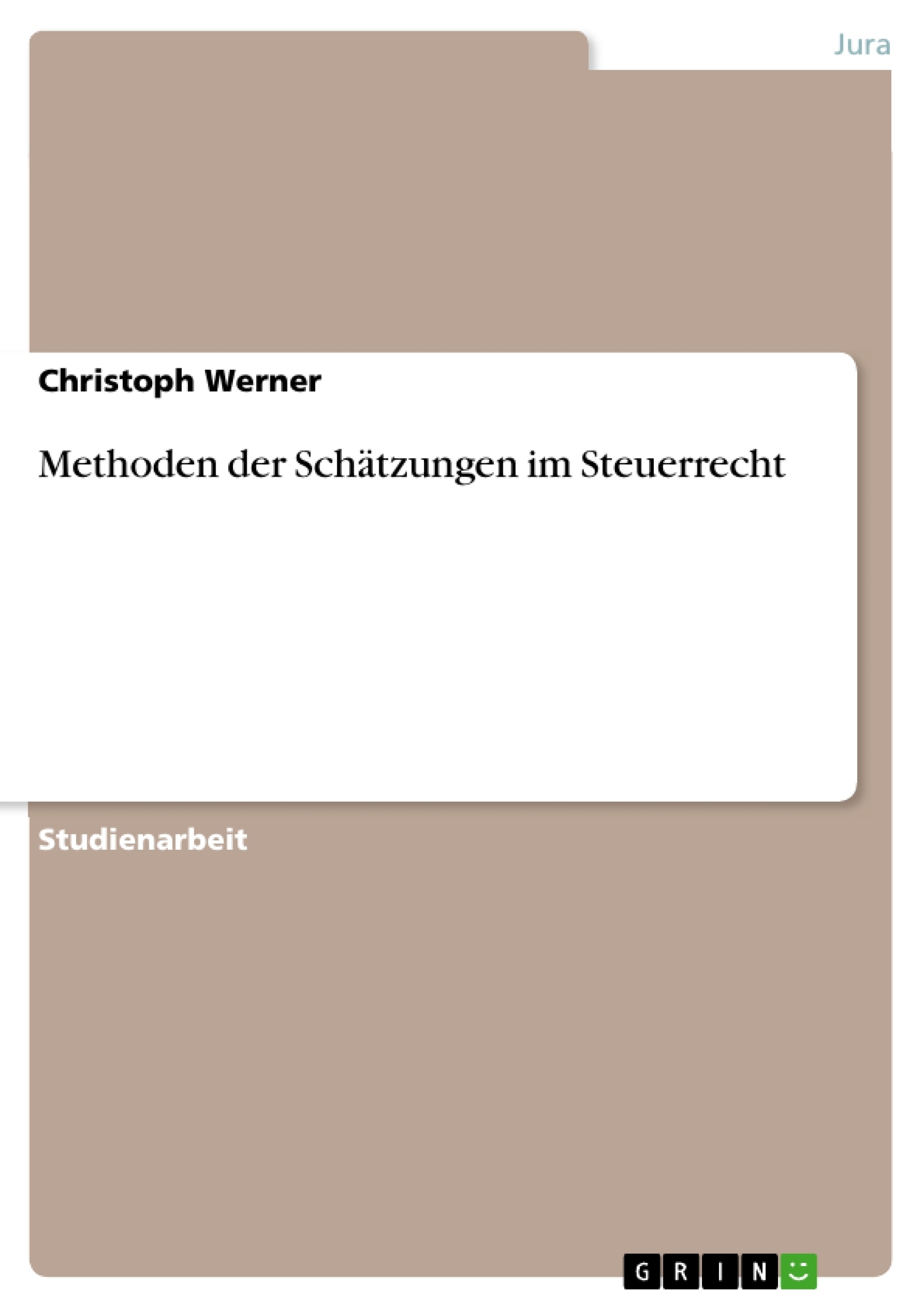Das Finanzamt hat zu schätzen, soweit es die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen kann (§ 162 Abs. 1 Satz 1 AO). Ziel jeder Schätzung ist es, die Be-steuerungsgrundlagen, die die größte Wahrscheinlichkeit für sich haben, zu ermitteln und bei der Steuerfestsetzung zu berücksichtigen.
Um die Steuern gleichmäßig festzusetzen und zu erheben, müssen die Finanzbehörden zunächst den zugrunde liegenden Sachverhalt ermitteln; die Beteiligten, insbesondere die Steuerpflichten, sind dabei zur Mitwirkung verpflichtet. Kann die Finanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen, sind diese zu schätzen.
Die Schätzung soll insgesamt in sich schlüssig, wirtschaftlich vernünftig und möglich sein. Dabei ist aber zu beachten, dass ein Steuerpflichtiger bei schuldhafter Verletzung seiner Mitwirkungspflichten nicht besser gestellt werden darf als derjenige, der seinen Pflichten in vollem Umfang nachkommt. Sind daher die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen, weil der Steuerpflichtige trotz Erinnerung die Pflicht zur Abgabe von Steuererklärungen in grober Weise verletzt, verringert sich die Verpflichtung zur Sachverhaltsaufklärung. Dies führt zu einer Vergrößerung des Schätzungsrahmens, innerhalb dessen die Schätzung vorgenommen werden kann.
Die Schätzung und ihr Ausmaß sind auch davon abhängig, ob und inwieweit der Steuerpflichtige ausreichende Erklärungen für die Abweichung geben kann.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Die Schätzung im Steuerrecht gemäß § 162 AO
- Methodenwahl durch das Finanzamt
- Begriffsklärung
- Die Methoden der Schätzung
- Vorjahresvergleich
- Innerer Betriebsvergleich
- Nachkalkulation
- Zeitreihenvergleich
- Chi-Quadrat-Test
- Benford-Gesetz
- Äußerer Betriebsvergleich
- Richtsatzvergleich
- Einzelbetriebsvergleich
- Einnahmen-Ausgaben Deckungsrechnung
- Geldverkehrsrechnung
- Vermögenszuwachsrechnung
- Kassenfehlbetragsrechnung
- Griffweise Schätzung
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat befasst sich mit den Methoden der Schätzung im Steuerrecht gemäß § 162 AO. Ziel ist es, die verschiedenen Methoden der Schätzung im Steuerrecht zu erläutern und ihre Anwendung in der Praxis zu verdeutlichen.
- Schätzung im Steuerrecht gemäß § 162 AO
- Methodenwahl durch das Finanzamt
- Verprobungsmethoden im Vergleich zu Schätzungsmethoden
- Anwendung verschiedener Schätzungsmethoden in der Praxis
- Schätzung im Rahmen der Steuerfestsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Schätzung im Steuerrecht ein und erläutert die rechtlichen Grundlagen sowie die Zielsetzung der Schätzung. Sie beleuchtet die Bedeutung der Schätzung im Steuerrecht und die Rolle des Finanzamts bei der Auswahl der geeigneten Schätzungsmethode.
Das Kapitel "Die Methoden der Schätzung" stellt verschiedene Schätzungsmethoden vor, die in der Praxis Anwendung finden. Hierzu zählen der Vorjahresvergleich, der innere Betriebsvergleich, der äußere Betriebsvergleich, die Einnahmen-Ausgaben Deckungsrechnung, die Kassenfehlbetragsrechnung und die griffweise Schätzung. Jede Methode wird detailliert beschrieben und ihre Vor- und Nachteile werden aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Schätzung im Steuerrecht, die Abgabenordnung (§ 162 AO), die Methoden der Schätzung, Vorjahresvergleich, innerer Betriebsvergleich, äußerer Betriebsvergleich, Einnahmen-Ausgaben Deckungsrechnung, Kassenfehlbetragsrechnung, griffweise Schätzung, Verprobungsmethoden, Steuerfestsetzung, Finanzamt, Steuerpflichtiger, Besteuerungsgrundlagen, Schätzungsbefugnis, Schätzungsrahmen, Schätzungsunterlagen, Lebenserfahrung.
- Quote paper
- Christoph Werner (Author), 2014, Methoden der Schätzungen im Steuerrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293102