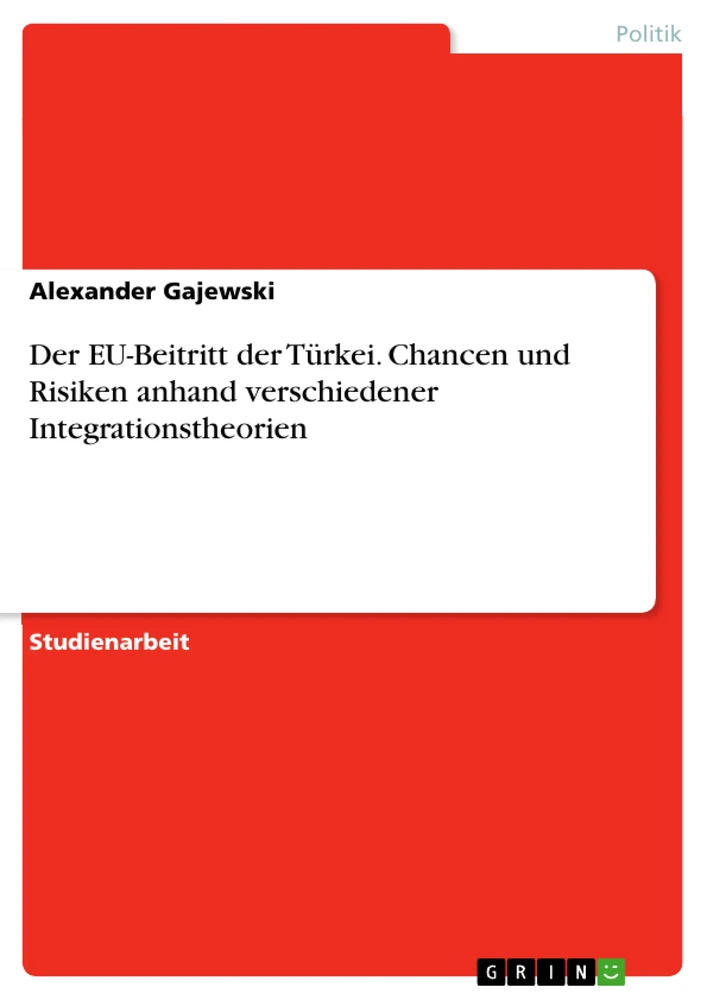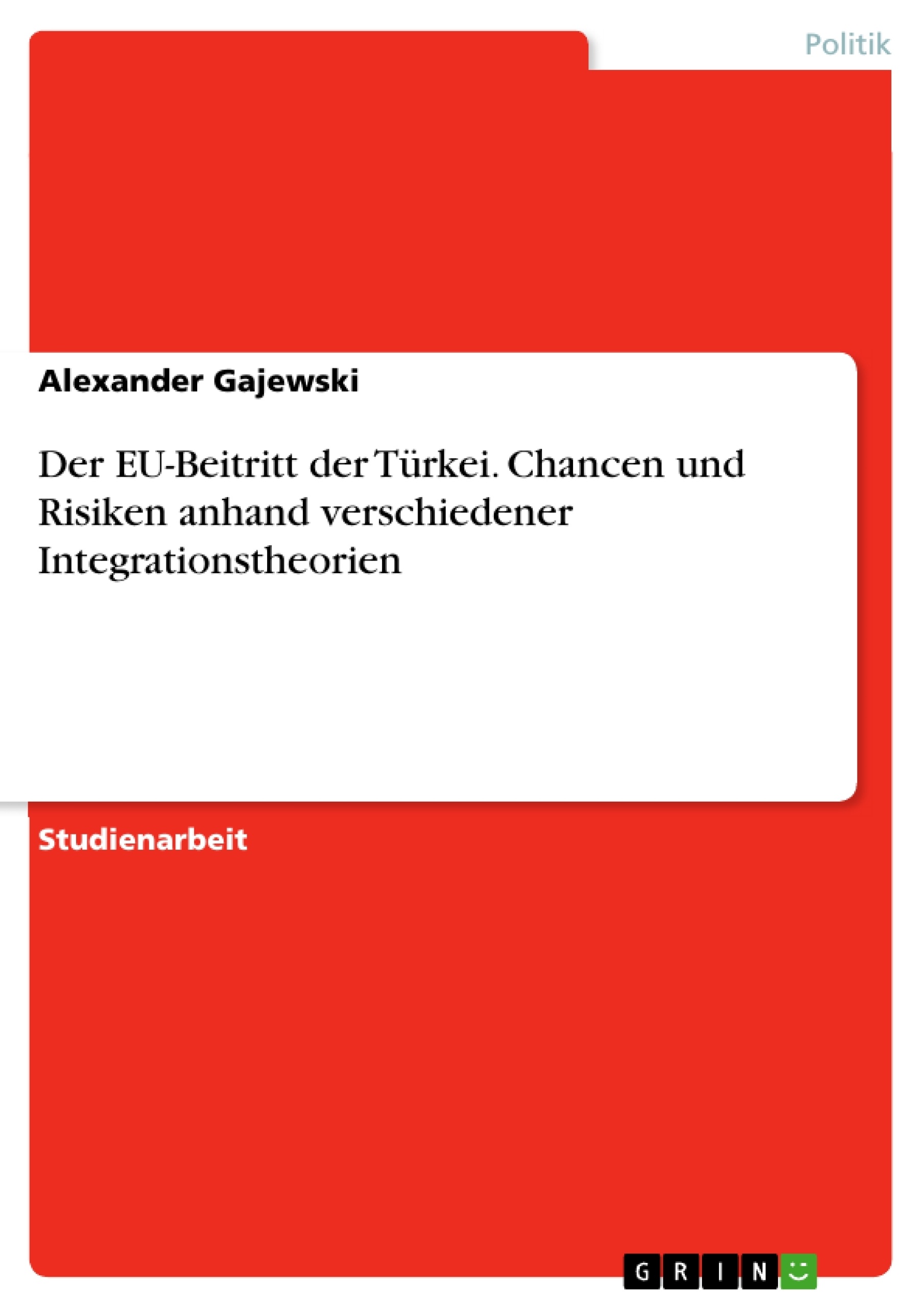Mit dem Satz „Der Türkei-Beitritt zerstört die EU“ hat der deutsche Historiker Hans-Ulrich Wehler maßgeblich dazu beigetragen, dass die Diskussion um den EU-Beitritt der Türkei, die in Europa mehr oder minder seit etlichen Jahren intensiv geführt worden war, eine neue Qualität erhalten hat. Nicht mehr nur temporäre Argumente, wie z. B. die starke Rolle des türkischen Militärs, die Kurdenproblematik, die Konflikte mit Griechenland um Zypern und die Ägäis, die im Gegensatz zur EU verhältnismäßig rückständige Wirtschaft oder generelle Demokratiedefizite der Türkei standen nunmehr im Vordergrund der Diskussion, sondern zunehmend auch grundsätzliche. Sie bezogen sich vor allem auf Unterschiede in Religion, Kultur, geisteshistorischen Traditionen und Geschichte und leiteten daraus eine vermeintliche Unvereinbarkeit europäischer und türkicher Identität her.
Besonders die beiden Historiker Hans-Ulrich Wehler und Heinrich August Winkler argumentieren in diesem Sinne vehement gegen einen EU-Beitritt der Türkei, da diese in ihren Augen nach geographischer Lage, historischer Vergangenheit, Religion, Kultur und Mentalität kein Teil Europas sei.
Ob diese grundsätzlichen Argumente zur Ablehnung eines türkischen EU-Beitritts, der angeblich zum Verlust der europäischen Identität und dem damit einhergehenden Ende des „Projektes Europas“ führen würde , theoretisch und empirisch ausreichend fundiert sind, soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit geklärt werden. Ausgelöst durch die vehemente und grundsätzliche Ablehnung des türkischen EU-Beitritts durch ihre Gegner hat sich aber auch eine Vielzahl von Argumenten für eine Einbeziehung der Türkei in die europäischen Strukturen entwickelt, die u. a. Bezug auf die in den Römischen Verträgen festgeschriebene Formulierung nehmen, dass jeder europäische Staat prinzipiell beitrittsfähig ist. Erst auf dem EU-Gipfel von Kopenhagen 1993 wurden mit den Kopenhagener Kriterien weitere Beitrittsvoraussetzungen formuliert, die für Verfechter der Grundsatzdiskussion jedoch zunächst weniger von Bedeutung sind, da sie lediglich temporäre Faktoren, wie die Entwicklung institutioneller Stabilität als Garantie für eine rechtsstaatliche und demokratische Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie den Schutz von Minderheiten, eine funktionierende Marktwirtschaft, die in der Lage ist, dem Wettbewerbsdruck in der Union standzuhalten und die Fähigkeit, die aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen zu übernehmen und [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 3. Historischer Abriss zu den Entwicklungen des türkischen Beitrittsgesuchs
- 4. Der türkische EU-Beitritt - Die Diskussion
- 4.1 Die Grundsatzdebatte über die prinzipielle Beitrittsfähigkeit der Türkei
- 4.2 Temporäre Argumente zu Chancen und Risiken eines Türkei-Beitritts
- 4.2.1 Innen-, außen- und sicherheitspolitische Argumente
- 4.2.2 Ökonomische und soziale Argumente
- 5. Argumentationsbewertung und Einbeziehung theoretischer Ansätze
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Argumente für und gegen einen türkischen EU-Beitritt. Ziel ist es, die theoretische und empirische Fundiertheit der Argumente zu prüfen und verschiedene Integrationstheorien auf ihre Erklärungsleistung im Kontext der möglichen Erweiterung um die Türkei zu bewerten. Die Arbeit analysiert sowohl grundsätzliche als auch zeitbezogene Argumente.
- Prinzipielle Beitrittsfähigkeit der Türkei
- Analyse temporärer Argumente (wirtschaftlich, sozial, politisch)
- Bewertung der Argumente im Lichte verschiedener Integrationstheorien
- Erklärungswert verschiedener Integrationstheorien
- Mögliche Alternativen zu einem Beitritt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die kontroverse Debatte um einen türkischen EU-Beitritt vor, die durch die Aussage von Hans-Ulrich Wehler ("Der Türkei-Beitritt zerstört die EU") eine neue Qualität erlangte. Die Debatte umfasst sowohl temporäre Argumente (militärische Rolle der Türkei, Kurdenproblematik, Wirtschaftsstand etc.) als auch grundsätzliche Fragen zur Vereinbarkeit europäischer und türkischer Identität. Die Arbeit untersucht, ob die grundsätzlichen Argumente gegen einen Beitritt ausreichend fundiert sind und beleuchtet auch die Argumente für einen Beitritt, die sich unter anderem auf die prinzipielle Beitrittsfähigkeit europäischer Staaten berufen, wie sie in den Römischen Verträgen verankert ist. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die Forschungsfragen.
2. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel stellt verschiedene Integrationstheorien vor, die zur Erklärung horizontaler Integration in der EU herangezogen werden können. Es werden sechs Ansätze – liberaler Intergouvernementalismus, Neofunktionalismus, sozialer Konstruktivismus, Neorealismus, Klubtheorie und Gemeinschaftstheorie – vereinfacht dargestellt. Diese Theorien bilden die Grundlage für die spätere Argumentationsanalyse im Hinblick auf den türkischen EU-Beitritt. Die Hauptaussagen jeder Theorie werden kurz erläutert, um die spätere Analyse zu erleichtern.
3. Historischer Abriss zu den Entwicklungen des türkischen Beitrittsgesuchs: (Leider ist der Text an dieser Stelle unvollständig und es kann keine Zusammenfassung gegeben werden.)
4. Der türkische EU-Beitritt - Die Diskussion: Dieses Kapitel analysiert die Debatte um den türkischen EU-Beitritt, die sowohl grundsätzliche als auch zeitbezogene Argumente umfasst. Die Grundsatzdebatte befasst sich mit der Frage der prinzipiellen Beitrittsfähigkeit der Türkei, wobei die Unterschiede in Religion, Kultur und Geschichte eine zentrale Rolle spielen. Die temporären Argumente bewerten die aktuelle Situation der Türkei und leiten daraus Chancen und Risiken für die EU ab, beispielsweise innen-, außen- und sicherheitspolitische Aspekte sowie ökonomische und soziale Faktoren. Das Kapitel legt beide Argumentationslinien dar.
5. Argumentationsbewertung und Einbeziehung theoretischer Ansätze: (Leider ist der Text an dieser Stelle unvollständig und es kann keine Zusammenfassung gegeben werden.)
Schlüsselwörter
Türkei, EU-Beitritt, Integrationstheorien, liberaler Intergouvernementalismus, Neofunktionalismus, sozialer Konstruktivismus, Neorealismus, Klubtheorie, Gemeinschaftstheorie, Kopenhagener Kriterien, europäische Identität, Demokratiedefizite, wirtschaftliche Entwicklung, Sicherheitspolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Der türkische EU-Beitritt - Eine Argumentationsanalyse"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Argumente für und gegen einen türkischen EU-Beitritt. Sie untersucht die theoretische und empirische Fundiertheit der Argumente und bewertet verschiedene Integrationstheorien hinsichtlich ihrer Erklärungsleistung im Kontext einer möglichen Erweiterung um die Türkei. Die Analyse umfasst sowohl grundsätzliche als auch zeitbezogene Argumente.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der prinzipiellen Beitrittsfähigkeit der Türkei, der Analyse zeitlicher Argumente (wirtschaftlich, sozial, politisch), der Bewertung der Argumente im Licht verschiedener Integrationstheorien, dem Erklärungswert verschiedener Integrationstheorien und möglichen Alternativen zu einem Beitritt.
Welche Integrationstheorien werden vorgestellt und angewendet?
Die Arbeit stellt sechs Integrationstheorien vor: Liberaler Intergouvernementalismus, Neofunktionalismus, Sozialer Konstruktivismus, Neorealismus, Klubtheorie und Gemeinschaftstheorie. Diese Theorien dienen als Grundlage für die Argumentationsanalyse im Hinblick auf den türkischen EU-Beitritt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Theoretischer Rahmen, Historischer Abriss zu den Entwicklungen des türkischen Beitrittsgesuchs, Der türkische EU-Beitritt - Die Diskussion (inkl. Grundsatzdebatte und temporärer Argumente), Argumentationsbewertung und Einbeziehung theoretischer Ansätze, sowie Fazit und Ausblick.
Welche Arten von Argumenten werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl grundsätzliche Argumente zur prinzipiellen Beitrittsfähigkeit der Türkei (z.B. Unterschiede in Religion, Kultur und Geschichte) als auch zeitbezogene Argumente, die die aktuelle Situation der Türkei und daraus resultierende Chancen und Risiken für die EU bewerten (innen-, außen- und sicherheitspolitische Aspekte sowie ökonomische und soziale Faktoren).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die theoretische und empirische Fundiertheit der Argumente für und gegen einen türkischen EU-Beitritt zu prüfen und die Erklärungsleistung verschiedener Integrationstheorien im Kontext der möglichen Erweiterung um die Türkei zu bewerten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Türkei, EU-Beitritt, Integrationstheorien, liberaler Intergouvernementalismus, Neofunktionalismus, sozialer Konstruktivismus, Neorealismus, Klubtheorie, Gemeinschaftstheorie, Kopenhagener Kriterien, europäische Identität, Demokratiedefizite, wirtschaftliche Entwicklung, Sicherheitspolitik.
Gibt es unvollständige Teile in der Arbeit?
Ja, die Zusammenfassungen der Kapitel 3 (Historischer Abriss) und 5 (Argumentationsbewertung) sind unvollständig, da der zugrundeliegende Text an diesen Stellen unvollständig war.
- Quote paper
- M. A. Alexander Gajewski (Author), 2012, Der EU-Beitritt der Türkei. Chancen und Risiken anhand verschiedener Integrationstheorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292935