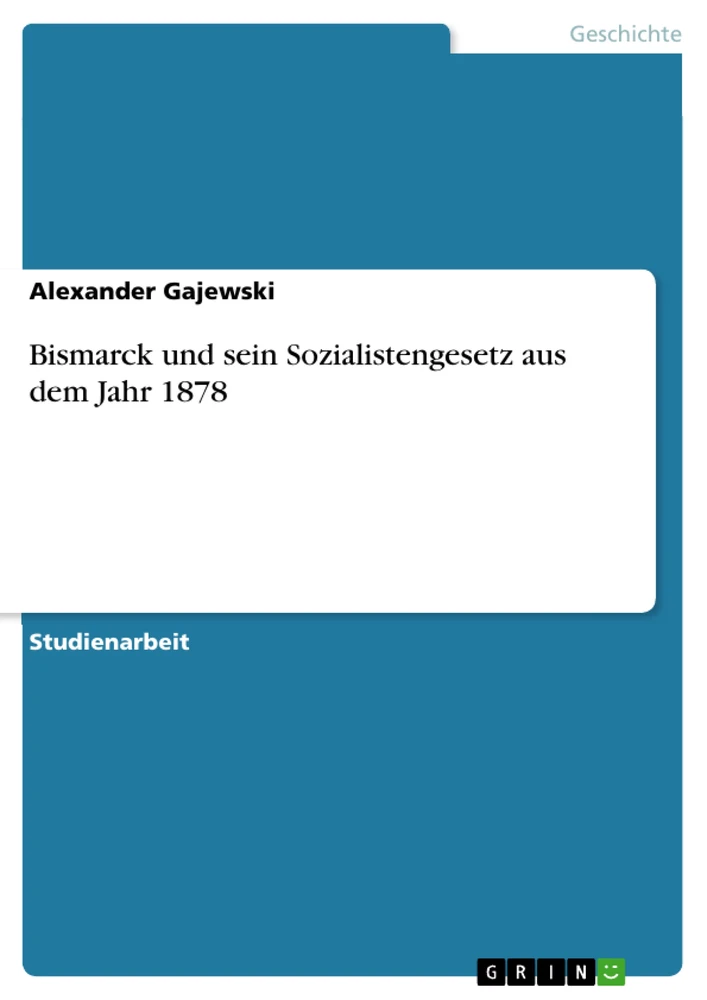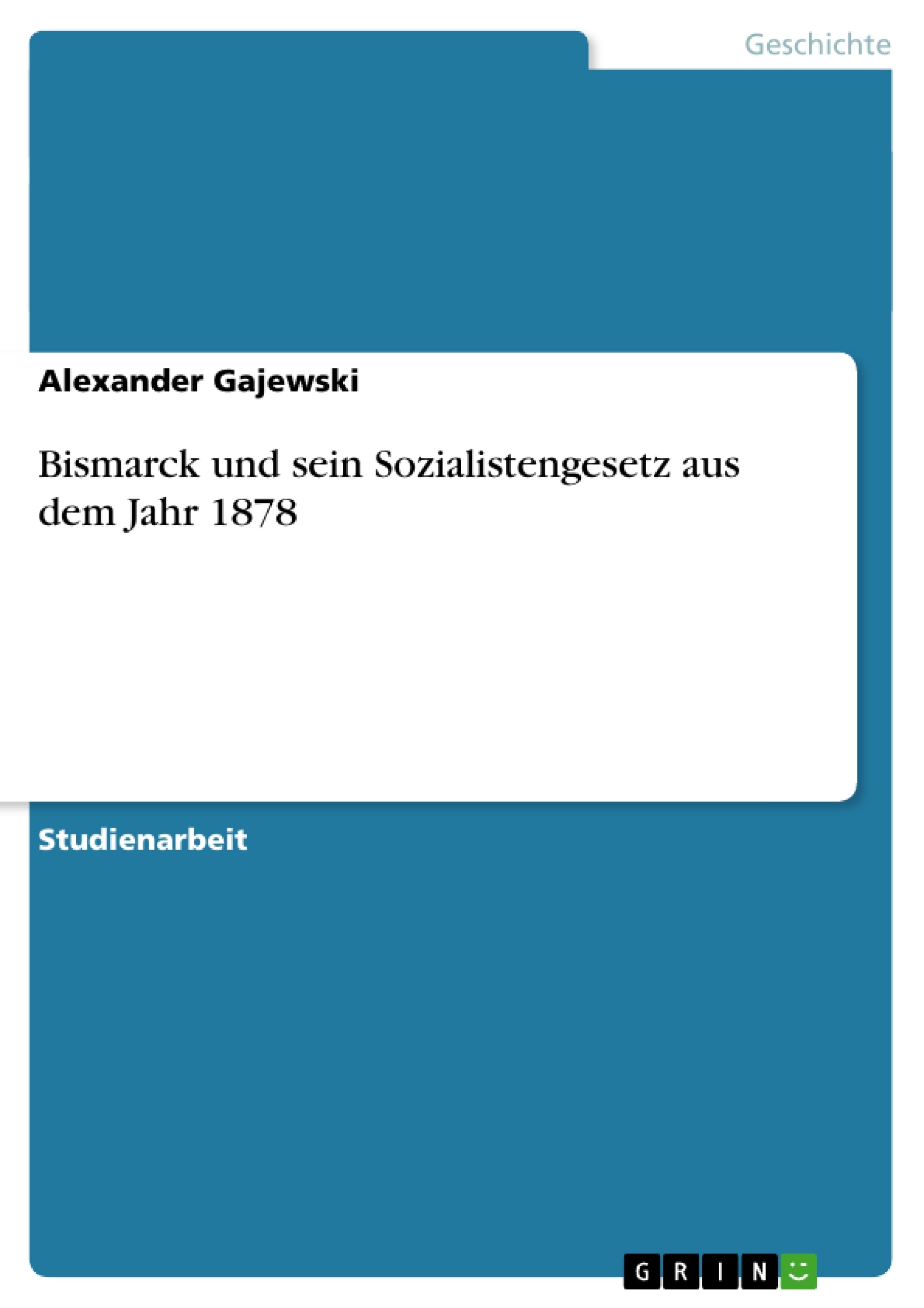Das „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ aus dem Jahr 1878 stellte für das Deutsche Kaiserreich eine innenpolitische Zäsur dar, die, obwohl sie auf die Schwächung der deutschen Sozialdemokratie gerichtet war, den Erfolg der Partei nicht aufhalten konnte und maßgeblich zur weiteren Verschärfung innergesellschaftlicher Unzufriedenheit beigetragen hat, die letztendlich auch zum großen Teil in der Wirtschaftskrise der 70er und 80er Jahre begründet lag.
Ähnlich wie zuvor beim Kulturkampf gegen die katholische Zentrumspartei führte Bismarck auch hier einen Vernichtungskrieg gegen die Sozialdemokratie, die wie das Zentrum als Reichsfeinde denunziert, möglichst schnell als aufstrebende politische Größe zerstört werden sollte. Dabei schreckte er nicht davor zurück eine ganze Klasse unter die Regelungen eines Ausnahmegesetzes zu stellen.
Interessant in diesem Zusammenhang sind die Motive Bismarcks, die ihn dazu getrieben haben die Sozialdemokratie so vehement und konsequent durch seine Doppelstrategie, bestehend aus Repressionen und Verboten einerseits und Sozialgesetzgebung zur Verbesserung der Situation der Arbeiter andererseits, zu bekämpfen.
Repressionen und Verbote sollten eine legale Arbeit der Partei wesentlich behindern und sie politisch zerschlagen und unschädlich machen, wohingegen die Sozialgesetzgebung das Ziel verfolgte, die Arbeiter an den Obrigkeitsstaat zu binden und diesen durch eine verbesserte existenzielle Lage ihr Interesse an der Sozialdemokratie zu entziehen und somit die Möglichkeit der Entstehung einer neuen revolutionären Partei zu verhindern.
Bismarck hat die Sozialdemokraten nie als eine politische Partei anerkannt, der es auch um die tatsächliche Verbesserung der Situation der Arbeiter ging. Für ihn verfolgten die Sozialdemokraten, obwohl er sich mit den sozialistischen Ideen nur wenig auskannte, ausnahmslos negativ-destruktive und gesellschaftsvernichtende Ziele.
Die Ideen, denen er zustrebte, ließen sich seiner Auffassung nach mit den Zielen der Sozialdemokraten nicht vereinen und somit musste er versuchen, diese konsequenteste Opposition mit aller Härte der ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu zerschlagen.
Die Haltung Bismarcks zur Sozialdemokratie, in die hier bereits kurz eingeleitet wurde, wird in Kapitel 2 noch ausführlicher und gründlicher behandelt [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bismarcks Haltung zur Sozialdemokratie
- Der Weg zum Sozialistengesetz
- Hödels Attentat und der erste Gesetzesentwurf
- Nobilings Attentat
- Der Eindruck auf Presse und öffentliche Meinung
- Auflösung des Reichstags und Neuwahlen
- Die Annahme des zweiten Gesetzesentwurfs
- Folgen für die Sozialdemokratie
- Ergebnis und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung des Sozialistengesetzes von 1878 im Deutschen Kaiserreich und Bismarcks Rolle dabei. Sie analysiert die Motive hinter Bismarcks Kampf gegen die Sozialdemokratie und beleuchtet den historischen Kontext, insbesondere die Anschläge auf Kaiser Wilhelm I.
- Bismarcks politische Ideologie und seine Ablehnung der Sozialdemokratie
- Die Anschläge auf Kaiser Wilhelm I. und deren Einfluss auf die Gesetzgebung
- Der legislative Prozess und die politischen Reaktionen auf das geplante Gesetz
- Die repressiven Maßnahmen des Sozialistengesetzes und ihre Auswirkungen
- Bismarcks Doppelstrategie: Repression und Sozialgesetzgebung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das Sozialistengesetz von 1878 als innenpolitische Zäsur im Deutschen Kaiserreich. Sie hebt hervor, dass Bismarcks Versuch, die Sozialdemokratie zu schwächen, letztendlich ihr Wachstum nicht aufhalten konnte und zu innergesellschaftlicher Unzufriedenheit beitrug, auch aufgrund der Wirtschaftskrise der 1870er und 1880er Jahre. Der Fokus liegt auf Bismarcks Motiven und seiner Doppelstrategie von Repression und Sozialgesetzgebung, um die Arbeiter an den Staat zu binden und die Sozialdemokratie zu untergraben. Bismarck wird dargestellt als Gegner der Sozialdemokratie, deren Ziele er als negativ-destruktiv und gesellschaftsvernichtend einstufte. Die Arbeit kündigt eine detailliertere Behandlung von Bismarcks Haltung (Kapitel 2) und der historischen Entwicklung bis zur Verabschiedung des Gesetzes an.
2. Bismarcks Haltung zur Sozialdemokratie: Dieses Kapitel analysiert Bismarcks tiefgreifende Ablehnung der Sozialdemokratie. Seine monarchistische Überzeugung und seine Furcht vor einer revolutionären Arbeiterbewegung werden als zentrale Motive dargestellt. Bismarcks Staatsauffassung, die von einer adligen Herrschaft ausgeht, steht im Widerspruch zu den sozialdemokratischen Zielen. Seine Skepsis gegenüber den Sozialisten wird durch eine Reichstagsrede von 1878 illustriert, in der er den revolutionären Charakter der Bewegung hervorhebt und deren Ziele als mit seinen eigenen unvereinbar betrachtet. Das Kapitel unterstreicht, wie Bismarcks persönliche Ideologie seine harte Gangart gegen die Sozialdemokratie beeinflusste.
Schlüsselwörter
Sozialistengesetz, Bismarck, Sozialdemokratie, Kaiserreich, Repression, Sozialgesetzgebung, Anschläge auf Kaiser Wilhelm I., Revolutionsfurcht, Arbeiterbewegung, politische Ideologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Sozialistengesetz von 1878
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung des Sozialistengesetzes von 1878 im Deutschen Kaiserreich und die Rolle Otto von Bismarcks dabei. Sie analysiert Bismarcks Motive im Kampf gegen die Sozialdemokratie und beleuchtet den historischen Kontext, insbesondere die Attentate auf Kaiser Wilhelm I.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Bismarcks politische Ideologie und seine Ablehnung der Sozialdemokratie, die Anschläge auf Kaiser Wilhelm I. und deren Einfluss auf die Gesetzgebung, den legislativen Prozess und die politischen Reaktionen auf das geplante Gesetz, die repressiven Maßnahmen des Sozialistengesetzes und deren Auswirkungen sowie Bismarcks Doppelstrategie von Repression und Sozialgesetzgebung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Bismarcks Haltung zur Sozialdemokratie, ein Kapitel zum Weg zum Sozialistengesetz (inkl. der Attentate und der Reaktionen), ein Kapitel zu den Folgen für die Sozialdemokratie und abschließend ein Kapitel mit Ergebnissen und Ausblick. Zusätzlich werden die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter bereitgestellt.
Welche Rolle spielte Bismarck bei der Entstehung des Sozialistengesetzes?
Bismarck spielte eine zentrale Rolle. Seine monarchistische Überzeugung, seine Furcht vor einer revolutionären Arbeiterbewegung und seine tiefgreifende Ablehnung der sozialdemokratischen Ziele waren die treibenden Kräfte hinter seinem Kampf gegen die Sozialdemokratie. Seine persönliche Ideologie beeinflusste maßgeblich seine harte Gangart.
Welche Ereignisse führten zur Verabschiedung des Gesetzes?
Die Attentate von Hödel und Nobiling auf Kaiser Wilhelm I. hatten einen entscheidenden Einfluss auf die Verabschiedung des Gesetzes. Diese Anschläge verstärkten die öffentliche Meinung und den politischen Druck auf Bismarck, gegen die Sozialdemokratie vorzugehen. Der legislative Prozess umfasste verschiedene Entwürfe und Reaktionen im Reichstag.
Welche Folgen hatte das Sozialistengesetz für die Sozialdemokratie?
Die Arbeit untersucht die repressiven Maßnahmen des Gesetzes und deren Auswirkungen auf die Sozialdemokratie. Obwohl Bismarck versuchte, die Sozialdemokratie zu schwächen, wird angedeutet, dass dies letztendlich nicht gelang und sogar zu innergesellschaftlicher Unzufriedenheit beitrug. Die genauen Folgen werden im entsprechenden Kapitel detailliert behandelt.
Welche Strategie verfolgte Bismarck?
Bismarck verfolgte eine Doppelstrategie: Repression durch das Sozialistengesetz und gleichzeitig Sozialgesetzgebung, um die Arbeiter an den Staat zu binden und die Sozialdemokratie zu untergraben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Sozialistengesetz, Bismarck, Sozialdemokratie, Kaiserreich, Repression, Sozialgesetzgebung, Anschläge auf Kaiser Wilhelm I., Revolutionsfurcht, Arbeiterbewegung, politische Ideologie.
- Quote paper
- M. A. Alexander Gajewski (Author), 2009, Bismarck und sein Sozialistengesetz aus dem Jahr 1878, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292921