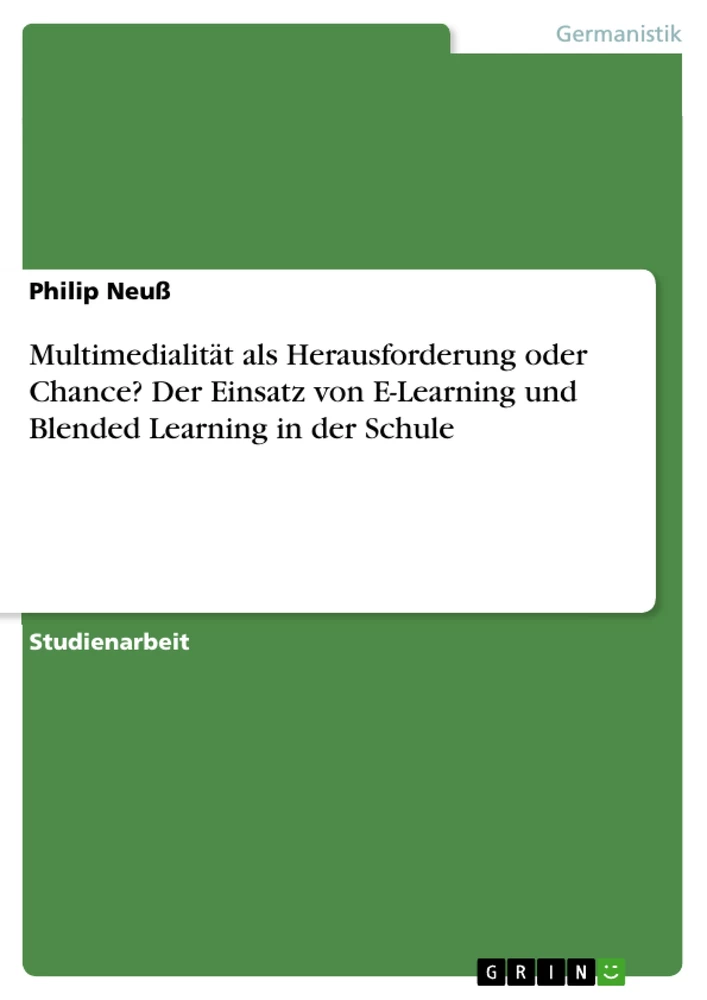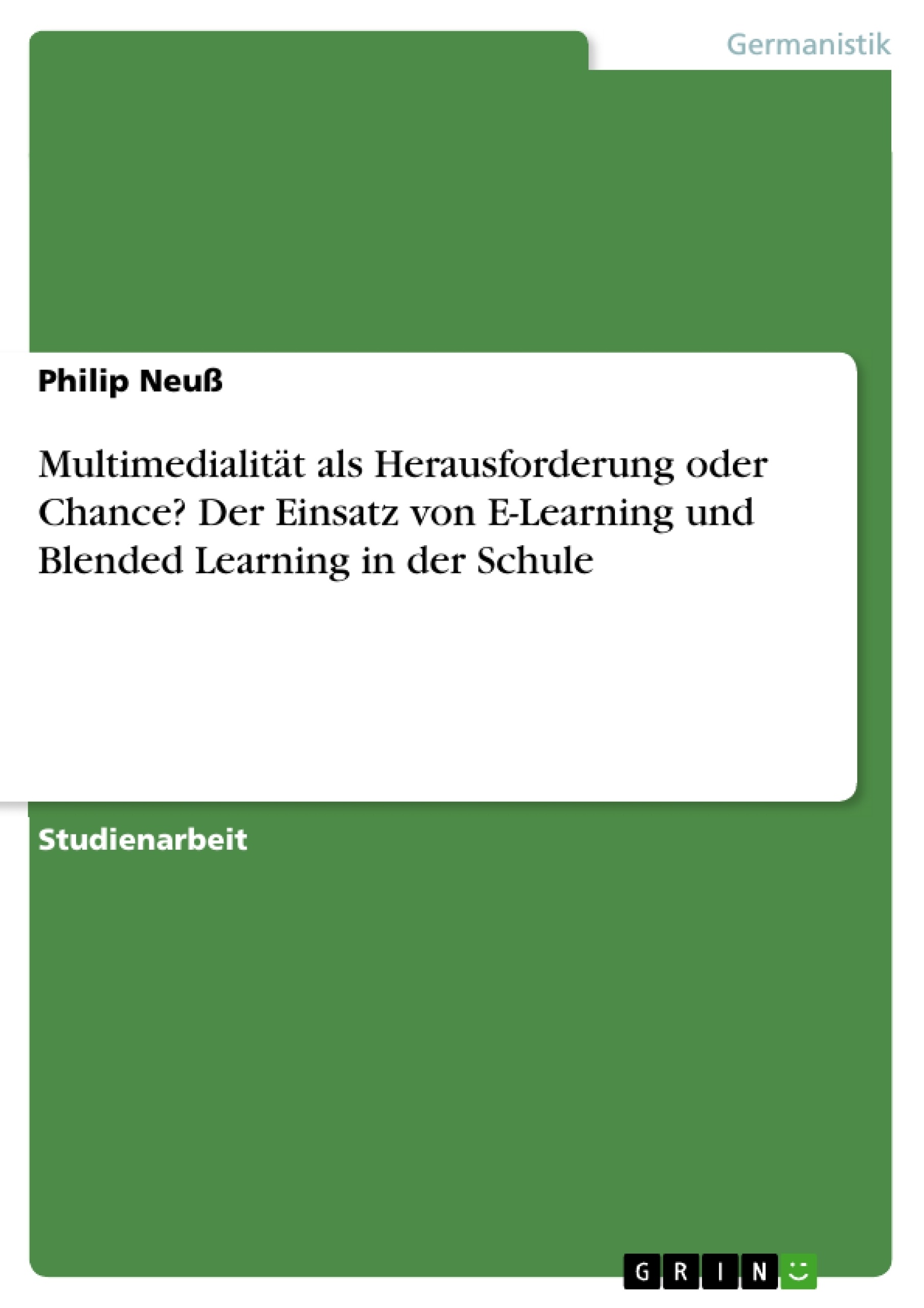Kaum etwas stellt den Lehrberuf und die berufliche Weiterbildung wohl vor eine so große Herausforderung wie die rasante Medienentwicklung der letzten zwanzig Jahre.
Durch die allgegenwärtige Möglichkeit Informationen aus dem Internet abzurufen bieten sich Lernenden neue Möglichkeiten auch außerhalb der klassischen Bildungseinrichtungen über informelle Lernprozesse Kompetenzen und Wissen zu erlangen. Schulen und Hochschulen verlieren somit in der Epoche der Postmedialität ihr Bildungsmonopol, da der Zugang zu Informationen prinzipiell für jeden zu jeder Zeit möglich ist.
Zudem bedingen größer werdende Brüche im Arbeitsumfeld und die technische Entwicklung, die stetig neue Anforderungen generiert, in der Notwendigkeit des lebenslangen Lernens und der Unterstützung durch Fachkräfte.
Die institutionellen Bildungseinrichtungen stehen somit vor der Herausforderung ihre Aufgabe neu zu definieren und Handlungswissen für die potentielle Flut an Informationen zu bieten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. E-Learning- Herausforderung für klassische Bildungsinstitutionen?
- 2. E-Learning: Mehr als die Nutzung des Computers
- 2.1 Versuch einer Definition
- 2.2 Blended Learning und E-Learning- Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- 2.3 E-Learning und Blended Learning- Ungeeignet für den Schulunterricht?
- 3. Kompetenzvermittlung- Neue Ziele im Unterricht
- 3.1 Ziele der Vermittlung von Medienkompetenz
- 3.2 Medienpädagogische Kompetenz als Voraussetzung
- 4. E-Learning in der Schule
- 4.1 Bisheriger Einsatz- Nachteile, Probleme und Erfolgsfaktoren
- 4.2 Vorteile von E-Learning und Blended Learning
- 4.3 Einsatzmöglichkeiten für E-Learning
- 5. Ausblick: E-Learning als Herausforderung und Chance?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Einsatz von E-Learning und Blended Learning im schulischen Kontext. Ziel ist es, die Chancen und Herausforderungen dieser multimedialen Lernformen zu analysieren und deren Potenzial für die Kompetenzvermittlung im Unterricht zu bewerten. Die Arbeit beleuchtet dabei sowohl die bisherigen Erfahrungen mit E-Learning in der Schule als auch die Notwendigkeit einer Neuausrichtung des Bildungswesens angesichts der rasanten Medienentwicklung.
- Herausforderungen von E-Learning für klassische Bildungsinstitutionen
- Definition und Abgrenzung von E-Learning und Blended Learning
- Kompetenzvermittlung und Medienpädagogik im Kontext von E-Learning
- Vorteile und Nachteile des E-Learning-Einsatzes in der Schule
- Potenzielle Einsatzmöglichkeiten von E-Learning im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. E-Learning- Herausforderung für klassische Bildungsinstitutionen?: Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, vor denen klassische Bildungsinstitutionen durch die rasante Medienentwicklung und den einfachen Zugang zu Informationen im Internet stehen. Es thematisiert den Verlust des Bildungsmonopols und die Notwendigkeit, die Rolle von Schulen und Hochschulen im Kontext des lebenslangen Lernens neu zu definieren. Die anfänglichen Hoffnungen auf Automatisierung und Effektivitätssteigerung von Lernprozessen durch den bloßen Einsatz von Computern werden kritisch hinterfragt, und der bisherige begrenzte Erfolg von E-Learning in der deutschen Bildungslandschaft wird analysiert. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, das Potenzial des Internets im Unterricht effektiv einzusetzen und sich den Herausforderungen der Multimedialität zu stellen.
2. E-Learning: Mehr als die Nutzung des Computers: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von E-Learning und seiner Abgrenzung zu anderen Lernformen. Es wird die Schwierigkeit einer präzisen Definition herausgestellt, da der Begriff oft als Sammelbegriff für verschiedene computergestützte Lernanwendungen verwendet wird. Die historische Entwicklung des Begriffs wird nachgezeichnet, und verschiedene Definitionsansätze werden vorgestellt und diskutiert. Ein zentraler Aspekt ist die Rolle des Internets als Voraussetzung für E-Learning und die Bedeutung der Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden. Das Kapitel verdeutlicht die Komplexität des Begriffs und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung.
Schlüsselwörter
E-Learning, Blended Learning, Multimedialität, Kompetenzvermittlung, Medienpädagogik, Online-Lernen, Bildungsinstitutionen, didaktische Konzepte, lebenslanges Lernen, Bologna-Reform, Internet.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: E-Learning - Herausforderung und Chance?
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einsatz von E-Learning und Blended Learning im schulischen Kontext. Sie analysiert die Chancen und Herausforderungen dieser multimedialen Lernformen und bewertet deren Potenzial für die Kompetenzvermittlung im Unterricht. Dabei werden sowohl bisherige Erfahrungen als auch die Notwendigkeit einer Neuausrichtung des Bildungswesens angesichts der rasanten Medienentwicklung beleuchtet.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Herausforderungen von E-Learning für klassische Bildungsinstitutionen; Definition und Abgrenzung von E-Learning und Blended Learning; Kompetenzvermittlung und Medienpädagogik im Kontext von E-Learning; Vorteile und Nachteile des E-Learning-Einsatzes in der Schule; Potenzielle Einsatzmöglichkeiten von E-Learning im Unterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 beleuchtet die Herausforderungen für klassische Bildungsinstitutionen durch E-Learning. Kapitel 2 definiert E-Learning und Blended Learning und grenzt diese voneinander ab. Kapitel 3 befasst sich mit Kompetenzvermittlung und Medienpädagogik. Kapitel 4 analysiert den bisherigen und zukünftigen Einsatz von E-Learning in der Schule. Kapitel 5 bietet einen Ausblick auf E-Learning als Herausforderung und Chance.
Was sind die zentralen Ergebnisse des Kapitels über die Herausforderungen für klassische Bildungsinstitutionen?
Kapitel 1 thematisiert den Verlust des Bildungsmonopols klassischer Institutionen durch den einfachen Zugang zu Informationen im Internet. Es betont die Notwendigkeit, die Rolle von Schulen und Hochschulen im Kontext des lebenslangen Lernens neu zu definieren und das Potenzial des Internets im Unterricht effektiv einzusetzen. Kritisch hinterfragt wird der bisherige begrenzte Erfolg von E-Learning in Deutschland.
Wie wird E-Learning in dieser Arbeit definiert?
Kapitel 2 hebt die Schwierigkeit einer präzisen Definition von E-Learning hervor, da der Begriff oft als Sammelbegriff verwendet wird. Es werden verschiedene Definitionsansätze vorgestellt und diskutiert, wobei die Rolle des Internets und die Bedeutung der Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden betont werden. Die Komplexität des Begriffs und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung werden verdeutlicht.
Welche Rolle spielt die Medienpädagogik?
Die Arbeit betont die Bedeutung von Medienpädagogik und Medienkompetenz im Kontext von E-Learning. Die Vermittlung von Medienkompetenz wird als zentrales Ziel im Unterricht angesehen, und medienpädagogische Kompetenz wird als Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von E-Learning gesehen (Kapitel 3).
Welche Vorteile und Nachteile von E-Learning werden diskutiert?
Kapitel 4 analysiert die bisherigen Erfahrungen mit E-Learning in der Schule, beleuchtet Nachteile, Probleme und Erfolgsfaktoren, sowie die Vorteile von E-Learning und Blended Learning und deren Einsatzmöglichkeiten im Unterricht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: E-Learning, Blended Learning, Multimedialität, Kompetenzvermittlung, Medienpädagogik, Online-Lernen, Bildungsinstitutionen, didaktische Konzepte, lebenslanges Lernen, Bologna-Reform, Internet.
- Citar trabajo
- Philip Neuß (Autor), 2013, Multimedialität als Herausforderung oder Chance? Der Einsatz von E-Learning und Blended Learning in der Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292871