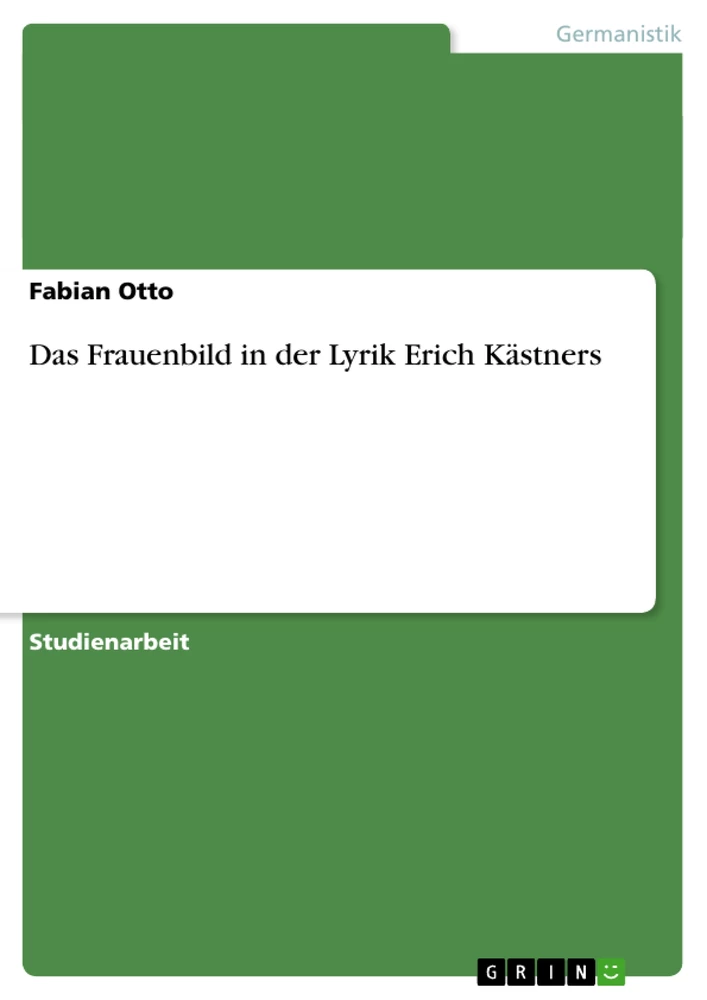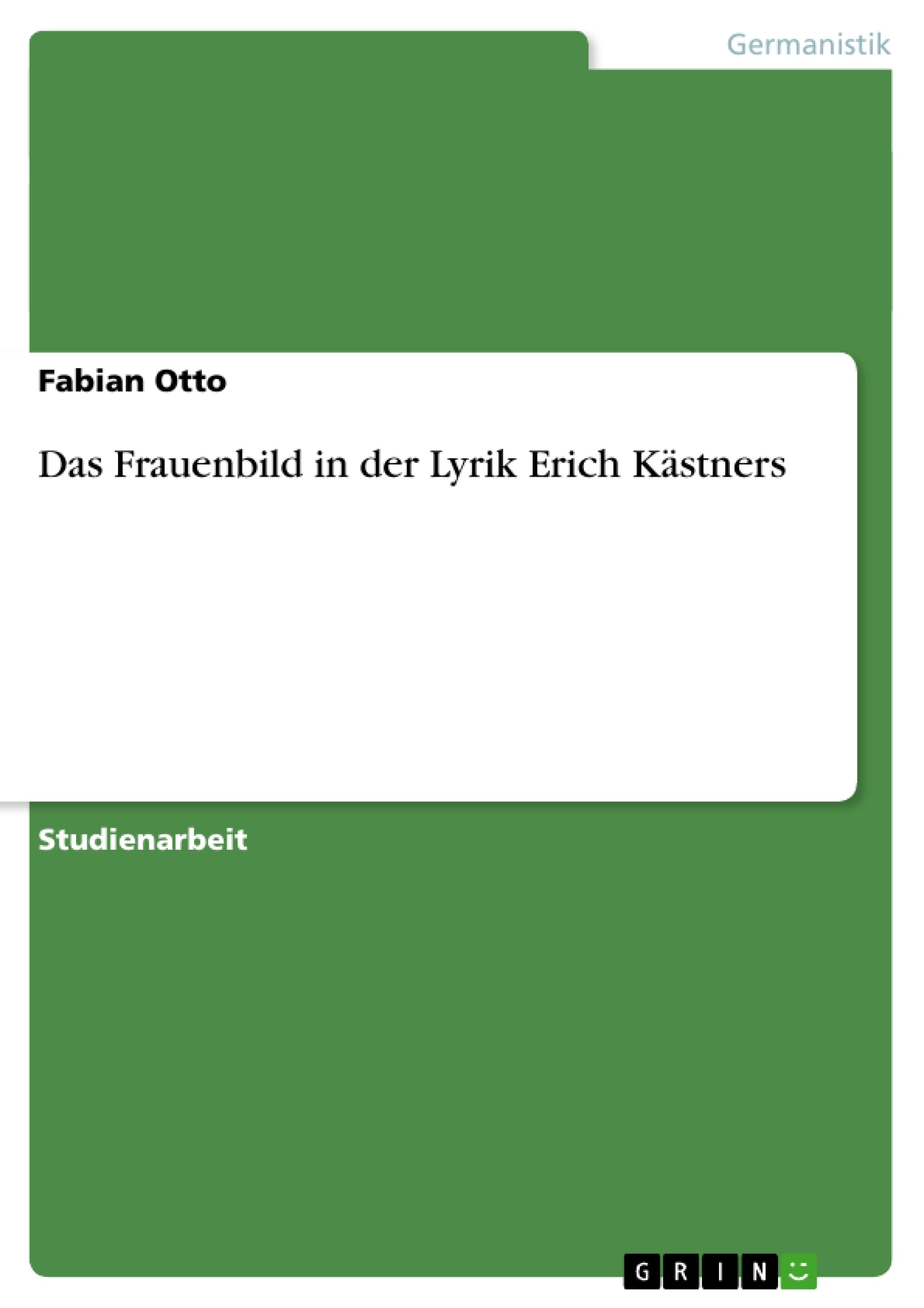Der Journalist und Schriftsteller Erich Kästner, der heute noch vor allem als Kinderbuchautor bekannt ist, hatte sich Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts besonders wegen seiner umfangreichen Gedichtproduktion einen Namen gemacht. Bis zum Beginn der NS-Diktatur 1933 erschienen vier Gedichtbände: Herz auf Taille (1928), Lärm im Spiegel (1929), Ein Mann gibt Auskunft (1930) und Gesang zwischen den Stühlen (1932). 1 Auffällig an diesen Gedichten aus der Epoche der Neuen Sachlichkeit ist die überdurchschnittlich häufige Auseinandersetzung mit Frauen als solchen, die hier immer wieder mit bestimmten - oft negativen - Charaktereigenschaften, Verhaltensmustern, etc. versehen werden. Tatsächlich wurde das von Kästner in seinen Werken vermittelte Frauenbild vielfach angegriffen - und zumeist auf seine Biographie zurückgeführt. 2 Ein Internetartikel, der zu Kästners hundertstem Geburtstag erschienen ist, spricht von dessen Verhältnis zu Frauen: „Keine entsprach letztlich seinen Vorstellungen, und aus vielen seiner Verse spricht tatsächlich eine empörende Geringschätzung des weiblichen Geschlechts.“ 3 Hermann Kesten schreibt Kästners Werk einen immer wieder auftauchenden „gewissen koketten Antifeminismus“ 4 zu, ohne diesen aber näher zu erläutern. Man scheint mit einiger Berechtigung fragen zu dürfen, ob Kästner in seinen Gedichten das weibliche Geschlecht differenziert realistisch - und gemäß der Gesinnung der Neuen Sachlichkeit - sachlich darstellt, oder ob hauptsächlich persönliche Vorurteile widergespiegelt werden. Klaus Kordon stellt außerdem fest, daß Kästner zumindest in seinen Kinderbüchern an seine weiblichen Hauptfiguren keine hohen Anforderungen stellt. 5 Läßt sich etwas Ähnliches auch für die Lyrik feststellen?
In seiner Prosaischen Zwischenbemerkung, enthalten im Gedichtband Lärm im Spiegel, fordert Kästner, ein lebendiges Gedicht müsse nützlich, „seelisch verwendbar“ sein, derart, daß es den Leser innerlich bewege, weil der Dichter es „im Umgang mit den Freuden und Schmerzen der Gegenwart“ 6 geschrieben habe; weil diese Dichter „wie natürliche Menschen empfinden und die Empfindungen (und Ansichten und Wünsche) in Stellvertretung ausdrücken“.
Ziel dieser Arbeit ist es, eine Antwort darauf zu versuchen, inwieweit das Frauenbild, das Kästner in seinen Gedichten zeichnet, zu vereinbaren ist mit seinen selbstformulierten Ansprüchen an gute Lyrik.
Inhaltsverzeichnis
- I. (Einleitung)
- II. Mütter
- Mehr oder weniger Gesellschaftskritik
- Die Frau als das andere Geschlecht
- III. (Resümee)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Frauenbild in der Lyrik Erich Kästners, insbesondere im Kontext seiner eigenen Ansprüche an gute Lyrik, wie er sie in seiner „Prosaischen Zwischenbemerkung“ formuliert. Ziel ist es, zu analysieren, ob Kästners Darstellung von Frauen mit seinen eigenen Kriterien für gelungene Lyrik vereinbar ist und ob seine Gedichte Frauen und Männer gleichberechtigt behandeln oder eine Geringschätzung des weiblichen Geschlechts erkennen lassen. Die Analyse fokussiert sich auf die Gedichte selbst, wobei biographische Aspekte weitgehend außen vor bleiben.
- Das Frauenbild in Erich Kästners Lyrik
- Kästners Kriterien für gute Lyrik und deren Übereinstimmung mit seiner Darstellung von Frauen
- Die Rolle der Mutterfigur in Kästners Gedichten
- Differenzierte Betrachtung der weiblichen Charaktere in Kästners Werk
- Analyse der stilistischen Mittel und ihrer Wirkung auf die Darstellung des Frauenbildes
Zusammenfassung der Kapitel
I. (Einleitung): Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Vereinbarkeit des in Kästners Gedichten präsentierten Frauenbildes mit seinen eigenen Ansprüchen an gute Lyrik. Sie skizziert den Kontext der Neuen Sachlichkeit, in dem Kästners Gedichte entstanden sind, und erwähnt die kontroversen Reaktionen auf sein Frauenbild. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, anhand von Beispielen aus Kästners Lyrik zu untersuchen, ob eine differenzierte und sachliche Darstellung des weiblichen Geschlechts vorliegt oder ob vorwiegend persönliche Vorurteile zum Ausdruck kommen. Der Fokus liegt dabei auf den Gedichten selbst, wobei biographische Aspekte bewusst im Hintergrund bleiben.
II. Mütter: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Mütterfiguren in Kästners Lyrik. Es wird herausgestellt, dass Mütter – oft Mütter von Söhnen – häufig vorkommen und meist positive Eigenschaften wie Selbstständigkeit und Opferbereitschaft zugeschrieben bekommen. Jedoch übersteigt diese Fürsorge oft ein normales Maß, was als Indiz für eine gewisse Naivität oder Abhängigkeit interpretiert wird. Anhand von Beispielen wie "Frau Großhennig schreibt ihrem Sohn" und "Junggesellen sind auf Reisen" wird gezeigt, wie Kästner diese Mutterfiguren charakterisiert und welche impliziten Botschaften in diesen Darstellungen stecken. Das Gedicht "Stiller Besuch" wird als Ausnahme vorgestellt, in dem eine bedingungslose Liebe zur Mutter dargestellt wird. Die Analyse zeigt sowohl positive als auch ambivalentere Aspekte der Darstellung von Müttern in Kästners Werk.
Schlüsselwörter
Erich Kästner, Lyrik, Frauenbild, Neue Sachlichkeit, Mutterfigur, Gedichtanalyse, Geschlechterrollen, Vorurteile, Lyriktheorie, Sachlichkeit, Emotionen.
Erich Kästner: Frauenbild in der Lyrik - FAQ
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Frauenbild in der Lyrik Erich Kästners. Der Fokus liegt darauf, ob Kästners Darstellung von Frauen mit seinen eigenen Kriterien für gute Lyrik übereinstimmt und ob seine Gedichte Frauen und Männer gleichberechtigt behandeln oder eine Geringschätzung des weiblichen Geschlechts erkennen lassen. Biografische Aspekte bleiben dabei weitgehend außen vor.
Welche Aspekte der Lyrik Erich Kästners werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf die Gedichte selbst und untersucht das Frauenbild anhand konkreter Beispiele. Besondere Aufmerksamkeit wird der Darstellung von Müttern gewidmet, sowie der Analyse stilistischer Mittel und deren Wirkung auf die Darstellung des Frauenbildes. Die Arbeit bezieht sich auch auf Kästners eigene Ansichten über gute Lyrik, wie sie in seiner „Prosaischen Zwischenbemerkung“ formuliert sind.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung (Kapitel I), ein Hauptkapitel zu Müttern (Kapitel II) und ein Resümee (Kapitel III). Kapitel I führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel II analysiert die Darstellung von Mütterfiguren in Kästners Gedichten, wobei sowohl positive als auch ambivalente Aspekte beleuchtet werden. Kapitel III fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie werden Mütter in Kästners Lyrik dargestellt?
Mütterfiguren, oft Mütter von Söhnen, werden in Kästners Lyrik häufig dargestellt und oft mit positiven Eigenschaften wie Selbstständigkeit und Opferbereitschaft verbunden. Allerdings wird diese Fürsorge manchmal als übertrieben dargestellt, was als Hinweis auf Naivität oder Abhängigkeit interpretiert wird. Die Analyse untersucht verschiedene Gedichte, um diese Aspekte zu veranschaulichen.
Welche Rolle spielt die "Prosaische Zwischenbemerkung" Kästners?
Kästners „Prosaische Zwischenbemerkung“ dient als Referenzpunkt für die Analyse. Seine dort formulierten Kriterien für gute Lyrik bilden den Maßstab, an dem die Darstellung von Frauen in seinen Gedichten gemessen wird. Die Arbeit untersucht, ob Kästners Frauenbild mit seinen eigenen Ansprüchen an gelungene Lyrik vereinbar ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Erich Kästner, Lyrik, Frauenbild, Neue Sachlichkeit, Mutterfigur, Gedichtanalyse, Geschlechterrollen, Vorurteile, Lyriktheorie, Sachlichkeit, Emotionen.
Welche konkreten Gedichte werden analysiert?
Die Arbeit nennt explizit die Gedichte "Frau Großhennig schreibt ihrem Sohn" und "Junggesellen sind auf Reisen" als Beispiele für die Analyse der Darstellung von Müttern. Das Gedicht "Stiller Besuch" wird als Ausnahme erwähnt, in dem eine bedingungslose Liebe zur Mutter dargestellt wird. Weitere Gedichte werden vermutlich im Hauptteil der Arbeit analysiert, sind aber in dieser Übersicht nicht explizit benannt.
Welchen Kontext stellt die Arbeit her?
Die Arbeit stellt den Kontext der Neuen Sachlichkeit her, in dem Kästners Gedichte entstanden sind. Sie erwähnt auch die kontroversen Reaktionen auf sein Frauenbild.
- Citar trabajo
- Fabian Otto (Autor), 2002, Das Frauenbild in der Lyrik Erich Kästners, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29263