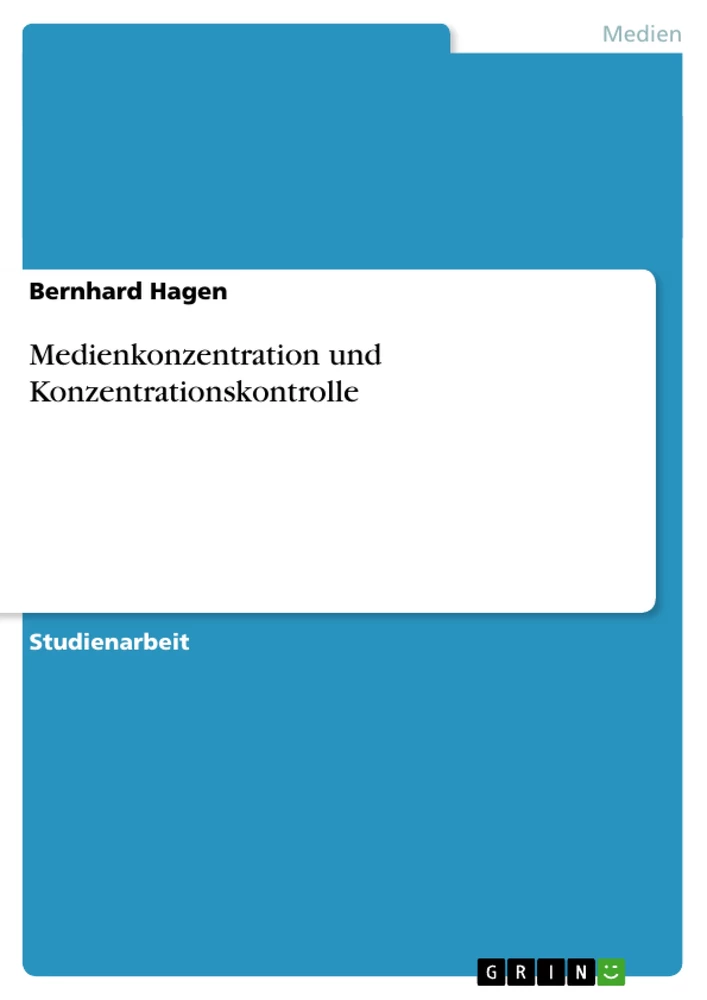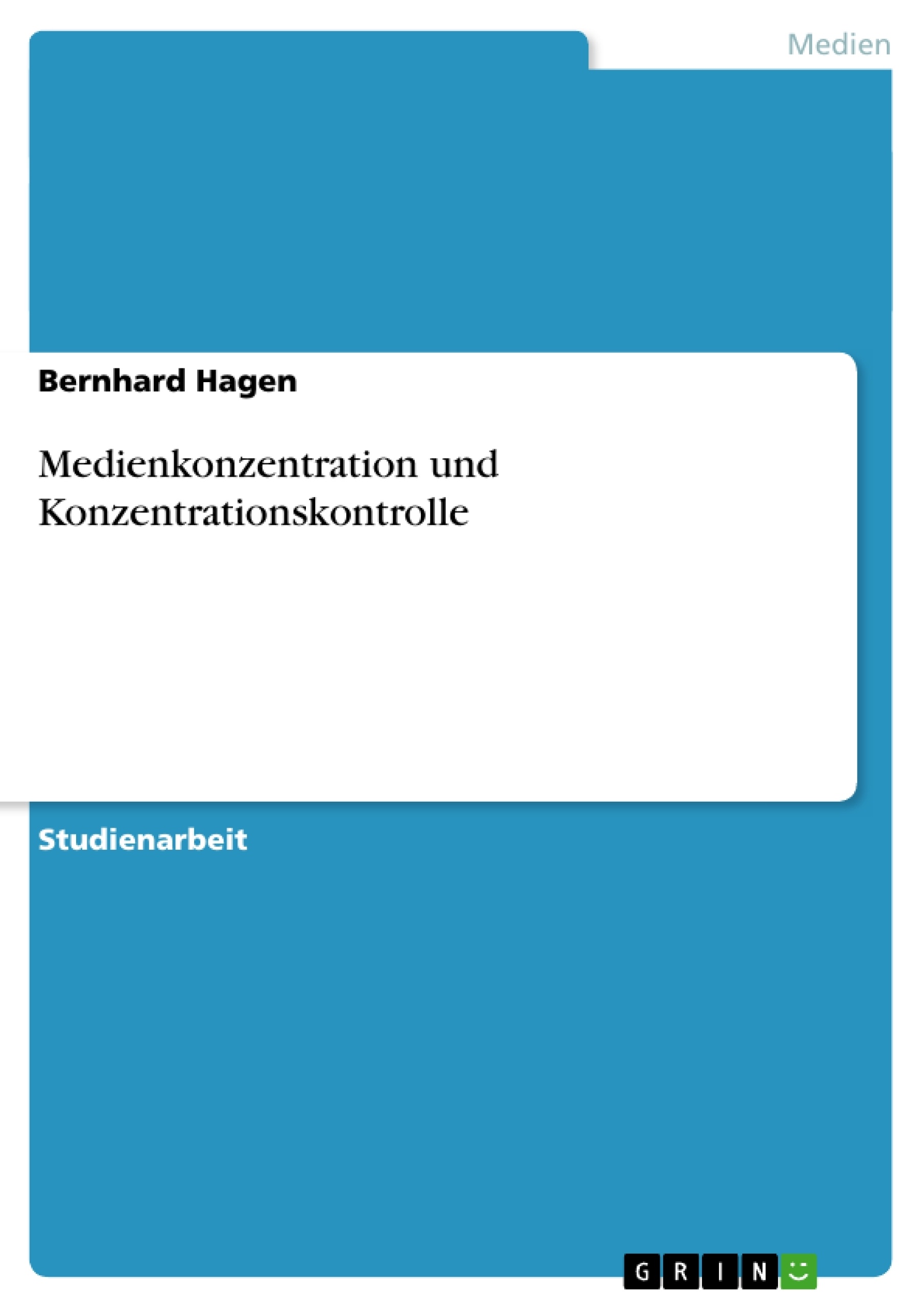In dieser Arbeit habe ich mich verschiedenen Fragen gewidmet: Grundsätzlich stellte sich das Problem der Definition, also „was ist Medienkonzentration“? Daraufhin habe ich auch versucht, verschiedene Formen von Konzentration auszuloten und den Unterschied zwischen publizistischer und ökonomischer Konzentration darzustellen. Ich habe ebenso versucht, Argumente pro und contra Medienkonzentration zu finden und Modelle zu beschreiben, mit denen man der Konzentration am Medienmarkt vorbeugen kann. Welche Möglichkeiten haben die verschiedenen Formen der Konzentrationskontrolle, und wo liegen die Schwachpunkte?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begriffsbestimmung
- 1.1 Medien
- 1.2 Konzentration
- 1.3 Problem
- 2. Formen der Konzentration
- 2.1 Horizontale Konzentration
- 2.2 Vertikale Konzentration
- 2.3 Multimediale bzw. diagonale Konzentration
- 2.4 Internationale Konzentration
- 2.5 Multisektorale Konzentration
- 3. Argumente pro und contra Konzentration
- 3.1 Pro
- 3.2 Contra
- 4. Konzentrationskontrolle
- 4.1 Allgemeine Problematik
- 4.2 Formen von Vielfalt
- 4.3 Regelungen zur Konzentrationskontrolle im Rundfunkbereich in Deutschland
- 4.3.1 „Beteiligungsmodell“ im Staatsvertrag (1992 - 1996)
- 4.3.2 Das „Zuschauermarktanteilsmodell“
- 4.3.3 Weitere Modelle der Konzentrationskontrolle
- 4.4 Schwächen der Konzentrationskontrolle
- 5. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Phänomen der Medienkonzentration und der damit verbundenen Herausforderungen für die Medienlandschaft. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Formen der Konzentration und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb, die Vielfalt und die Meinungsfreiheit. Darüber hinaus werden die Argumente für und gegen Medienkonzentration beleuchtet und verschiedene Modelle der Konzentrationskontrolle vorgestellt.
- Definition des Begriffs Medienkonzentration
- Analyse der verschiedenen Formen der Medienkonzentration
- Diskussion der Vor- und Nachteile von Medienkonzentration
- Bewertung der Möglichkeiten und Grenzen der Konzentrationskontrolle
- Untersuchung der Auswirkungen von Medienkonzentration auf die Medienvielfalt und die Meinungsfreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor, die sich um die Definition von Medienkonzentration, verschiedene Formen der Konzentration und die Folgen für die Medienlandschaft drehen.
- 1. Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel erläutert die Begriffe „Medien“ und „Konzentration“ und beleuchtet die unterschiedlichen Facetten des Begriffs „Medienkonzentration“.
- 2. Formen der Konzentration: Hier werden verschiedene Formen der Medienkonzentration wie horizontale, vertikale, multimediale und internationale Konzentration beschrieben und ihre jeweiligen Charakteristika beleuchtet.
- 3. Argumente pro und contra Konzentration: Dieses Kapitel diskutiert die Argumente für und gegen Medienkonzentration, indem es sowohl positive wie negative Auswirkungen auf den Medienmarkt beleuchtet.
- 4. Konzentrationskontrolle: Dieses Kapitel widmet sich der Thematik der Konzentrationskontrolle und analysiert verschiedene Modelle und Regelungen, die zur Begrenzung von Medienkonzentration eingesetzt werden.
Schlüsselwörter
Medienkonzentration, Konzentrationskontrolle, Medienvielfalt, Meinungsfreiheit, Medienmarkt, Wettbewerb, Marktbeherrschung, Monopol, Oligopol, Rundfunkbereich, Staatsvertrag, Zuschauermarktanteilsmodell, Medienunternehmen, Fusionen, Konzernumbildungen, publizistische Konzentration, ökonomische Konzentration, Medienpolitik, Medienrecht.
- Arbeit zitieren
- Bernhard Hagen (Autor:in), 2002, Medienkonzentration und Konzentrationskontrolle, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29252