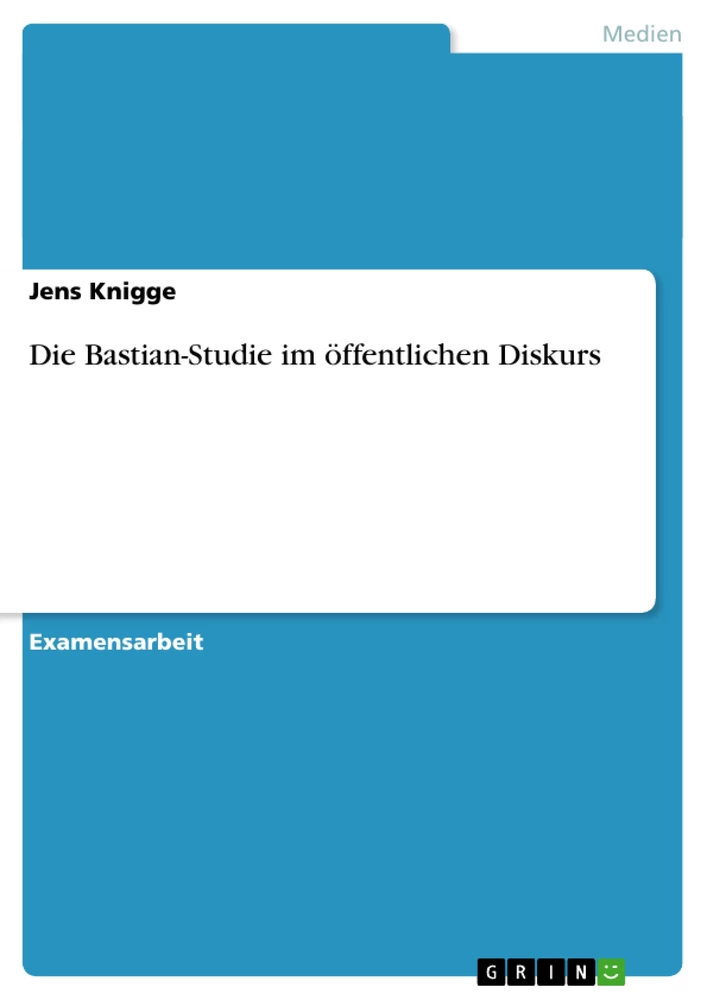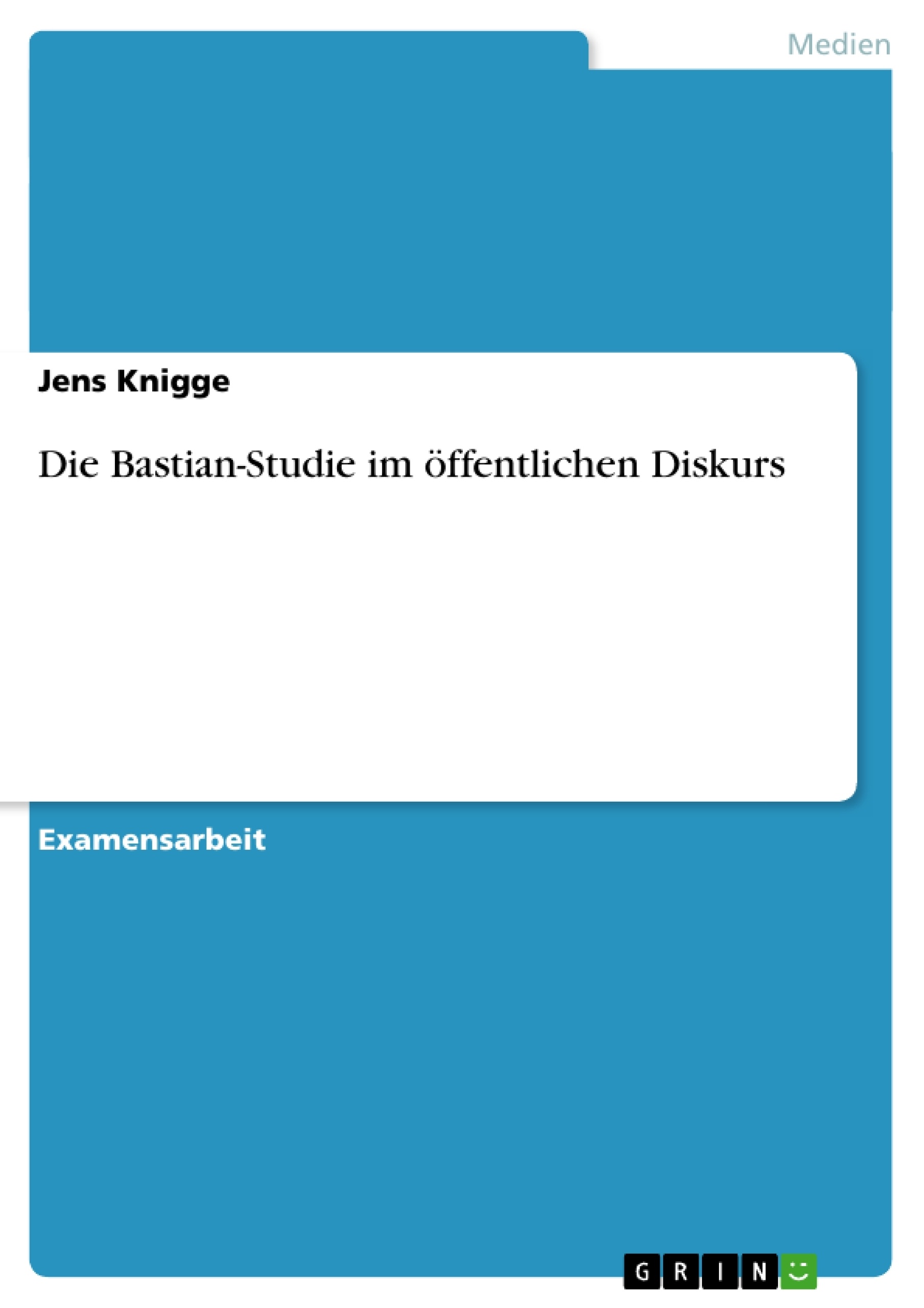„Musik macht klug“
„Musik macht kreativ und leistungsstark“
„Musik fördert Intelligenz und soziale Kompetenz“
Schlagzeilen dieser Art waren in den letzten Jahren immer wieder zu lesen. Eine Reihe von Medienberichten suggerierte, dass durch eine wissenschaftliche Studie positive Auswirkungen von Musikunterricht auf die verschiedensten Bereiche der Persönlichkeit nachgewiesen werden könnten. In Zeiten eines „stetig darbenden Musikunterrichts an unseren Schulen“ wirken solche Meldungen wie Balsam für die Seelen vieler Musikpädagogen. Dem ständig wachsenden Legitimationsdruck des Musikunterrichts im Schulcurriculum könnten somit u.U. wissenschaftlich abgesicherte Argumente entgegengesetzt werden. Trotzdem scheint Vorsicht angebracht zu sein. Was sind die genauen Hintergründe dieser Meldungen von segensreichen Auswirkungen der Musik?
Im April 2000 wurde das Buch Musik (-erziehung) und ihre Wirkung veröffentlicht. Der Musikpädagoge Hans Günther Bastian dokumentiert darin die Ergebnisse seines sechsjährigen Forschungsprojekts an Berliner Grundschulen. Diese Studie bildet den Ausgangspunkt für die oben genannten Meldungen, sowie für vorliegende Arbeit. Richter beschreibt die sogenannte Bastian- Studie als das wichtigste Thema des musikpädagogischen Diskurses im Jahr 2000. Die Studie fand jedoch nicht nur Beachtung im wissenschaftlichen Kontext. Für eine musikpädagogische Forschungsarbeit nicht gerade selbstverständlich, wurde die Studie von einem überaus breiten Medieninteresse begleitet.
Damit sind bereits die beiden Hauptbereiche des öffentlichen Diskurses genannt, welcher im Zentrum dieser Arbeit steht. Der Schwerpunkt liegt also auf der Rezeption der Bastian-Studie. Es ist somit nicht das Ziel vorliegender Arbeit, die Studie in ihren methodischen Einzelheiten oder die daraus resultierenden Ergebnisse umfassend darzustellen. Es werden neben einigen allgemeineren Ausführungen explizit die Punkte der Studie besprochen, die für den öffentlichen Diskurs von Relevanz sind.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Grundlagen
- 1.1 Die Studie Zum Einfluss erweiterter Musikerziehung auf die allgemeine und individuelle Entwicklung von Kindern
- 1.1.1 Genese der Studie
- 1.1.2 Aufgabenstellung und Forschungshypothesen
- 1.1.3 Datenerhebung und Beschreibung der Stichprobe
- 1.1.4 Ziele der Studie
- 1.2 Das Konzept der,Musikbetonung' an Berliner Grundschulen
- 1.3 Eine Transferstudie - definitorische Vorbemerkungen
- 2. Rezeption I: Die Studie in den populärwissenschaftlichen Medien
- 2.1 Studienbegleitende Berichte
- 2.2 Mediale Verarbeitung der Studienergebnisse
- 2.3 Hintergründe des Medieninteresses
- 3. Rezeption II: Diskurs und Kritik in der Fachliteratur
- 3.1 Forschungsmethoden
- 3.1.1 Versuchsdesign und Treatment
- 3.1.2 Die Stichprobe
- 3.1.2.1 Stichprobengröße und Relation der Versuchsgruppen
- 3.1.2.2 Qualitative Unterschiede der Versuchsgruppen
- 3.1.3 Leistungs- und Qualifikationsprofil der Lehrkräfte
- 3.2 Interpretation der Studienergebnisse
- 3.3 Präsentation der Studienergebnisse
- 3.3.1 Einseitige Darstellung der Ergebnisse
- 3.3.2 Darstellung der Ergebnisse im Taschenbuch Kinder optimal fördern - mit Musik
- 3.4 Bildungspolitischer Hintergrund
- 3.4.1 Zur Situation des Musikunterrichts im Schulwesen
- 3.4.2 Politische Intention der Studie
- 3.4.3 Auswirkung der politischen Intention auf die Studie
- 3.4.4 Kritik an der schulpolitischen Argumentation der Studie
- 4. Wirkung: Aufnahme und Folgen der Studie
- 4.1 Aufnahme in den Verbänden
- 4.2 Politische Auswirkungen
- 4.3 Aufnahme der Studie in Schulen und die Auswirkung auf das öffentliche Bewusstsein
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Rezeption und Wirkung der „Bastian-Studie“ im öffentlichen Diskurs. Sie beleuchtet die Entstehung der Studie, ihre Forschungsmethodik und die Interpretation ihrer Ergebnisse sowie die Diskussionen, die sie im Bereich der Musikpädagogik, Medienlandschaft und Politik ausgelöst hat.
- Die Genese der Studie und ihre methodischen Grundlagen
- Die Darstellung der Studie in populärwissenschaftlichen Medien und die Analyse der medialen Verarbeitung ihrer Ergebnisse
- Die Kritik an der Studie in Fachkreisen, insbesondere hinsichtlich der Forschungsmethodik, Interpretation und der politischen Intention
- Die Auswirkungen der Studie auf Verbände, Politik und das öffentliche Bewusstsein im Bereich der Musikpädagogik
- Die Relevanz der Studie für den aktuellen Diskurs über die Bedeutung der Musikerziehung in der Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit behandelt die „Bastian-Studie“ selbst. Es wird ihre Entstehung, ihre Aufgabenstellung, die Forschungsmethodik und die Ergebnisse der Untersuchung beleuchtet. Das zweite Kapitel analysiert die Rezeption der Studie in populärwissenschaftlichen Medien. Dabei werden sowohl studienbegleitende Berichte als auch die mediale Verarbeitung der Studienergebnisse untersucht. Das dritte Kapitel widmet sich der Kritik an der Studie in der Fachliteratur. Es werden die Forschungsmethoden und die Interpretation der Studienergebnisse im Detail analysiert sowie die politische Intention der Studie hinterfragt. Das vierte Kapitel beleuchtet die Wirkung der Studie auf Verbände, Politik und das öffentliche Bewusstsein.
Schlüsselwörter
Die „Bastian-Studie“, Musikerziehung, Musikpädagogik, Forschung, Rezeption, Medien, Diskurs, Kritik, Politik, Bildung, öffentliche Meinung, Wirkung.
- Quote paper
- Jens Knigge (Author), 2004, Die Bastian-Studie im öffentlichen Diskurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29193