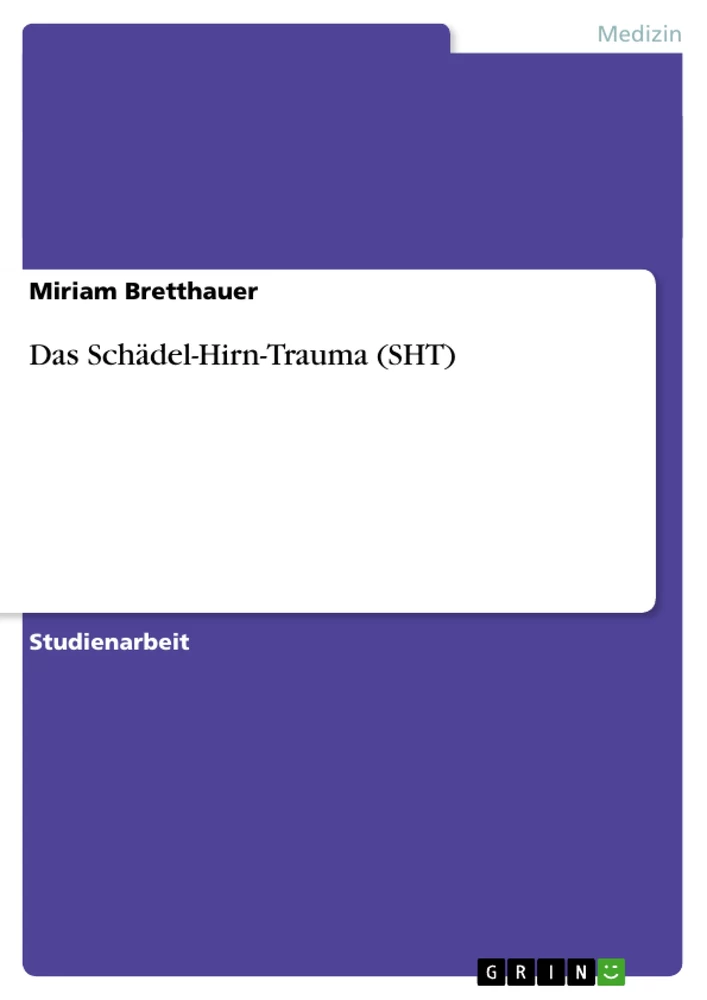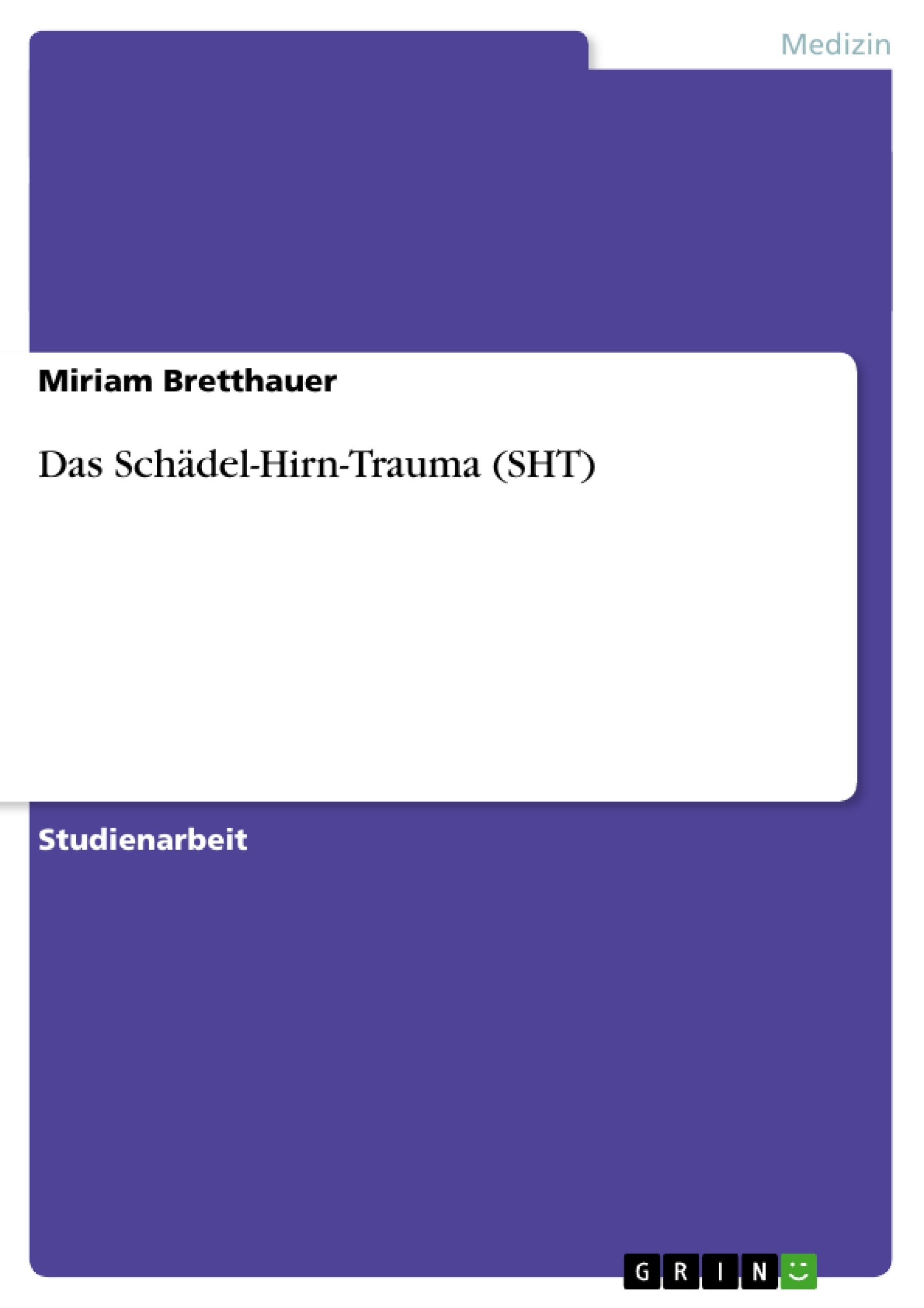Das Schädel-Hirn-Trauma, abgekürzt SHT, ist in Deutschland die
häufigste Todesursache im Alter bis zu ca. 40 Jahren. Da aufgrund der
international nicht einheitlichen Definition von Schädel-Hirn-Traumen keine
genauen epidemiologischen Studien über Häufigkeit, Schwere und Art von
Schädel-Hirn-Verletzungen vorliegen, kann man nur von Schätzungen ausgehen.
Demnach erleiden pro Jahr ungefähr 200.000 Menschen ein SHT (Angaben von
1996), 10% davon ein schweres. Die Mortalität liegt um die 30%, wobei die
Frühmortalität sehr hoch ist. Allein 60% der Betroffenen versterben im Laufe der
ersten 24 Stunden. Laut P. Witton ist “die Mortalität bei Patienten über 60 Jahren
[...] doppelt so hoch wie bei Jugendlichen” (201).
Hauptursachen des Schädel-Hirn-Traumas sind Unfälle angesiedelt in den
Bereichen Verkehr (80%), Sport und Spiel, sowie Arbeitsplatz. Alkoholeinfluß
stellt einen ausschlaggebenden Faktor bei tödlich verlaufenden Unfällen dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Epidemiologie
- 2 Definition
- 3 Schweregradeinteilung und Verlauf
- 4 Primäre und Sekundäre Hirnschädigung
- 4.1 Sekundäre Hirnschädigung (intrakraniell)
- 4.1.1 Intrakranielle Blutungen
- 4.1.2 Epidurales Hämatom
- 4.1.3 Subdurales Hämatom
- 4.1.4 Intrazerebrales Hämatom
- 4.1.5 Hirnödem
- 4.1.6 Meningitis
- 4.1.7 Liquorfistel
- 4.1.8 Hirnabszeß
- 4.2 Sekundäre Hirnschädigung (extrakraniell)
- 4.1 Sekundäre Hirnschädigung (intrakraniell)
- 5 Klinische Leitsymptome bei SHT
- 5.1 Bewußtseinsstörung
- 5.2 Atemstörungen
- 5.3 Pupillenstörungen
- 5.4 Störungen der Augenmotorik und der Reflexe
- 5.5 Vegetative Störungen
- 5.6 Kreislaufveränderungen
- 6 Notfallbehandlung
- 7 Diagnostik
- 8 Therapie
- 9 Prognose
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Schädel-Hirn-Trauma (SHT), einer der häufigsten Todesursachen in Deutschland bei jüngeren Menschen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der Epidemiologie, Definition, Schweregradeinteilung, primären und sekundären Hirnschädigungen sowie der klinischen Symptome zu vermitteln.
- Epidemiologie des Schädel-Hirn-Traumas in Deutschland
- Definition und Klassifizierung von Schädel-Hirn-Traumen
- Primäre und sekundäre Hirnschädigungen nach einem SHT
- Klinische Symptome und deren Bedeutung
- Schweregradeinteilung nach Morphologie und Funktion
Zusammenfassung der Kapitel
1 Epidemiologie: Das Schädel-Hirn-Trauma (SHT) ist in Deutschland die häufigste Todesursache bis ca. 40 Jahre. Genaue Zahlen sind aufgrund internationaler Definitionsunterschiede schwer zu ermitteln, Schätzungen belaufen sich auf ca. 200.000 Fälle pro Jahr, davon 10% schwere Fälle. Die Mortalität liegt bei ca. 30%, wobei ein Großteil der Todesfälle innerhalb der ersten 24 Stunden eintritt. Verkehrsunfälle stellen die Hauptursache dar, gefolgt von Sport- und Arbeitsunfällen. Alkoholkonsum ist ein signifikanter Risikofaktor für tödliche Unfälle.
2 Definition: Ein Schädel-Hirn-Trauma wird als eine durch Gewalteinwirkung auf den Kopf verursachte Gehirnschädigung definiert, die mit Weichteilverletzungen oder Schädelfrakturen einhergeht. Der Schlag auf den Schädel kann zu einem Bruch des Schädelknochens führen oder nicht, beides kann jedoch ein SHT verursachen. Man unterscheidet zwischen gedeckten und offenen SHTs, wobei letztere eine Verletzung der Dura mater beinhalten und ein erhöhtes Risiko bakterieller Infektionen bergen.
3 Schweregradeinteilung und Verlauf: Die Schwere des SHT wird anhand verschiedener Gradeinteilungen bestimmt. Die "klassische Einteilung" unterscheidet zwischen Commotio cerebri (leichte Gehirnerschütterung), Contusio cerebri (Hirnprellung) und Compressio cerebri (Hirnquetschung). Eine weitere Einteilung basiert auf der Dauer der Bewußtlosigkeit und der Hirnstammfunktionsstörung. Beide Einteilungen bieten verschiedene Perspektiven auf die Schwere und den Verlauf des SHTs.
4 Primäre und Sekundäre Hirnschädigung: Primäre Hirnschädigungen sind die direkten Folgen der Gewalteinwirkung (z.B. Frakturen, Prellungen, Nerven- und Gefäßverletzungen) und sind nicht therapeutisch beeinflussbar. Sekundäre Hirnschädigungen treten nach der primären Verletzung auf und sind zum Teil behandelbar. Zu ihnen gehören intrakranielle Blutungen, Hirnödem, Liquorfistel, Hirnabszess und ischämische Hirnschädigung.
Schlüsselwörter
Schädel-Hirn-Trauma (SHT), Epidemiologie, Definition, Schweregradeinteilung, primäre Hirnschädigung, sekundäre Hirnschädigung, intrakranielle Blutungen, Hirnödem, klinische Symptome, Bewußtseinsstörung, Mortalität.
Häufig gestellte Fragen zum Schädel-Hirn-Trauma (SHT)
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Schädel-Hirn-Trauma (SHT). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (Epidemiologie, Definition, Schweregradeinteilung, primäre und sekundäre Hirnschädigungen, klinische Symptome), sowie Schlüsselwörter.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Epidemiologie des SHT in Deutschland, die Definition und Klassifizierung von SHTs, die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Hirnschädigungen, die klinischen Symptome (Bewusstseinsstörungen, Atemstörungen, Pupillenstörungen etc.), die Schweregradeinteilung nach Morphologie und Funktion, sowie Notfallbehandlung, Diagnostik, Therapie und Prognose. Es werden detailliert verschiedene Arten von sekundären Hirnschädigungen (intrakranielle Blutungen, Hirnödem, Meningitis etc.) beschrieben.
Was versteht man unter primären und sekundären Hirnschädigungen?
Primäre Hirnschädigungen sind die direkten Folgen des Aufpralls auf den Kopf (z.B. Frakturen, Prellungen, Verletzungen von Nerven und Gefäßen) und sind nicht therapeutisch beeinflussbar. Sekundäre Hirnschädigungen treten nach der primären Verletzung auf und sind teilweise behandelbar. Beispiele hierfür sind intrakranielle Blutungen, Hirnödem, Liquorfistel, Hirnabszess und ischämische Hirnschädigung.
Wie wird die Schwere eines Schädel-Hirn-Traumas eingeteilt?
Die Schwere des SHT wird anhand verschiedener Gradeinteilungen bestimmt. Eine "klassische Einteilung" unterscheidet zwischen Commotio cerebri (leichte Gehirnerschütterung), Contusio cerebri (Hirnprellung) und Compressio cerebri (Hirnquetschung). Eine weitere Einteilung basiert auf der Dauer der Bewusstlosigkeit und der Hirnstammfunktionsstörung. Beide Einteilungen bieten verschiedene Perspektiven auf die Schwere und den Verlauf des SHTs.
Welche klinischen Symptome treten bei einem Schädel-Hirn-Trauma auf?
Klinische Symptome umfassen Bewusstseinsstörungen, Atemstörungen, Pupillenstörungen, Störungen der Augenmotorik und der Reflexe, vegetative Störungen und Kreislaufveränderungen. Die Bedeutung dieser Symptome wird im Dokument detailliert erläutert.
Wie häufig ist ein Schädel-Hirn-Trauma in Deutschland?
Das Schädel-Hirn-Trauma ist in Deutschland eine häufige Todesursache, besonders bei jüngeren Menschen. Schätzungen belaufen sich auf ca. 200.000 Fälle pro Jahr, wobei etwa 10% schwere Fälle sind. Die Mortalität liegt bei ca. 30%, wobei ein Großteil der Todesfälle innerhalb der ersten 24 Stunden eintritt. Verkehrsunfälle sind die Hauptursache.
Welche Risikofaktoren gibt es für ein Schädel-Hirn-Trauma?
Alkoholkonsum ist ein signifikanter Risikofaktor für tödliche Unfälle im Zusammenhang mit Schädel-Hirn-Traumata.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter in Bezug auf Schädel-Hirn-Traumata?
Schlüsselwörter sind: Schädel-Hirn-Trauma (SHT), Epidemiologie, Definition, Schweregradeinteilung, primäre Hirnschädigung, sekundäre Hirnschädigung, intrakranielle Blutungen, Hirnödem, klinische Symptome, Bewußtseinsstörung, Mortalität.
- Citar trabajo
- Miriam Bretthauer (Autor), 2002, Das Schädel-Hirn-Trauma (SHT), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29164