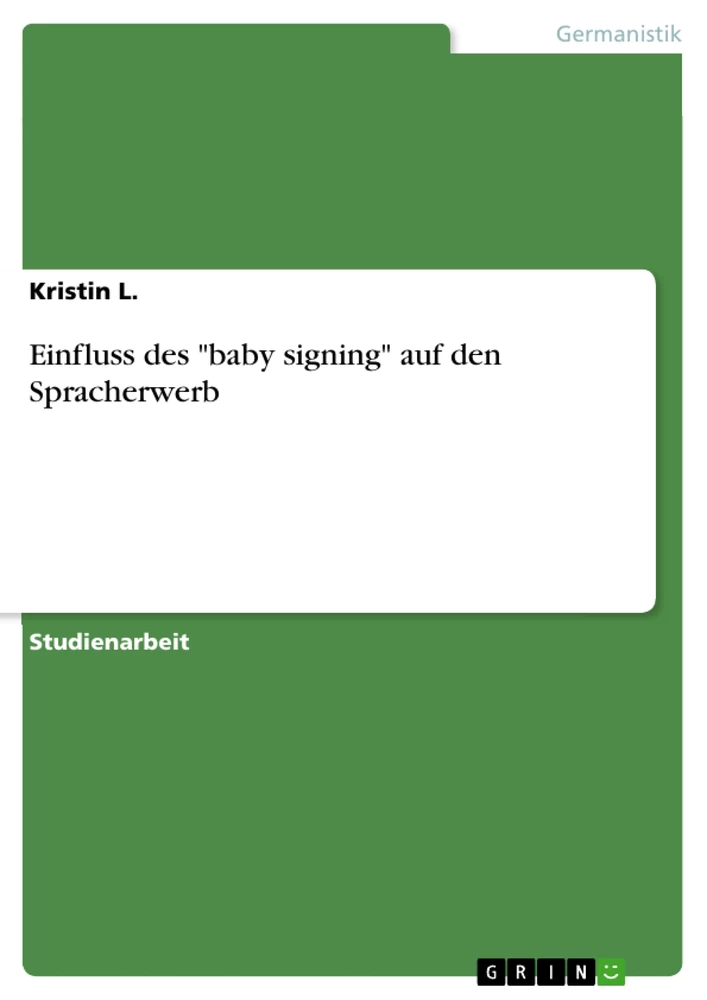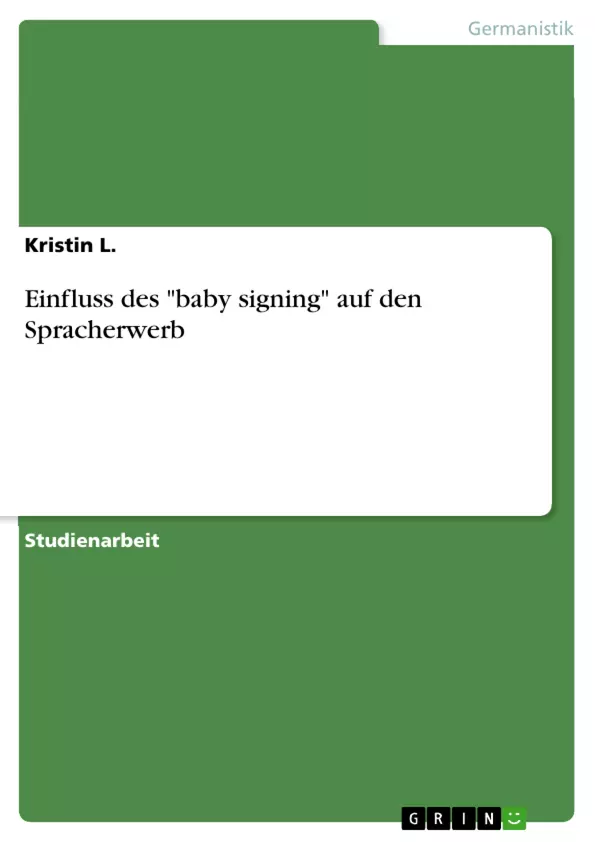"Der lange Weg zum ersten Wort"- so oder in ähnlicher Form könnte die entscheidendste und wichtigste Entwicklungsaufgabe eines Kleinkindes zusammengefasst werden.
Dieser Denkspruch verdeutlicht, durch den Terminus des Weges, zum einen die Prozesshaftigkeit und zum anderen die Dauer des Spracherwerbes, da dieser über mehrere Jahre reicht.
Die Bedeutung des Erwerbs von Sprache ist darin begründet, dass Sprache uns tagtäglich in jedweden Situationen umgibt, sei es in verbaler, nonverbaler oder grafischer Form. Um an der Gesellschaft teilzuhaben, muss man die Fähigkeit, Sprache zu produzieren, erwerben.
Die vorliegende Arbeit untersucht, inwieweit sich Aussagen über den Einfluss des "baby signing" auf den Spracherwerb von Kleinkindern treffen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Der lange Weg zum ersten Wort
- Stadien des Erstspracherwerbs von Kleinkindern
- Auf dem Weg zum ersten Wort - sprachliche Entwicklungen im ersten Lebensjahr
- Erste Zweiwortäußerungen - sprachliche Entwicklungen im zweiten Lebensjahr
- Die Entwicklung einer einfachen, verständlichen Kindersprache - sprachliche Entwicklungen im dritten Lebensjahr
- Die an das Kind gerichtete Sprache (KGS)
- Theoretische Grundlagen zum baby signing
- Erwerb und Struktur des baby signing
- Forschungsstand zum baby signing
- Studie von GOODWYN, ACREDOLO und BROWN (2000)
- Studie von MÜLLER (2009)
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Deutschen Gebärdensprache
- Ein Vorsprung durch Baby-Signing?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von „baby signing“ auf den Erstspracherwerb von Kleinkindern. Es wird analysiert, inwieweit das Erlernen von Babyzeichen die sprachliche Entwicklung positiv beeinflusst. Die Arbeit basiert auf bestehenden Forschungsliteratur und analysiert die Argumentation für und gegen die Methode.
- Der Prozess des Erstspracherwerbs bei Kleinkindern
- Die an das Kind gerichtete Sprache (KGS) und ihre Bedeutung
- Der Erwerb und die Struktur von Babyzeichensprache
- Ergebnisse und Interpretationen relevanter Studien zum baby signing
- Vergleich von Babyzeichensprache und Deutscher Gebärdensprache (DGS)
Zusammenfassung der Kapitel
Der lange Weg zum ersten Wort: Dieses Kapitel beschreibt die Herausforderungen und den langen Prozess des Spracherwerbs bei Kleinkindern. Es betont die Prozesshaftigkeit und Dauer des Erwerbs, die Bedeutung von Sprache für die Teilhabe an der Gesellschaft und die Schwierigkeit dieser Entwicklungsaufgaben für das Kind. Es unterscheidet zwischen Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerb und hebt die Elternperspektive hervor: die Vorfreude und das Bedürfnis, das Kind besser zu verstehen. Die Einführung von „baby signing“ als Methode zur Unterstützung des Spracherwerbs wird vorbereitet.
Stadien des Erstspracherwerbs von Kleinkindern: Dieses Kapitel gliedert den Erstspracherwerb in Phasen, die jeweils einem Lebensjahr entsprechen (erstes, zweites und drittes Lebensjahr). Es beschreibt die sprachlichen Entwicklungen in diesen Phasen, von den ersten Lauten bis hin zur Bildung einfacher Sätze. Obwohl die Entwicklung an Lebensmonaten festgemacht wird, wird die individuelle Variabilität betont. Die Kapitel dienen als Grundlage, um den potenziellen Einfluss von „baby signing“ in den jeweiligen Entwicklungsstadien zu beurteilen.
Die an das Kind gerichtete Sprache (KGS): Dieses Kapitel beleuchtet die Besonderheiten der an Kleinkinder gerichteten Sprache und deren Funktion für den Spracherwerb. Es wird die Bedeutung des sprachlichen Inputs für die Entwicklung des Kindes untersucht und analysiert, ob und wie die KGS den Spracherwerb beeinflusst. Diese Analyse dient als Vergleichsbasis für die Wirkung von „baby signing“, da auch diese Form der Kommunikation an das Kind gerichtet ist und dessen Sprachentwicklung fördern soll.
Theoretische Grundlagen zum baby signing: Dieses Kapitel konzentriert sich auf „baby signing“, seinen Erwerb und seine Struktur. Es erklärt die Methode, zeigt geeignete Vokabeln für den Anfang und verdeutlicht den Lernprozess. Die Analyse zweier Studien (Goodwyn, Acredolo & Brown, 2000; Müller, 2009) untersucht den Einfluss auf den Spracherwerb und den Wortschatz. Der Vergleich mit der Deutschen Gebärdensprache (DGS) untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Gebärden.
Schlüsselwörter
Erstspracherwerb, Kleinkinder, Babyzeichensprache, Baby signing, Sprachentwicklung, KGS (Kind-gerichtete Sprache), Goodwyn/Acredolo/Brown-Studie, Müller-Studie, Deutsche Gebärdensprache (DGS), Sprachförderung.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Einfluss von "Baby Signing" auf den Erstspracherwerb
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick zum Thema "Baby Signing" und dessen Einfluss auf den Erstspracherwerb von Kleinkindern. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Text analysiert den Spracherwerbsprozess bei Kleinkindern, die Bedeutung kindgerichtete Sprache (KGS), den Erwerb und die Struktur von Babyzeichensprache und bewertet relevante Studien zum Thema.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die zentralen Themen sind der Erstspracherwerb bei Kleinkindern in verschiedenen Altersstufen (erstes, zweites und drittes Lebensjahr), die Rolle der kindgerichteten Sprache (KGS), die Methode "Baby Signing", die Analyse von Studien zu "Baby Signing" (Goodwyn, Acredolo & Brown, 2000; Müller, 2009), und ein Vergleich von Babyzeichensprache und Deutscher Gebärdensprache (DGS).
Welche Studien werden im Text analysiert?
Der Text analysiert die Studien von Goodwyn, Acredolo und Brown (2000) und Müller (2009), die sich beide mit dem Einfluss von "Baby Signing" auf den Spracherwerb befassen. Die Ergebnisse und Interpretationen dieser Studien werden im Text diskutiert.
Was ist "Baby Signing"?
"Baby Signing" ist eine Methode, bei der Babys und Kleinkinder einfache Gebärden lernen, um sich auszudrücken, bevor sie sprechen können. Der Text erklärt die Methode, geeignete Vokabeln und den Lernprozess.
Wie wird die kindgerichtete Sprache (KGS) im Text behandelt?
Der Text beleuchtet die Besonderheiten der KGS und deren Bedeutung für den Spracherwerb. Er untersucht, wie die KGS den Spracherwerb beeinflusst und vergleicht ihre Wirkung mit der von "Baby Signing".
Welche Phasen des Erstspracherwerbs werden beschrieben?
Der Text gliedert den Erstspracherwerb in drei Phasen, die jeweils einem Lebensjahr entsprechen: das erste, zweite und dritte Lebensjahr. Für jede Phase werden die typischen sprachlichen Entwicklungen beschrieben, von den ersten Lauten bis hin zu einfachen Sätzen. Die individuelle Variabilität wird dabei betont.
Wie wird der Vergleich zwischen Babyzeichensprache und Deutscher Gebärdensprache (DGS) dargestellt?
Der Text vergleicht die Babyzeichensprache mit der Deutschen Gebärdensprache (DGS), um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Gebärden aufzuzeigen.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text?
Der Text zieht keine expliziten Schlussfolgerungen, sondern präsentiert eine umfassende Analyse des Forschungsstandes zu "Baby Signing" und dessen Einfluss auf den Erstspracherwerb. Die Interpretation der Ergebnisse der analysierten Studien und der Vergleich mit der KGS ermöglichen dem Leser, eine eigene Einschätzung zu bilden.
Für wen ist dieser Text geeignet?
Dieser Text eignet sich für alle, die sich wissenschaftlich mit dem Erstspracherwerb von Kleinkindern und dem Einfluss von "Baby Signing" darauf auseinandersetzen möchten. Er ist insbesondere für Studenten, Wissenschaftler und Fachkräfte im Bereich der Sprachentwicklung relevant.
Wo finde ich die vollständigen Studien?
Die vollständigen Studien von Goodwyn, Acredolo & Brown (2000) und Müller (2009) müssen über wissenschaftliche Datenbanken oder Bibliotheken recherchiert werden. Der Text dient als Überblick und Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse dieser Studien.
- Quote paper
- Kristin L. (Author), 2013, Einfluss des "baby signing" auf den Spracherwerb, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/289252