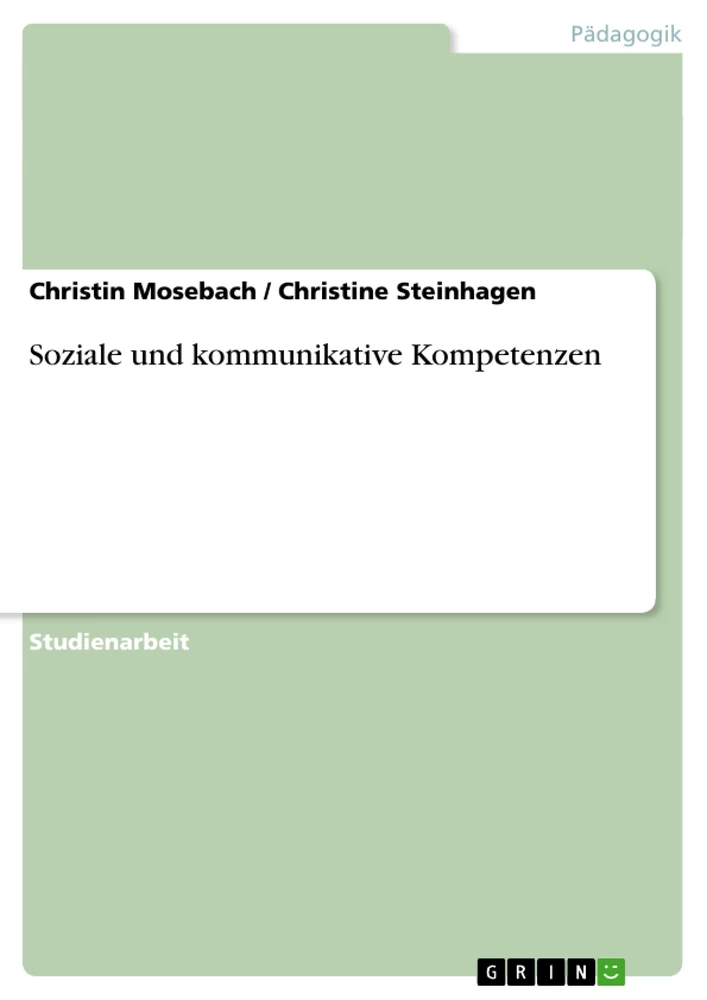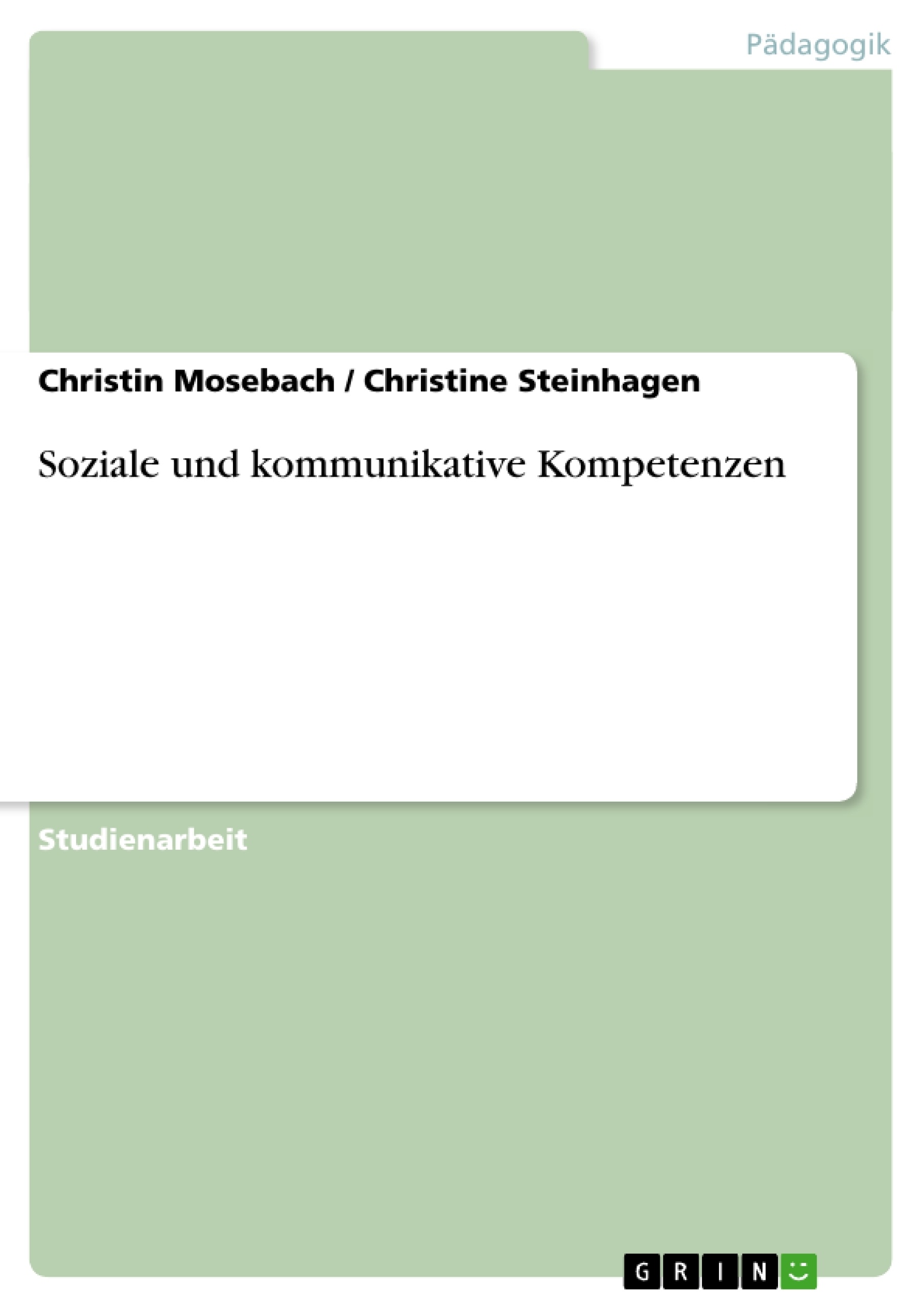Einleitung
Die Förderung von Sozialkompetenzen erhält u.a. in der Berufsbildung aus unterschiedlichen Gründen eine hohe Priorität. Dies ergibt sich aus den neu gefassten Rahmenlehrplänen der Berufe und den Anforderungen der Wirtschaft an Schulabgänger1. Damit werden Sozialkompetenzen einerseits immer gefragter, andererseits können sie nicht mehr als selbstverständliches Ergebnis gesellschaftlicher Sozialisationsprozesse vorausgesetzt werden.2 Am Beispiel des Entwurfes des Hamburger Bildungsplans für Friseure wird deutlich, dass die folgende Definition des Begriffes der Sozialkompetenz nicht eindeutig ist: „Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidarität.“3
Dieser Meinung sind auch die Autoren Dieter Euler und Monika Reemtsma-Theis: „Häufig stellt der Ruf nach Sozialkompetenzen nicht mehr dar, als eine unbestimmte Forderung, als ein positiv besetzter Sammelbegriff für ein Konglomerat vielfältiger Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen.“4 Wir möchten mit unserer Arbeit zur Präzisierung des Begriffs Sozialkompetenz mit Hilfe des Grundmodells des sozial-kommunikativen Handelns von Euler/Reemtsma-Theis beitragen. Dabei wollen wir folgendermaßen vorgehen: Im zweiten Kapitel werden wir das Grundmodell nach Euler/Reemtsma-Theis darstellen und im dritten Kapitel Lernphasen zur Entwicklung von Handlungskompetenzen nach Euler an Hand einer von uns gewählten Konfliktsituation erläutern. Im vierten Kapitel prüfen wir die Unterrichtsmethode „Rollenspiel“ auf ihre Eignung zur Förderung von Sozialkompetenzen. Wir werden versuchen die im zweiten Kapitel erarbeiteten Kompetenzbereiche verschiedenen Rollenspieltypen zuzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundmodell des sozial-kommunikativen Handelns nach Euler/Reemtsma-Theis
- Agentiver Schwerpunkt
- Reflexiver Schwerpunkt
- Reflexiver Schwerpunkt (1): Klärung der Ausprägung und Bedeutung von situativen Bedingungen des sozial-kommunikativen Handelns
- Reflexiver Schwerpunkt (2): Klärung der Ausprägung und Bedeutung von personalen Bedingungen des sozial-kommunikativen Handelns
- Sozial-kommunikative Handlungskompetenzen im Hinblick auf die Bewegung zwischen Aktion und Reflexion
- Systematisierung von Lernphasen zur Entwicklung von sozial-kommunikativen Handlungskompetenzen nach Euler
- Rollenspiele – geeignete Methode zur Förderung von Sozialkompetenzen?
- Warum handlungsorientierte Methoden?
- Begriffliche Grundlagen
- Vor- und Nachteile des Rollenspiels
- Rollenspieltypen
- Welchen Typ Rollenspiel kann man für welche Kompetenzen einsetzen?
- Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Sozialkompetenz im Kontext der Berufsbildung. Die Autoren analysieren den Begriff der Sozialkompetenz und untersuchen, wie er mit Hilfe des Grundmodells des sozial-kommunikativen Handelns von Euler/Reemtsma-Theis präzisiert werden kann. Ziel ist es, einen detaillierteren Blick auf die Entwicklung und Förderung von Sozialkompetenzen in der beruflichen Bildung zu ermöglichen.
- Das Grundmodell des sozial-kommunikativen Handelns nach Euler/Reemtsma-Theis
- Die Bedeutung von Sozialkompetenzen in der Berufsbildung
- Die Entwicklung und Förderung von Sozialkompetenzen durch handlungsorientierte Methoden
- Die Eignung von Rollenspielen zur Förderung von Sozialkompetenzen
- Lernphasen zur Entwicklung von Sozialkompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen Sozialkompetenz und Berufsbildung heraus und führt den Begriff der Sozialkompetenz anhand von aktuellen Definitionen ein. Anschließend widmen sich die Autorinnen dem Grundmodell des sozial-kommunikativen Handelns nach Euler/Reemtsma-Theis. Dabei werden der agentive und der reflexive Schwerpunkt sowie die relevanten Teilkompetenzen im Detail beleuchtet. Es wird ein praktisches Beispiel der Konfliktsituation Patient-Arzthelferin zur Veranschaulichung des Modells herangezogen. Im dritten Kapitel wird eine Systematisierung von Lernphasen zur Entwicklung von Sozialkompetenzen nach Euler vorgestellt. Schließlich werden im vierten Kapitel Rollenspiele als Methode zur Förderung von Sozialkompetenzen analysiert. Die Autorinnen gehen dabei auf die Vor- und Nachteile sowie die verschiedenen Typen von Rollenspielen ein.
Schlüsselwörter
Sozialkompetenz, Handlungskompetenz, sozial-kommunikatives Handeln, Grundmodell, Euler/Reemtsma-Theis, Rollenspiele, Lernphasen, Berufsbildung
- Quote paper
- Christin Mosebach (Author), Christine Steinhagen (Author), 2002, Soziale und kommunikative Kompetenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28920