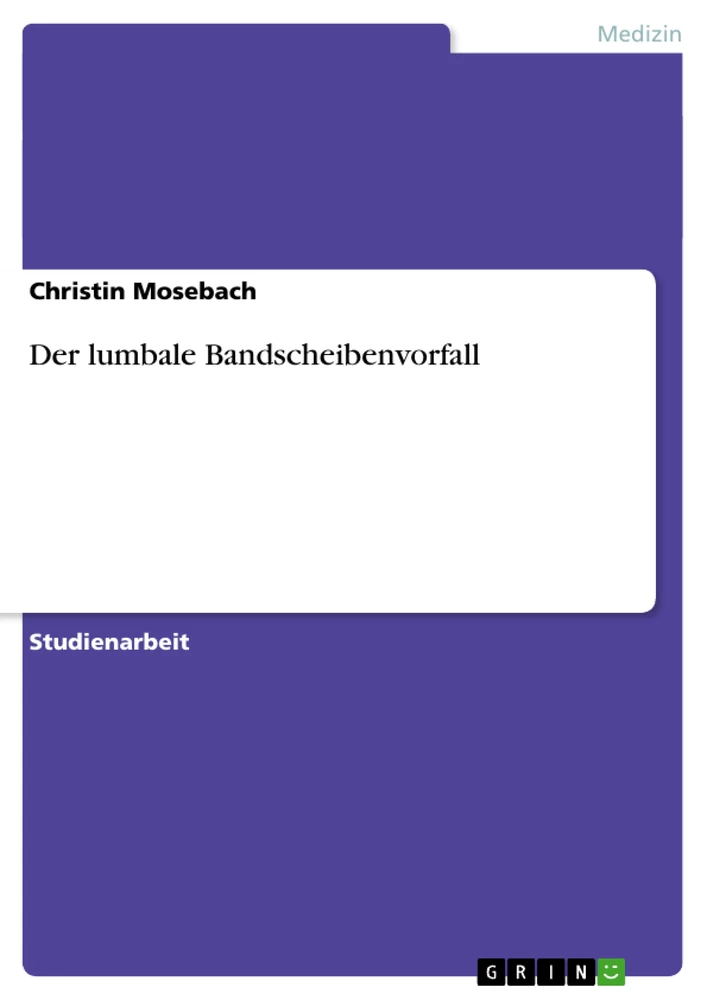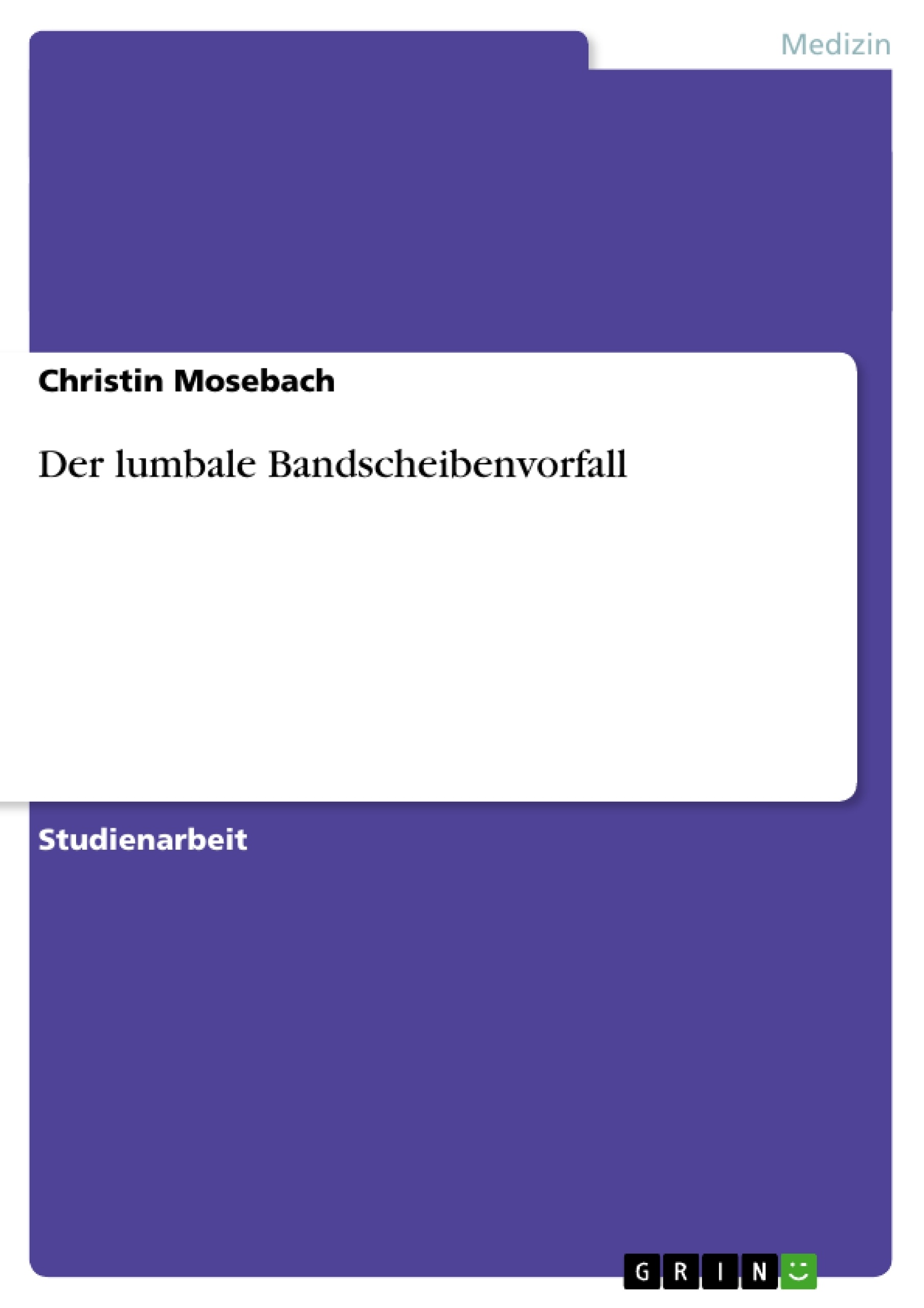Einleitung
Rückenschmerzen sind in den letzten Jahren in den westlichen Industrienationen zu einem Volksleiden geworden. Der Anteil derjenigen, die wenigstens einmal in ihrem Leben an Rückenschmerzen leiden, liegt bei 80 bis 90 %.
In Deutschland leidet fast jeder Dritte ständig unter Rückenschmerzen. Nur jeder fünfte Erwachsene bleibt zeitlebens verschont.
Am stärksten betroffen sind Menschen mittleren Alters zwischen 30 und 50 Jahren. Die Zahl der unter 30jährigen nimmt jedoch besonders stark zu. Bei 65 Prozent der Jugendlichen unter 18 Jahren wurden bereits Haltungsschäden unterschiedlicher Ausprägung festgestellt.
Verschiedenste Erkrankungen von Wirbelsäule und Rücken verursachen jährlich 3,7 Millionen Krankschreibungen, die sich auf insgesamt 75,5 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage summieren. Bei vorsichtiger Schätzung machen die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten von Rückenschmerzen knapp 15 Mrd. Euro pro Jahr aus. Diese nüchternen Zahlen belegen die Bedeutung von Rückenschmerzen in unserer Gesellschaft. Das seelische Leid und die Beeinträchtigung der Lebensqualität, die sie verursachen, können durch Zahlen nicht ausgedrückt werden.
Rückenschmerzen können vielseitige Ursachen und Folgen haben. Ich möchte mich in meiner Arbeit ausschließlich mit dem lumbalen Bandscheibenvorfall beschäftigen, da der Kreuzschmerz einen der häufigsten Beschwerdekomplexe in der orthopädischen Praxis darstellt. Aber nicht nur Orthopäden, sondern auch Internisten, Chirurgen, Neurologen und Neurochirurgen haben mit den Folgen von lumbalen Bandscheibenerkrankungen zu tun.
Die Diagnostik wird entscheidend erschwert durch die Vielgestaltigkeit des Geschehens, das sich aus ganz unterschiedlichen Ursachen und Wirkungen zusammensetzen kann, welche sich untereinander vermischen und eskalieren können. Nur die genaue Auswertung der Anamnese, die Analyse der Schmerzqualität und die exakte Interpretation der klinischen und röntgenologischen Untersuchungsergebnisse führen zur Diagnose.
Um mich dieser anzunähern, werde ich mich zuerst in meiner Arbeit mit den anatomischen Grundlegen der Wirbelsäule und ihren Einzelheiten befassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Physiologische Anatomie
- 2.1 Die Wirbelsäule als Ganzes
- 2.1.1 Einteilung der Wirbelsäule
- 2.1.2 Funktion der Wirbelsäule
- 2.1.3 Form der Wirbelsäule
- 2.1.4 Bewegungsmöglichkeiten der Wirbelsäule
- 2.2 Aufbau der Skelettelemente der Wirbelsäule
- 2.2.1 Allgemeiner Aufbau eines Wirbels
- 2.2.1.1 Besonderheiten des Halswirbels
- 2.2.1.2 Besonderheiten des Brustwirbels
- 2.2.1.3 Besonderheiten des Lendenwirbels
- 2.2.2 Aufbau des Kreuzbeins
- 2.2.3 Aufbau des Steißbeins
- 2.2.1 Allgemeiner Aufbau eines Wirbels
- 2.3 Verbindungen innerhalb der Wirbelsäule
- 2.3.1 Wirbelbogengelenke
- 2.3.2 Bänder
- 2.3.3 Bandscheiben
- 2.3.3.1 Aufbau der Bandscheiben
- 2.3.3.2 Ernährung der Bandscheiben
- 2.3.3.3 Funktion der Bandscheiben
- 2.3.4 Wirbelkanal
- 2.3.5 Zwischenwirbelloch
- 2.4 Autochthone Rückenmuskulatur
- 2.5 Mechanik des lumbosakralen Übergangs
- 2.1 Die Wirbelsäule als Ganzes
- 3. Bandscheibenvorfall
- 4. Lumbale Bandscheibenvorfall
- 4.1 Pathophysiologie
- 4.2 Symptomatik und Klinik
- 4.2.1 Lumbago
- 4.2.2 Lumboischialgie
- 4.2.2.1 Wurzelreizerscheinungen
- 4.2.2.2 Wurzelausfallerscheinungen
- 4.2.3 Kaudakompression
- 4.3 Diagnostik
- 4.3.1 Körperliche Untersuchung
- 4.3.2 Röntgendiagnostik
- 4.3.2.1 Röntgenaufnahme der LWS
- 4.3.2.2 Kernspintomografie und Kernspinmyelografie
- 4.3.2.3 Computertomografie der LWS
- 4.3.2.4 Lumbale Myelografie und Myelo-CT
- 4.3.2.5 Discografie
- 4.4 Differentialdiagnose
- 4.5 Therapie
- 4.5.1 Konservative Behandlung
- 4.5.2 Operative Behandlung
- 4.5.3 Operationsmethoden
- 4.5.4 Komplikationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem lumbalen Bandscheibenvorfall, einer häufigen Erkrankung mit weitreichenden Folgen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der anatomischen Grundlagen der Wirbelsäule zu vermitteln und die Pathophysiologie, Symptomatik, Diagnostik und Therapie des lumbalen Bandscheibenvorfalls zu erläutern.
- Anatomie der Wirbelsäule
- Pathophysiologie des lumbalen Bandscheibenvorfalls
- Klinische Erscheinungsbilder (Lumbago, Lumboischialgie)
- Diagnostische Verfahren
- Konservative und operative Therapieansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die hohe Prävalenz von Rückenschmerzen in der Bevölkerung heraus und begründet die Fokussierung auf den lumbalen Bandscheibenvorfall aufgrund seiner Häufigkeit in der orthopädischen Praxis. Sie hebt die Komplexität der Diagnostik aufgrund der vielfältigen Ursachen und Wirkungen hervor und kündigt die anatomische Auseinandersetzung mit der Wirbelsäule als Grundlage des weiteren Verlaufs an.
2. Physiologische Anatomie: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Aufbau und die Funktion der Wirbelsäule. Es gliedert sich in die Anatomie der Wirbelsäule als Ganzes (Einteilung, Funktion, Form, Bewegungsmöglichkeiten), den Aufbau der Skelettelemente (Wirbelkörper, Besonderheiten der Hals-, Brust- und Lendenwirbel, Kreuzbein und Steißbein) und die Verbindungen innerhalb der Wirbelsäule (Wirbelbogengelenke, Bänder, Bandscheiben mit ihrem Aufbau, Ernährung und Funktion, Wirbelkanal und Zwischenwirbelloch). Die autochthone Rückenmuskulatur und die Mechanik des lumbosakralen Übergangs werden ebenfalls behandelt. Das Kapitel liefert die essentielle anatomische Grundlage für das Verständnis des Bandscheibenvorfalls.
3. Bandscheibenvorfall: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Bandscheibenvorfall allgemein und legt die Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel. Es bietet einen Überblick über die Mechanismen, welche zum Bandscheibenvorfall führen. Die Kapitel bietet wichtige allgemeine Informationen, die im Folgenden detailliert betrachtet werden. Die allgemeine Beschreibung bildet die Basis für die spezifischen Abschnitte zum lumbalen Bandscheibenvorfall.
4. Lumbale Bandscheibenvorfall: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem lumbalen Bandscheibenvorfall. Es behandelt die Pathophysiologie, die verschiedenen klinischen Erscheinungsbilder (Lumbago, Lumboischialgie, Kaudakompression), die Diagnostik (körperliche Untersuchung, bildgebende Verfahren wie Röntgen, Kernspintomografie, Computertomografie, Myelografie und Discografie) und die Differentialdiagnose. Schließlich werden konservative und operative Therapieansätze sowie mögliche Komplikationen erläutert. Die umfassende Darstellung aller Aspekte des lumbalen Bandscheibenvorfalls macht dieses Kapitel zum Kernstück der Arbeit.
Schlüsselwörter
Wirbelsäule, lumbaler Bandscheibenvorfall, Lumbago, Lumboischialgie, Pathophysiologie, Anatomie, Diagnostik, Therapie, Röntgen, Kernspintomografie, Konservative Behandlung, Operative Behandlung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Lumbaler Bandscheibenvorfall
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht zum Thema lumbaler Bandscheibenvorfall. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen, sowie eine Liste von Schlüsselbegriffen. Der Hauptteil befasst sich detailliert mit der Anatomie der Wirbelsäule, der Pathophysiologie, Symptomatik, Diagnostik und Therapie des lumbalen Bandscheibenvorfalls.
Welche anatomischen Aspekte der Wirbelsäule werden behandelt?
Das Dokument behandelt die Anatomie der Wirbelsäule sehr detailliert. Es beschreibt die Einteilung, Funktion und Form der Wirbelsäule als Ganzes, den Aufbau der einzelnen Wirbel (Hals-, Brust- und Lendenwirbel), des Kreuzbeins und des Steißbeins. Zusätzlich werden die Verbindungen innerhalb der Wirbelsäule, wie Wirbelbogengelenke, Bänder, Bandscheiben (Aufbau, Ernährung, Funktion), der Wirbelkanal und das Zwischenwirbelloch, ausführlich erklärt. Die autochthone Rückenmuskulatur und die Mechanik des lumbosakralen Übergangs werden ebenfalls beschrieben.
Welche Aspekte des Bandscheibenvorfalls werden behandelt?
Das Dokument behandelt den Bandscheibenvorfall sowohl allgemein als auch spezifisch im lumbalen Bereich. Es erklärt die Pathophysiologie, die klinischen Erscheinungsbilder (Lumbago, Lumboischialgie, Kaudakompression), die verschiedenen diagnostischen Verfahren (körperliche Untersuchung, Röntgen, Kernspintomografie, Computertomografie, Myelografie, Discografie) und die Differentialdiagnose. Die konservativen und operativen Therapieansätze sowie mögliche Komplikationen werden ebenfalls erläutert.
Welche diagnostischen Verfahren werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt eine Reihe von diagnostischen Verfahren zur Erkennung eines lumbalen Bandscheibenvorfalls. Dazu gehören die körperliche Untersuchung, die Röntgendiagnostik (Röntgenaufnahme der LWS), die Kernspintomografie und Kernspinmyelografie, die Computertomografie der LWS, die lumbale Myelografie und Myelo-CT sowie die Discografie.
Welche Therapieansätze werden vorgestellt?
Das Dokument beschreibt sowohl konservative als auch operative Therapieansätze für den lumbalen Bandscheibenvorfall. Die konservativen Behandlungen werden ebenso erläutert wie verschiedene operative Methoden und mögliche Komplikationen nach einer Operation.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Dokument verwendet?
Die Schlüsselbegriffe umfassen: Wirbelsäule, lumbaler Bandscheibenvorfall, Lumbago, Lumboischialgie, Pathophysiologie, Anatomie, Diagnostik, Therapie, Röntgen, Kernspintomografie, Konservative Behandlung, Operative Behandlung.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich an Personen, die ein umfassendes Verständnis des lumbalen Bandscheibenvorfalls benötigen. Es eignet sich beispielsweise für Medizinstudenten, Ärzte und andere medizinische Fachkräfte, die sich mit der Diagnostik und Therapie von Rückenleiden befassen.
Wo finde ich weitere Informationen?
Für weiterführende Informationen empfiehlt es sich, die im Dokument zitierten Quellen (falls vorhanden) zu konsultieren und die Fachliteratur zum Thema lumbaler Bandscheibenvorfall zu recherchieren.
- Quote paper
- Christin Mosebach (Author), 2004, Der lumbale Bandscheibenvorfall, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28916