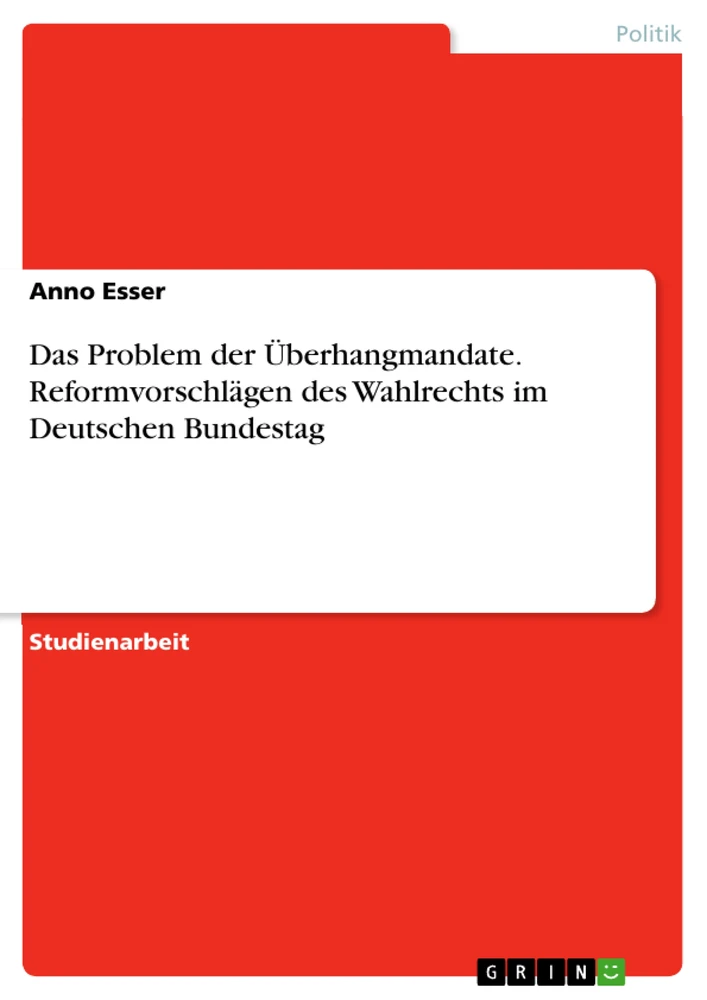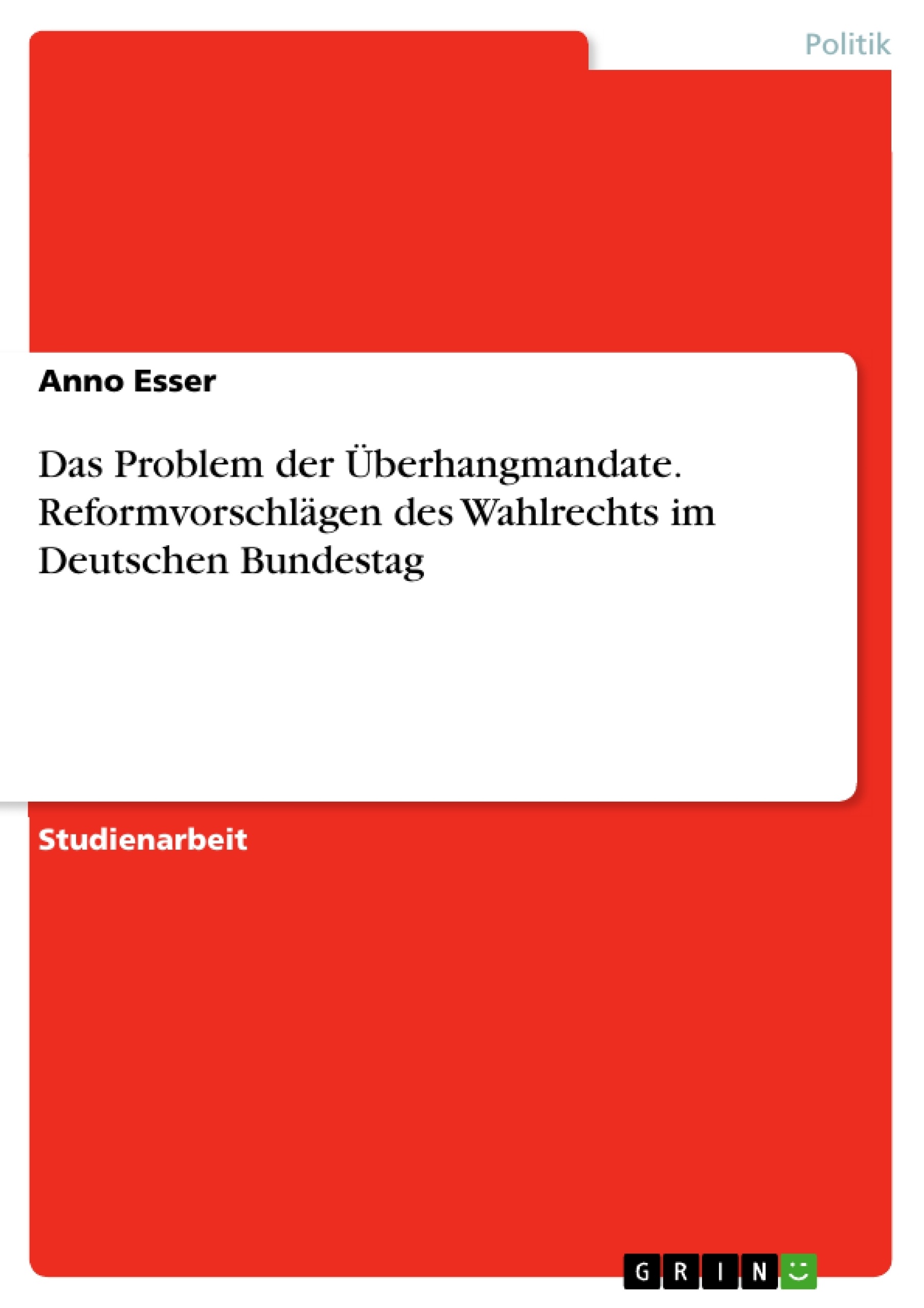Mit dem Urteil vom 25. Juli 2012 traf das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung mit großer Tragweite für die zukünftige Ausgestaltung des Wahlrechts der deutschen Demokratie. Das geltende Wahlrecht wurde als verfassungswidrig verworfen und die Zahl der Überhangmandate auf 15 begrenzt. Das Urteil hat eine lange und zum Teil unglückliche Vorgeschichte, die bis in die 90er Jahre zurückreicht - als die Überhangmandate durch ihr gehäuftes Vorkommen zunehmend als Problem in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft wahrgenommen wurden.
Dem Wandel des Parteiensystems und der zunehmenden Fragmentierung nach der Wiedervereinigung konnte die „alte“ Regelung des personalisierten Verhältniswahlrechts nicht mehr gerecht werden. Justiz und Politik taten sich allerdings lange schwer, angemessene Reformen auf den Weg zu bringen: Macht- und parteipolitische Überlegungen bestimmten die Entwicklung.
Im juristisch-politikwissenschaftlichen Diskurs wurde die Wahlrechtsreformdebatte, besonders seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum „negativen Stimmrecht von 2008, in vielen Beiträgen und Stellungnahmen intensiv thematisiert. Das Spektrum der Vorschläge reicht dabei von „kleinen“ Reformen, die am System der personalisierten Verhältniswahl festhalten und „nur“ das Problem der Überhangmandate und des negativen Stimmgewichts zu lösen versprechen, bis zu „großen“ Reformen, die den bisher eingeschlagenen Pfad verlassen und die Einführung - entweder eines Mehrheitswahlsystems oder der Verhältniswahl, bzw. eine Stärkung der Komponenten dieser beiden Modelle - vorschlagen.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist erstens, die Entstehung und Entwicklung der Überhangmandate nachzuzeichnen und zu analysieren und zweitens, die im juristischen und politikwissenschaftlichen Diskurs vorgeschlagenen Wahlrechtsreformmodelle darzustellen und kritisch zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überhangmandate im personalisierten Verhältniswahlrecht
- Entwicklung der Überhangmandate bei den Wahlen zum Bundestag
- Erklärungsfaktoren und Ursachen von Überhangmandaten
- Zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
- Wahlrechtsreform: Möglichkeiten und Perspektiven
- Ausgleichslösung
- „Große“ Reformvorschläge
- Verhältniswahlrecht
- Mehrheitswahlrecht
- „Kleine“ Reformvorschläge
- Schlussbetrachtung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Entstehung und Entwicklung von Überhangmandaten im deutschen Bundestagswahlrecht zu analysieren und verschiedene im politischen und juristischen Diskurs vorgeschlagene Reformmodelle kritisch zu untersuchen. Die Arbeit beleuchtet sowohl die historischen Entwicklungen als auch die Ursachen für das Auftreten von Überhangmandaten.
- Entwicklung und Ursachen von Überhangmandaten im deutschen Wahlsystem
- Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Thematik der Überhangmandate
- Analyse verschiedener Wahlrechtsreformmodelle ("große" und "kleine" Reformen)
- Kritische Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen der vorgeschlagenen Reformen
- Zentrale Gesichtspunkte der aktuellen und zukünftigen Wahlrechtsreformdebatte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Überhangmandate im deutschen Bundestagswahlrecht ein und beschreibt den Hintergrund des Problems, insbesondere das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2012. Sie skizziert die historische Entwicklung, die zunehmende Problematik im Kontext des veränderten Parteiensystems und die daraus resultierende Notwendigkeit einer Wahlrechtsreform. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Zielsetzung der Arbeit und der Gliederung der einzelnen Kapitel.
Überhangmandate im personalisierten Verhältniswahlrecht: Dieses Kapitel analysiert das Entstehen von Überhangmandaten im Kontext des personalisierten Verhältniswahlrechts. Es erklärt detailliert den Mechanismus, wie Überhangmandate durch die Diskrepanz zwischen Direkt- und Zweitstimmen entstehen. Der Abschnitt beleuchtet die Funktionsweise des Wahlsystems, die getrennte Auszählung von Erst- und Zweitstimmen und die daraus resultierende Möglichkeit von Überhangmandaten. Das Kapitel hebt die Besonderheiten des deutschen Systems hervor und erklärt, warum es zu diesen Diskrepanzen kommt. Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts als wichtiger Akteur in der Wahlrechtsreformdebatte wird hervorgehoben.
Wahlrechtsreform: Möglichkeiten und Perspektiven: Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Vorschlägen zur Reform des deutschen Bundestagswahlrechts. Es werden sowohl "große" Reformen, wie die Einführung eines Mehrheitswahlrechts oder einer reinen Verhältniswahl, als auch "kleine" Reformen, die das bestehende System beibehalten und lediglich das Problem der Überhangmandate beheben wollen, detailliert dargestellt und kritisch bewertet. Die Diskussion der jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze steht im Mittelpunkt. Die Analyse umfasst eine fundierte Auseinandersetzung mit den jeweiligen Lösungsansätzen und deren Auswirkungen auf das politische System.
Schlüsselwörter
Überhangmandate, Verhältniswahlrecht, Wahlrechtsreform, Bundesverfassungsgericht, Mehrheitswahlrecht, Parteiensystem, Direktmandate, Zweitstimmen, politische Repräsentation, Stimmgewicht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Überhangmandate im deutschen Bundestagswahlrecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung von Überhangmandaten im deutschen Bundestagswahlrecht und untersucht kritisch verschiedene Reformmodelle, die im politischen und juristischen Diskurs vorgeschlagen wurden. Sie beleuchtet historische Entwicklungen und Ursachen für das Auftreten von Überhangmandaten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung und Ursachen von Überhangmandaten, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu, verschiedene Wahlrechtsreformmodelle (große und kleine Reformen), eine kritische Auseinandersetzung mit deren Vor- und Nachteilen und zentrale Gesichtspunkte der aktuellen und zukünftigen Wahlrechtsreformdebatte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Überhangmandate im personalisierten Verhältniswahlrecht (inkl. Entwicklung, Erklärungsfaktoren, Rechtsprechung des BVerfG), ein Kapitel zu Wahlrechtsreformen (mit Analyse von großen und kleinen Reformvorschlägen wie Verhältniswahlrecht und Mehrheitswahlrecht) und eine Schlussbetrachtung/Fazit. Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Was sind Überhangmandate?
Überhangmandate entstehen im deutschen personalisierten Verhältniswahlrecht durch die Diskrepanz zwischen Direkt- und Zweitstimmen. Eine Partei erhält mehr Direktmandate (über Erststimmen) als ihr nach dem Zweitstimmenanteil zustehen würde. Dies führt zu einer Überrepräsentation dieser Partei im Bundestag.
Welche Rolle spielt das Bundesverfassungsgericht?
Das Bundesverfassungsgericht spielt eine wichtige Rolle in der Wahlrechtsreformdebatte. Seine Rechtsprechung beeinflusst die Diskussion und die Entwicklung von Reformvorschlägen. Die Arbeit bezieht sich auf relevante Urteile des BVerfG, insbesondere das Urteil von 2012.
Welche Reformmodelle werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert sowohl "große" Reformen (z.B. Umstellung auf reines Verhältniswahlrecht oder Mehrheitswahlrecht) als auch "kleine" Reformen, die das bestehende System beibehalten und nur das Problem der Überhangmandate lösen sollen (z.B. Ausgleichsmechanismen). Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze werden kritisch bewertet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Überhangmandate, Verhältniswahlrecht, Wahlrechtsreform, Bundesverfassungsgericht, Mehrheitswahlrecht, Parteiensystem, Direktmandate, Zweitstimmen, politische Repräsentation, Stimmgewicht.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit in der Zusammenfassung wiedergegeben, aber die Arbeit kommt zu einem Schluss über die analysierten Reformmodelle und deren Eignung zur Lösung des Problems der Überhangmandate.)
- Quote paper
- Anno Esser (Author), 2013, Das Problem der Überhangmandate. Reformvorschlägen des Wahlrechts im Deutschen Bundestag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288889