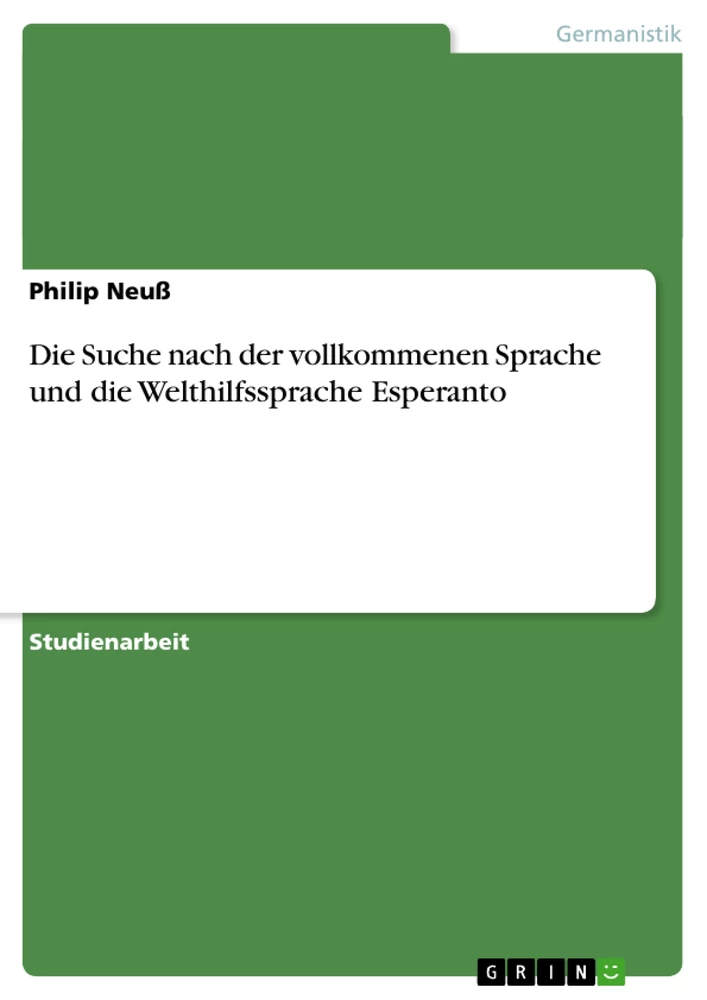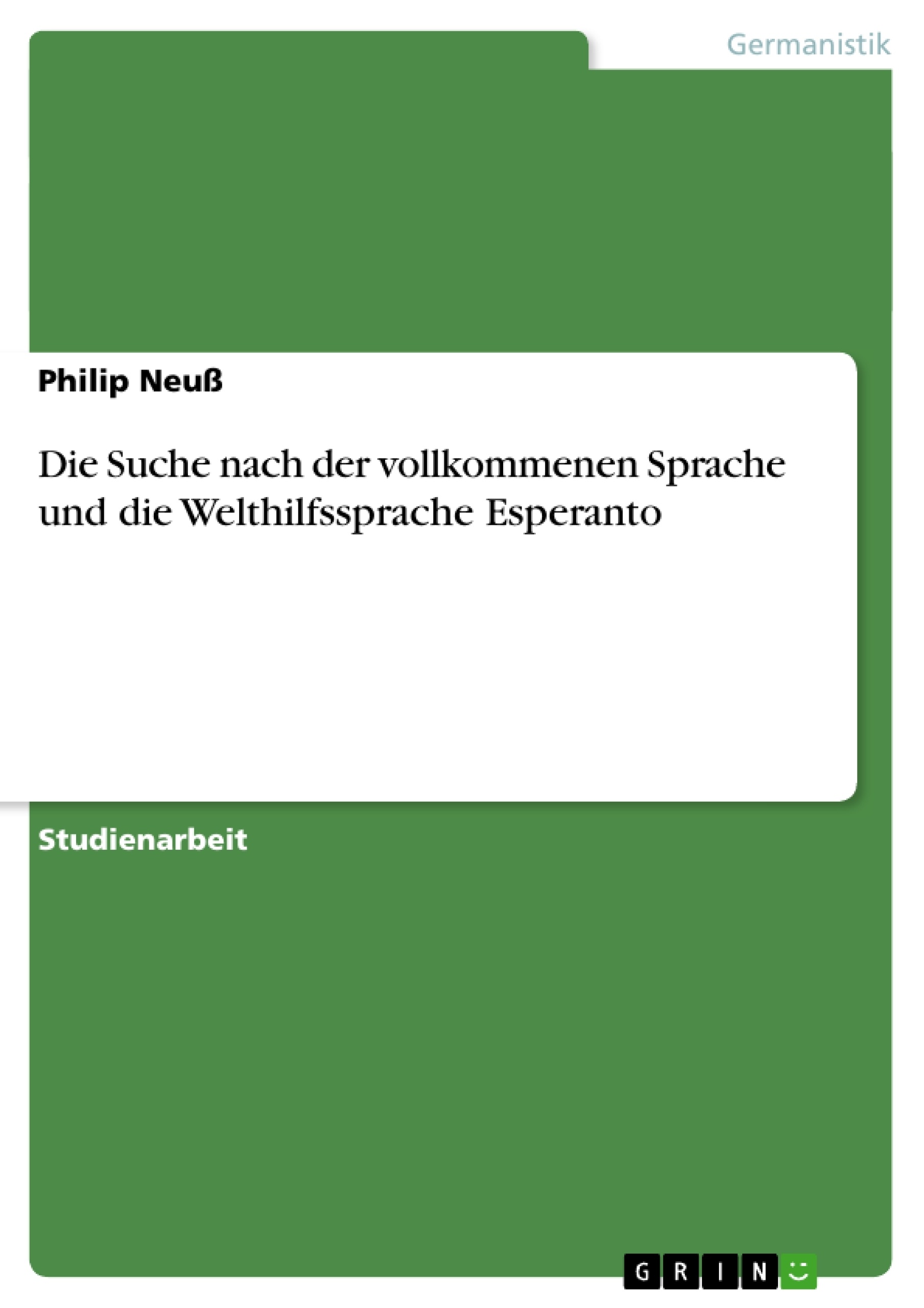"Die Utopie einer vollkommenen Sprache hat nicht nur die europäische Kultur umgetrieben." Gleich im ersten Satz seines Resümees über die langjährige Entwicklung der Suche nach einer idealen Sprache zeigt der italienische Schriftsteller und Semiotiker Umberto Eco seine tiefe Skepsis gegenüber dem Traum vieler Sprachwissenschaftler und Philosophen. Dennoch lässt sich die Frage stellen, warum jegliches Projekt einer Idealsprache, sei es nun durch die Suche nach einer adamitischen Ursprache oder die Schaffung eines neuen Kommunikationsmittels, zum Scheitern verurteilt war und ob es nicht doch eine weltumfassende Sprache geben könne, die nicht nur als Welthilfssprache dient, sondern andere Sprachen überflüssig werden lässt. Schließlich hat es auch die wohl bekannteste Plansprache, das Esperanto, zu einer angesehenen Sprecherzahl gebracht, darunter Linguisten, Naturwissenschaftler und philosophische Fürsprecher, die trotz aller Skepsis gegenüber der Vorstellung einer Universalsprache zugeben müssen, dass "das Esperanto funktioniert." (Antoine Meillet, vgl. Umberto Eco: Die Suche nach der vollkommenen Sprache, S. 330).
Zur Beantwortung dieser zentralen Frage der Sprachtheorie, die sich ebenso auf philosophische wie auf politische Diskussionen ausgewirkt hat und die von unzähligen Linguisten und Philosophen vom antiken Griechenland bis in die Moderne bearbeitet wurde, werde ich mich im Folgenden mit dem Werk „Die Suche nach der vollkommenen Sprache“ von Umberto Eco beschäftigen und die zentralen Grundgedanken wiedergeben, wobei ich der skeptischen Haltung Ecos besondere Bedeutung zukommen lasse. Im Zuge seiner Beschäftigung mit den Welthilfssprachen werde ich mich auch genauer mit dem ebenfalls im Werk enthaltenen Esperanto beschäftigen und dessen Konstruktionsprinzipien und Abgrenzung von den Universalsprachen kurz darstellen.
Abschließen werde ich mit einer kurzen Stellungnahme zu Ecos Argumentation und den Verbreitungsmöglichkeiten einer Universalsprache im Allgemeinen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Suche nach der vollkommenen Sprache
- Die biblische Geschichte der Sprachverwirrung
- Philosophische Untersuchungen zur vollkommenen Sprache im antiken Griechenland
- Latein als Weltsprache und die Entwicklung der Volkssprachen
- Mystische Sprachtheorien: Die jüdisch-kabbalistische Pansemiotik
- Dante Alighieri und das "volgare illustre"
- Ramon Llull und die "Ars Magna"
- Analyse der monogenetischen Hypothese
- Das Hebräische als Ursprache im 16. und 17. Jahrhundert
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Umberto Ecos Werk „Die Suche nach der vollkommenen Sprache“ und dessen zentrale Argumentation bezüglich der Utopie einer idealen, universellen Sprache. Der Fokus liegt auf Ecos skeptischer Perspektive und der Analyse verschiedener historischer Ansätze zur Schaffung oder Wiederentdeckung einer solchen Sprache.
- Die Geschichte der Suche nach einer vollkommenen Sprache
- Analyse verschiedener historischer Theorien zur Universalsprache
- Ecos Kritik an der Vorstellung einer vollkommenen Sprache
- Die Rolle der Plansprachen (am Beispiel Esperanto)
- Der Vergleich natürlicher und künstlicher Sprachen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Suche nach der vollkommenen Sprache: Dieses einleitende Kapitel präsentiert Umberto Ecos skeptische Sicht auf den Traum einer perfekten Sprache. Es stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Möglichkeit und dem Sinn einer weltumfassenden Sprache, die andere Sprachen überflüssig machen könnte, und führt in die Thematik der Welthilfssprachen, insbesondere Esperanto, ein. Eco’s Werk wird als Ausgangspunkt der weiteren Analyse eingeführt.
Die biblische Geschichte der Sprachverwirrung: Dieses Kapitel untersucht die biblische Erzählung vom Turmbau zu Babel als Ursprung der Sprachvielfalt. Eco analysiert die unterschiedlichen Interpretationen der Geschichte und die daraus resultierende Suche nach einer verlorenen Ursprache (adamitische Sprache). Es werden die widersprüchlichen Aussagen der Bibel selbst in Bezug auf den Zeitpunkt der Sprachspaltung beleuchtet und die andauernde Faszination dieser Erzählung für Sprachtheoretiker herausgestellt.
Philosophische Untersuchungen zur vollkommenen Sprache im antiken Griechenland: Hier werden die frühen philosophischen Überlegungen zu einer vollkommenen Sprache im antiken Griechenland beleuchtet. Eco kritisiert die Sichtweise der griechischen Philosophen, die ihre eigene Sprache als einzig vernünftige und alle anderen als "barbarisch" bezeichneten, und zeigt auf, dass auch das Griechische in verschiedene Dialekte aufgeteilt war. Die Debatte um die Herkunft von Wörtern (natürliche Eigenschaften vs. Konvention) wird ebenfalls angesprochen.
Latein als Weltsprache und die Entwicklung der Volkssprachen: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Lateinischen als Weltsprache und den späteren Zerfall des römischen Reiches, der zur Entstehung vieler Volkssprachen führte. Eco beschreibt, wie dieser sprachliche Zerfall die Suche nach einer neuen Universalsprache beförderte. Die sich abzeichnende Gegenüberstellung von Latein als künstlicher und Volkssprachen als natürlicher Sprache wird vorbereitet.
Mystische Sprachtheorien: Die jüdisch-kabbalistische Pansemiotik: Hier konzentriert sich die Analyse auf mystische Sprachtheorien, insbesondere die jüdisch-kabbalistische Pansemiotik. Eco erörtert die kabbalistische Interpretation der Torah und die daraus abgeleitete Idee, dass aus einem endlichen Alphabet unendlich viele Wörter generiert werden können. Das Hebräische wird als Ur-Muttersprache betrachtet und die Rolle der Kabbala in der Vorstellung einer perfekten Universalsprache wird beschrieben.
Dante Alighieri und das "volgare illustre": Dieses Kapitel behandelt Dantes Vision einer vollkommenen Sprache, dem "volgare illustre". Eco analysiert Dantes Gegenüberstellung von Latein und Volkssprachen und dessen Verständnis von Sprachwandel. Dantes Beitrag zur Unterscheidung von Sprache (lingua) und Sprechakt (locutio) wird als wichtiger Meilenstein der Linguistik hervorgehoben. Dantes Überlegungen zu einer universellen Grammatik werden ebenfalls beleuchtet.
Ramon Llull und die "Ars Magna": Hier wird Ramon Llulls "Ars Magna", ein kombinatorisches Sprachsystem zur Verbreitung des christlichen Glaubens, analysiert. Eco kritisiert die Grenzen von Llulls Ansatz und zeigt, dass dessen System kein neues Wissen generieren, sondern nur vorhandenes Wissen ordnen konnte. Die Kritik von Leibniz an Llulls System wird ebenfalls diskutiert.
Analyse der monogenetischen Hypothese: In diesem Kapitel fasst Eco seine bisherigen Kritiken zusammen. Er betont die ungenaue Unterscheidung zwischen vollkommener und universeller Sprache, sowie die unzureichende Trennung zwischen ursprünglicher Sprache und universeller Grammatik. Die Probleme bei der Suche nach Nomenklaturen in verschiedenen Sprachen, die eine allgemeine Ursprache beweisen sollen, werden erläutert.
Das Hebräische als Ursprache im 16. und 17. Jahrhundert: Der Textauszug endet hier, bevor eine Zusammenfassung dieses Kapitels gegeben werden kann.
Schlüsselwörter
Vollkommene Sprache, Universalsprache, Esperanto, Sprachverwirrung, Babel, adamitische Ursprache, Plansprache, natürliche Sprache, künstliche Sprache, Linguistik, Semiotik, Kabbala, Dante Alighieri, Ramon Llull, Guillaume Postel, Umberto Eco, Monogenetische Hypothese, Universalgrammatik.
Häufig gestellte Fragen zu Umberto Ecos "Die Suche nach der vollkommenen Sprache"
Was ist der Gegenstand des Buches "Die Suche nach der vollkommenen Sprache"?
Das Buch untersucht die Utopie einer idealen, universellen Sprache und analysiert verschiedene historische Ansätze zu deren Schaffung oder Wiederentdeckung. Es konzentriert sich auf Umberto Ecos skeptische Perspektive gegenüber diesem Ideal.
Welche Themen werden im Buch behandelt?
Das Buch behandelt die Geschichte der Suche nach einer vollkommenen Sprache, analysiert historische Theorien zur Universalsprache, kritisiert die Vorstellung einer vollkommenen Sprache aus Ecos Sicht, betrachtet die Rolle von Plansprachen (am Beispiel Esperanto), und vergleicht natürliche und künstliche Sprachen. Es werden unter anderem die biblische Sprachverwirrung, philosophische Ansätze im antiken Griechenland, Latein als Weltsprache, mystische Sprachtheorien (jüdisch-kabbalistische Pansemiotik), Dante Alighieris "volgare illustre", Ramon Llulls "Ars Magna" und die monogenetische Hypothese untersucht.
Welche historischen Figuren und ihre Theorien werden im Buch behandelt?
Das Buch behandelt unter anderem die biblische Erzählung vom Turmbau zu Babel, griechische Philosophen und ihre Ansichten zur Sprache, die Rolle des Lateinischen, mystische Sprachtheorien der Kabbala, Dante Alighieris Konzept des "volgare illustre", Ramon Llulls "Ars Magna", und die Debatte um das Hebräische als Ursprache im 16. und 17. Jahrhundert.
Wie ist das Buch strukturiert?
Das Buch ist in Kapitel gegliedert, die sich jeweils mit einem Aspekt der Suche nach einer vollkommenen Sprache befassen. Es beginnt mit einer Einleitung, die Ecos skeptische Position vorstellt. Die weiteren Kapitel untersuchen verschiedene historische und philosophische Ansätze zur Konstruktion einer idealen Sprache. Es gibt Kapitelzusammenfassungen, die die Kernaussagen der einzelnen Kapitel erläutern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Buch?
Schlüsselwörter sind: Vollkommene Sprache, Universalsprache, Esperanto, Sprachverwirrung, Babel, adamitische Ursprache, Plansprache, natürliche Sprache, künstliche Sprache, Linguistik, Semiotik, Kabbala, Dante Alighieri, Ramon Llull, Umberto Eco, Monogenetische Hypothese, Universalgrammatik.
Was ist Ecos zentrale These?
Ecos zentrale These ist eine skeptische Sicht auf die Möglichkeit und den Sinn einer weltumfassenden Sprache, die andere Sprachen überflüssig machen könnte. Er kritisiert die oft idealisierte Vorstellung einer "perfekten" Sprache und analysiert die historischen Versuche, eine solche Sprache zu schaffen oder wiederzufinden, als gescheitert oder zumindest problematisch.
Welche Rolle spielt Esperanto im Buch?
Esperanto dient als Beispiel für eine Plansprache und wird im Kontext der Suche nach einer Universalsprache diskutiert. Es veranschaulicht die Bemühungen, eine künstliche Sprache zu schaffen, die als Mittel zur internationalen Kommunikation dienen soll, im Gegensatz zu den natürlichen Sprachen.
Welche Bedeutung hat die biblische Erzählung vom Turmbau zu Babel?
Die biblische Erzählung vom Turmbau zu Babel wird als Ursprung der Sprachvielfalt betrachtet und analysiert. Eco untersucht die unterschiedlichen Interpretationen dieser Geschichte und ihre Bedeutung für die Suche nach einer verlorenen Ursprache (adamitische Sprache).
Wie wird die monogenetische Hypothese behandelt?
Die monogenetische Hypothese, die von einer einzigen Ursprache ausgeht, wird kritisch analysiert. Eco weist auf die Schwierigkeiten hin, diese Hypothese zu beweisen und betont die ungenaue Unterscheidung zwischen vollkommener und universeller Sprache sowie die unzureichende Trennung zwischen ursprünglicher Sprache und universeller Grammatik.
- Quote paper
- Philip Neuß (Author), 2010, Die Suche nach der vollkommenen Sprache und die Welthilfssprache Esperanto, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288647