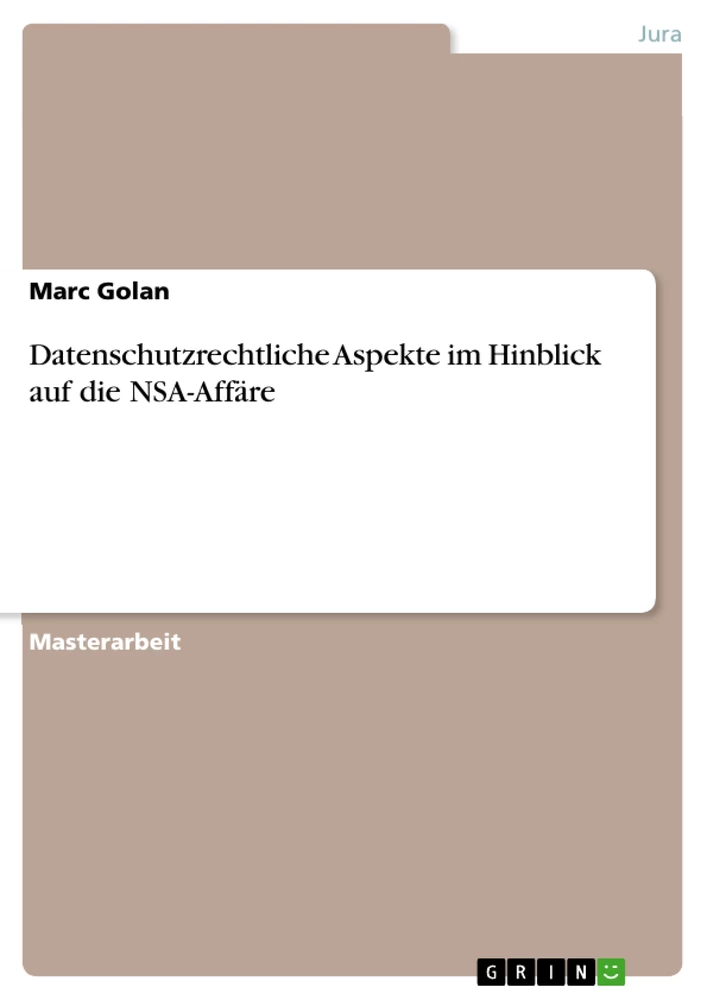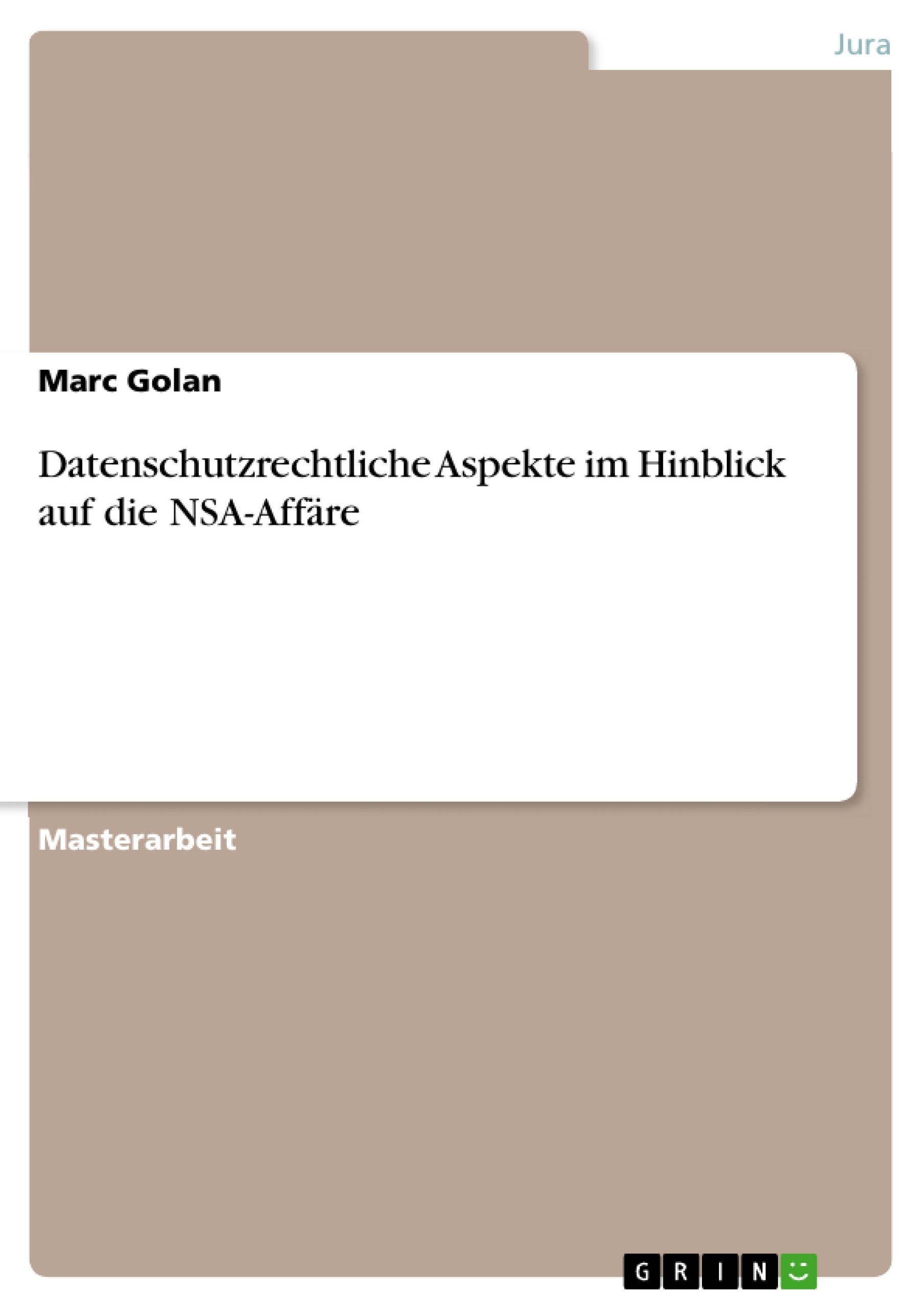Seit ihrem Bekanntwerden 2013 hat die NSA-Affäre zu einer starken medienwirksamen und internationalen Debatte geführt. Verschiedene Faktoren sind dafür verantwortlich. Obwohl grundsätzliche Informationen über Geheimdienste zugänglich sind, haben die konkreten Aufdeckungen große Brisanz. Erstmalig sind weitreichende Details über nachrichtendienstliche Operationen an die Öffentlichkeit gelangt. Der Umfang mancher Aktionen der NSA hat die Dimensionen der Überwachung von Betroffenen durch Geheimdienste aufgezeigt. So werden Millionen von unterschiedlichen Daten weltweit auf verschiedene Weise durch den US-Geheimdienst erhoben und gespeichert. Betroffen sind Metadaten, also z. B. Verbindungsdaten von Webseiten, die eine Person aufgerufen hat, aber auch Inhalte von Telefongesprächen oder E-Mails. Als besonderes Ziel in Europa wird Deutschland am stärksten vom Vorgehen der NSA tangiert.
Nicht nur der Umfang der Handlungen des US-Nachrichtendienstes hat für Aufsehen gesorgt. Umstritten ist auch die Art der Vorgehensweise des US-Geheimdienstes. Abhöraktionen werden aus Botschaften fremder Staaten heraus durchgeführt. Sehr große Datenmengen werden direkt an transatlantischen unterseeischen Glasfaserinternetkabeln abgefangen. Dies sind einige Beispiele, die begründen, weshalb die Spionageaffäre weltweit in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird.
Die Schlüsselfigur in der NSA-Affäre ist Edward Snowden. Durch den ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter ist der Vorfall aufgedeckt worden. Snowden hat geheime Dokumente der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, was unterschiedliche Resonanzen hervorgerufen hat. Die einen sehen in der Veröffentlichung der Dokumente einen wichtigen Schritt zur Aufklärung der Spionageaffäre. Für wieder andere stellen die Dokumente gefährliche Informationen dar, welche nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollten.
Es gilt zu untersuchen, wie die Aktionen der NSA im Hinblick auf Grundrechte und Datenschutzrechte zu bewerten sind. Der Fokus soll dabei auf datenschutzrechtlichen Überlegungen beruhen. In diesem Rechtsrahmen fließen spezialgesetzliche Regelungen für Geheimdienste mit ein, ohne einen Schwerpunkt zu bilden.
Im Hinblick auf die große Debatte in der Öffentlichkeit über die NSA-Affäre stellt sich die Frage, ob vorgenannte Rechte tatsächlich verletzt sind oder partiell solche Handlungen gesetzlich gerechtfertigt werden können. Um das Ziel der Untersuchung zu erreichen, sind verschiedene Schritte notwendig.
Inhaltsverzeichnis
- A Einführung
- B Mögliche Datenschutzrechtsverletzungen durch die Handlungen der NSA
- I. Die NSA-Affäre in ihren Grundzügen
- 1. Zur weltweiten Überwachungs- und Spionageaffäre
- 2. Die Aufdeckung und das an die Öffentlichkeit gelangen der Affäre
- II. Entstehung und Grundsätze des deutschen Datenschutzrechts
- 1. Das verfassungsrechtliche Fundament
- 2. Europäische Richtlinien und internationale Rechtsquellen als Einflüsse
- 3. Das deutsche Datenschutzrecht in Form des BDSG
- III. Verfassungsrechtliche Betrachtung der NSA-Affäre
- 1. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht
- a Einordnung und Grenzen
- b Die Aktionen der NSA in Bezug auf das Persönlichkeitsrecht
- 2. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
- a Inhalt und Formung durch die Rechtsprechung
- b Mögliche Verletzung durch die NSA
- 3. Aspekte des Fernmeldegeheimnisses
- a Spezielle Beschränkungen im Bereich von Geheimdiensttätigkeiten
- b Subsumtion der NSA Operationen unter dem Aspekt der Einschränkungen
- 4. Verwertung der Ergebnisse in Form einer Verhältnismäßigkeitsabwägung
- 5. Zwischenergebnis der verfassungsrechtlichen Einordnung
- IV. Datenschutzrechtliche Untersuchung der NSA-Affäre
- 1. Die NSA als öffentliche oder nicht-öffentliche Stelle
- a Öffentliche Stellen
- b Nicht-öffentliche Stellen
- c Anwendung auf die NSA
- d Zwischenergebnis
- 2. Der spezifisch relevante Horizont des Bundesdatenschutzgesetzes
- a Grundsätze der Datenerhebung
- b Spezialrechtliche Tatbestände
- c Besonderheiten bei der Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland
- 3. Ausgewählte, möglicherweise datenschutzrechtlich problematische Beispiele der NSA-Affäre
- a Die Software „PRISM“
- aa Informationsbezug über Dritte
- bb Einschätzung der Vereinbarkeit mit dem Datenschutzrecht
- b Die NSA-Abhöreinheit „Special Collection Service (SCS)“
- aa Datenerhebung und Übermittlung ins Ausland
- (1) Rechtmäßigkeit der Datenerhebung
- (2) Datenübermittlung ins Ausland
- bb Einklang mit dem Datenschutzrecht
- c Die Überwachung der Internetglasfaserkabel zwischen den verschiedenen Kontinenten – „Tempora“
- d Abschließende Beurteilung der Beispiele
- V. Internationaler Ausblick unter dem Aspekt besonderer Abkommen und Gesetze
- 1. Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Charta der Grundrechte der Europäischen Union
- 2. Das Safe Harbor Abkommen
- 3. Der USA PATRIOT Act
- 4. Zwischenergebnis der internationalen Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die datenschutzrechtlichen Aspekte der NSA-Affäre. Ziel ist es, die Handlungen der NSA im Kontext des deutschen Datenschutzrechts zu analysieren und mögliche Rechtsverletzungen aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet sowohl verfassungsrechtliche Grundlagen als auch die Anwendung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
- Verfassungsrechtliche Grundlagen des Datenschutzes in Deutschland
- Analyse der NSA-Aktivitäten im Hinblick auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
- Anwendung des BDSG auf die Praktiken der NSA
- Relevanz internationaler Abkommen und Gesetze
- Bewertung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen der NSA
Zusammenfassung der Kapitel
A Einführung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Masterarbeit ein und skizziert den Forschungsansatz. Sie umreißt die Bedeutung des Datenschutzes im digitalen Zeitalter und die Relevanz der NSA-Affäre für die Diskussion um staatliche Überwachung.
B Mögliche Datenschutzrechtsverletzungen durch die Handlungen der NSA: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert detailliert die potenziellen Datenschutzrechtsverletzungen durch die Aktionen der NSA. Es beginnt mit einer Darstellung der NSA-Affäre in ihren Grundzügen und beleuchtet die Entstehung und Grundsätze des deutschen Datenschutzrechts. Es untersucht die Handlungen der NSA im Lichte des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und des Fernmeldegeheimnisses. Die Analyse schließt eine umfassende Bewertung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ein. Die Kapitel II, III und IV bilden die detaillierte verfassungsrechtliche und datenschutzrechtliche Analyse der NSA-Affäre.
V Internationaler Ausblick unter dem Aspekt besonderer Abkommen und Gesetze: Dieses Kapitel erweitert die Analyse auf die internationale Ebene. Es untersucht die Vereinbarkeit der NSA-Aktivitäten mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, dem Safe Harbor Abkommen und dem USA PATRIOT Act. Die Analyse berücksichtigt die komplexen Beziehungen zwischen nationalem und internationalem Recht im Bereich des Datenschutzes und stellt deren Auswirkungen auf den deutschen Rechtsrahmen dar.
Schlüsselwörter
Datenschutzrecht, NSA-Affäre, allgemeines Persönlichkeitsrecht, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Fernmeldegeheimnis, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Verhältnismäßigkeit, internationale Abkommen, USA PATRIOT Act, Safe Harbor, staatliche Überwachung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Datenschutzrechtliche Aspekte der NSA-Affäre
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit analysiert die datenschutzrechtlichen Aspekte der NSA-Affäre. Sie untersucht die Handlungen der NSA im Kontext des deutschen Rechts und beleuchtet mögliche Rechtsverletzungen.
Welche Rechtsgebiete werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das deutsche Datenschutzrecht, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), und die relevanten verfassungsrechtlichen Grundlagen, wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Zusätzlich werden internationale Abkommen und Gesetze, wie die Europäische Menschenrechtskonvention, die Charta der Grundrechte der EU, das Safe Harbor Abkommen und der USA PATRIOT Act, berücksichtigt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung und einem Überblick über die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte. Der Hauptteil analysiert detailliert die möglichen Datenschutzrechtsverletzungen durch die NSA-Aktivitäten. Es werden verschiedene Aktionen der NSA, wie z.B. PRISM, der Special Collection Service (SCS) und Tempora, im Detail untersucht. Ein separates Kapitel widmet sich dem internationalen Ausblick und den relevanten Abkommen und Gesetzen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche konkreten NSA-Aktivitäten werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene NSA-Aktivitäten, darunter die Software "PRISM", die Abhöreinheit "Special Collection Service (SCS)" und die Überwachung von Internetglasfaserkabeln ("Tempora"). Die Analyse konzentriert sich darauf, ob diese Aktivitäten mit dem deutschen Datenschutzrecht und den relevanten internationalen Abkommen vereinbar sind.
Welche verfassungsrechtlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das Fernmeldegeheimnis im Kontext der NSA-Aktivitäten. Es wird analysiert, ob diese Grundrechte durch die Handlungen der NSA verletzt wurden.
Welche Rolle spielt das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)?
Das BDSG spielt eine zentrale Rolle in der Analyse. Die Arbeit untersucht, ob die NSA-Aktivitäten den Grundsätzen der Datenerhebung, -verarbeitung und -übermittlung nach dem BDSG entsprechen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Übermittlung personenbezogener Daten ins Ausland.
Welche internationalen Abkommen und Gesetze werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die Europäische Menschenrechtskonvention, die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, das Safe Harbor Abkommen und den USA PATRIOT Act. Die Analyse untersucht die Vereinbarkeit der NSA-Aktivitäten mit diesen internationalen Regelungen.
Wie wird die Verhältnismäßigkeit der NSA-Maßnahmen bewertet?
Die Arbeit bewertet die Verhältnismäßigkeit der NSA-Maßnahmen im Hinblick auf die Eingriffe in Grundrechte und die Einhaltung des Datenschutzrechts. Es wird geprüft, ob die Maßnahmen im Verhältnis zu den verfolgten Zielen standen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Datenschutzrecht, NSA-Affäre, allgemeines Persönlichkeitsrecht, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Fernmeldegeheimnis, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Verhältnismäßigkeit, internationale Abkommen, USA PATRIOT Act, Safe Harbor, staatliche Überwachung.
- Quote paper
- Marc Golan (Author), 2014, Datenschutzrechtliche Aspekte im Hinblick auf die NSA-Affäre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288489