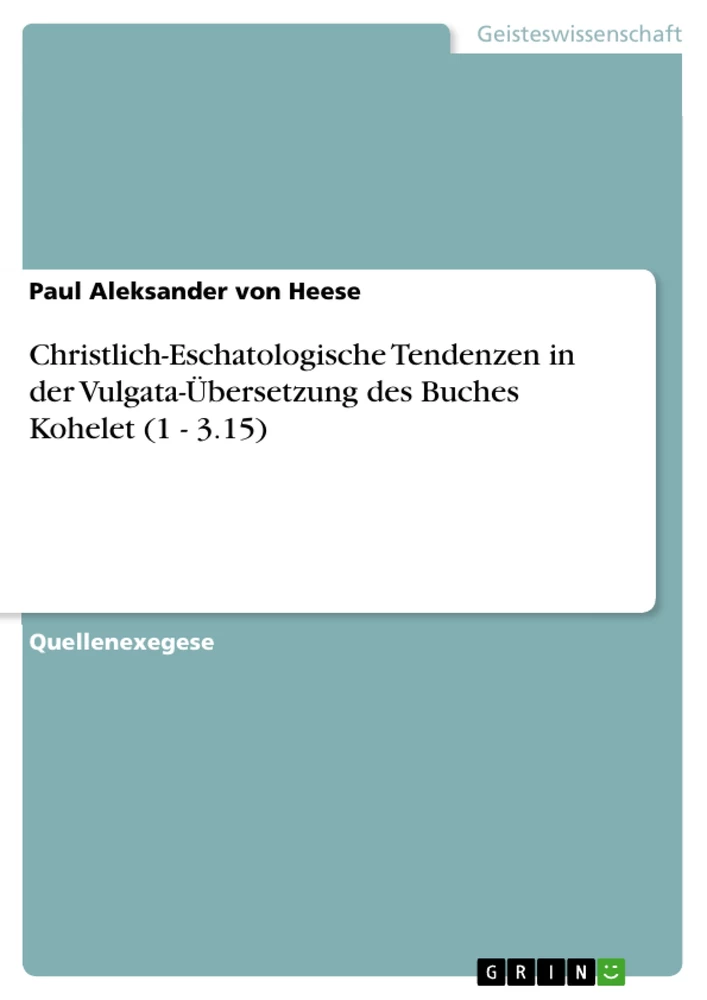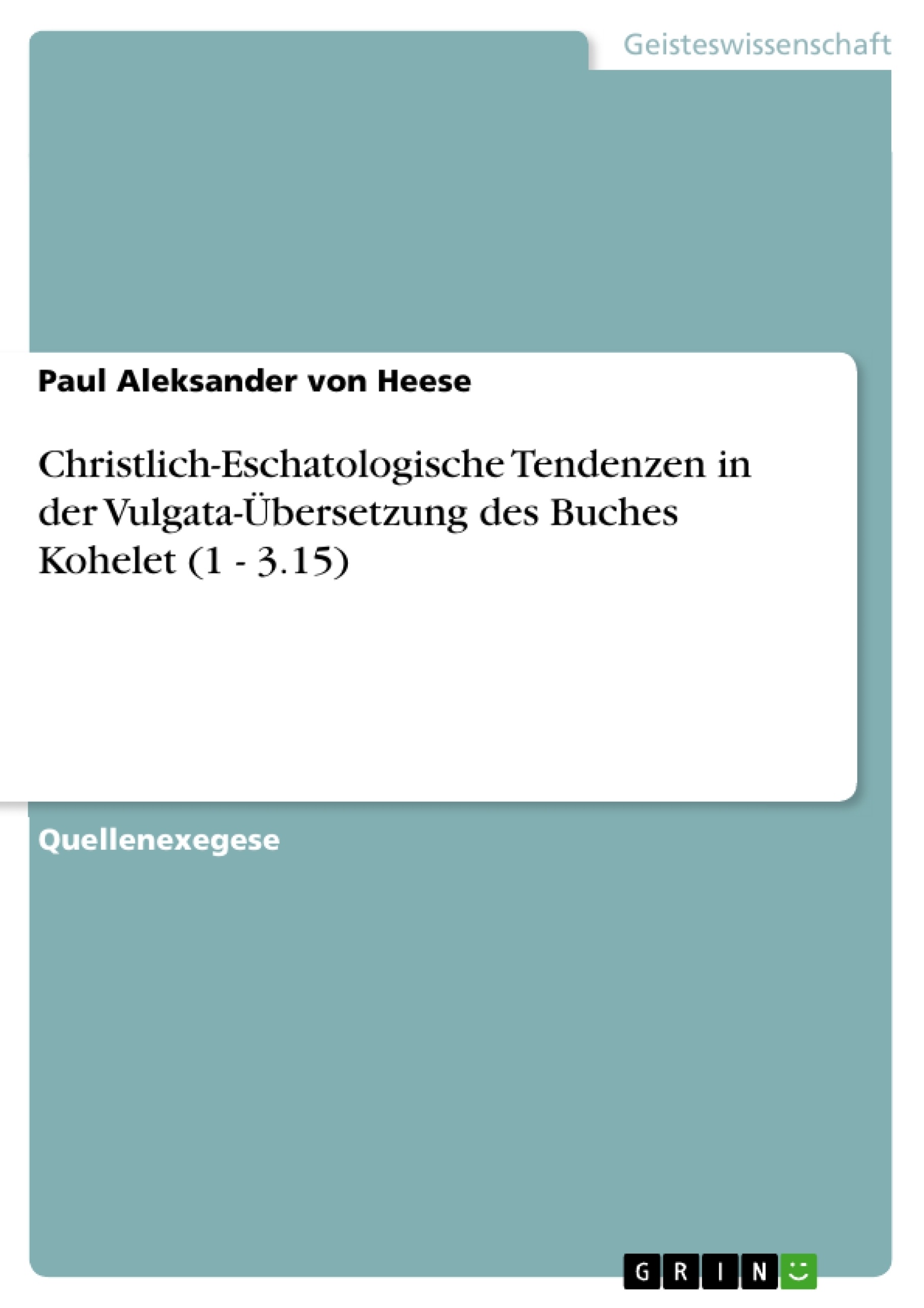Die Frage nach den christologischen Aussagen des Buches Koh ist nicht zufriedenstellend beantwortet. Nach Auffassung vieler Kommentatoren passe Kohelet nicht in den Kanon des AT, was umso mehr die Frage aufdrängt, wie mit dieser Schrift von Seiten der christlichen Übersetzer umgegangen wurde und was die eigentliche Intention des Urhebers von Koh im Gegensatz dazu ist.
Nahezu einstimmig werden in den Meinungen zu Koh Einflüsse von außen (bspw. des Hellenismus) entweder auf dessen Lehre oder zumindest den Urheber dieser Schrift angenommen. Diese Einflüsse von außen sind es, die vielen Lesern des Buches dieses als befremdlich erscheinen ließen - ja sogar teilweise zur unmittelbaren Anzweiflung der Kanonzität von Koh führten, indem Koh als häretische Schrift abgetan wurde. Im Spannungsfeld zwischen authentischer Widergabe des Urtextes und den Lesererwartungen der frühen christlichen Gemeinde (1. – 4. Jh. n. Chr.) bewegten sich Schreiber und Übersetzer des Textes.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu veranschaulichen, wie theologische Tendenzen bei der Übertragung aus dem Hebräischen und Griechischen ins Lateinische in das Textkorpus von Koh impliziert wurden. Insbesondere die große Bedeutung, welche der Vulgata im historischen Verlauf zukommt, gilt deshalb die Aufmerksamkeit: in welcher Weise hat Hieronymus als Übersetzer die aus christlogischer Sicht „bedenklichen“ Textstellen in Bezug auf die Orthodoxie und Orthopraxie des 4 Jh. n.Chr. abgerundet? Als griechische Vorlage dient der Text der LXX, die Hieronymus mit intensivem Gebrauch zur Übersetzung des MT als Hilfestellung herangezogen hatte, für das Lateinische die Vulgata.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Fragestellung
- Entstehungszeit
- Standpunkt 1: 3.–2. Jh. v.Chr.
- Standpunkt 2: 250-190 v.Chr.
- Standpunkt 3: 450-350 v.Chr.
- Eigene Stellungnahme
- Abgrenzung der Textstelle
- Standpunkt 1: Zäsur nach 3,15.
- Standpunkt 2: Zäsur nach 3,22.
- Eigene Stellungnahme
- Übersetzungsvergleich Koh 1,1 – 3,15.
- Hieronymus als Übersetzer von Kohelet
- Textgrundlage
- Kontrastierung auffälliger Abweichungen zwischen LXX und Vulgata
- Jenseitsvorstellungen in Koh.
- Jenseitsvorstellung im 4. Jh. n.Chr. oder ein Erklärungsversuch der unterschiedlich gewählten Begriffe.
- Traduzianismus (tradux = Nachkomme, Sprößling)
- Kreatianismus (creatio = Schöpfung).
- Eine Reminiszenz des Kreatianismus in der Übersetzung des Buches Kohelet
- Identität von spiritus und mens; der Begriff der øvǹ
- In novissimo – die Implementierung einer christlich-eschatologischen Jenseitsvorstellung.
- Schlussworte und Folgerungen.
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der Vulgata-Übersetzung des Buches Kohelet (1-3,15) und untersucht, inwiefern christlich-eschatologische Tendenzen in die Übersetzung des Textes eingeflossen sind. Die Arbeit zielt darauf ab, die Übersetzungsstrategien des Hieronymus im Kontext der frühen christlichen Gemeinde zu beleuchten und die Intention des Autors von Kohelet im Vergleich dazu zu betrachten.
- Die Entstehungszeit des Buches Kohelet und die verschiedenen Standpunkte dazu
- Die Abgrenzung der Textstelle und die unterschiedlichen Interpretationen der Zäsur
- Der Vergleich der LXX und Vulgata-Übersetzung von Kohelet und die auffälligen Abweichungen
- Die Jenseitsvorstellungen in Kohelet und die Implementierung einer christlich-eschatologischen Jenseitsvorstellung in der Vulgata
- Die theologischen Tendenzen, die bei der Übersetzung aus dem Hebräischen und Griechischen ins Lateinische in das Textkorpus von Kohelet impliziert wurden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet die Problematik der christologischen Aussagen des Buches Kohelet. Es wird die Frage aufgeworfen, wie mit dieser Schrift von Seiten der christlichen Übersetzer umgegangen wurde und welche Intention der Urheber von Kohelet im Gegensatz dazu hatte. Die Arbeit untersucht die Einflüsse von außen, insbesondere des Hellenismus, auf die Lehre oder den Urheber von Kohelet und die damit verbundenen Herausforderungen für die Übersetzer.
Das Kapitel "Entstehungszeit" befasst sich mit der Frage nach dem Entstehungszeitpunkt von Kohelet. Es werden die verschiedenen Standpunkte zur Datierung des Buches vorgestellt, die von der salomonischen Zeit bis in die persische Epoche reichen. Die Arbeit analysiert die Argumente für und gegen die verschiedenen Standpunkte und stellt die eigene Stellungnahme dar.
Das Kapitel "Abgrenzung der Textstelle" untersucht die unterschiedlichen Interpretationen der Zäsur im Buch Kohelet. Es werden die Standpunkte vorgestellt, die die Zäsur nach 3,15 oder 3,22 ansetzen. Die Arbeit analysiert die Argumente für und gegen die verschiedenen Standpunkte und stellt die eigene Stellungnahme dar.
Das Kapitel "Übersetzungsvergleich Koh 1,1 – 3,15" vergleicht die LXX und Vulgata-Übersetzung von Kohelet und analysiert die auffälligen Abweichungen. Die Arbeit untersucht die Jenseitsvorstellungen in Kohelet und die Implementierung einer christlich-eschatologischen Jenseitsvorstellung in der Vulgata. Es werden die Übersetzungsstrategien des Hieronymus im Kontext der frühen christlichen Gemeinde beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Buch Kohelet, die Vulgata-Übersetzung, christlich-eschatologische Tendenzen, Hieronymus, Jenseitsvorstellungen, Traduzianismus, Kreatianismus, LXX, Textgrundlage, Übersetzungsvergleich, theologische Tendenzen, frühe christliche Gemeinde, Orthodoxie, Orthopraxie.
- Quote paper
- Paul Aleksander von Heese (Author), 2012, Christlich-Eschatologische Tendenzen in der Vulgata-Übersetzung des Buches Kohelet (1 - 3.15), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288466