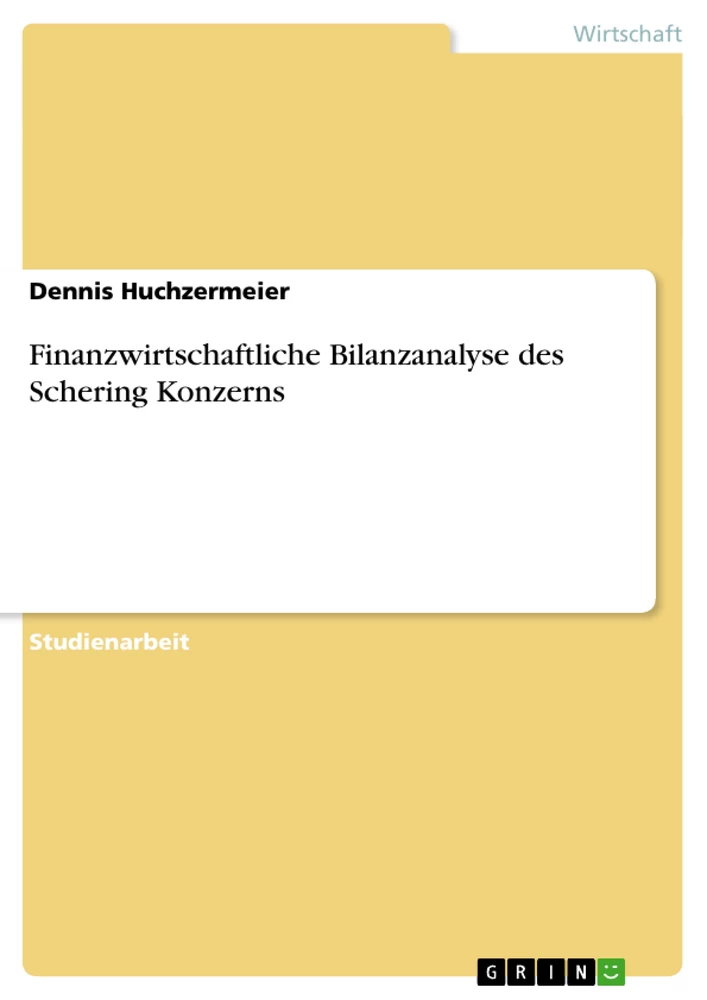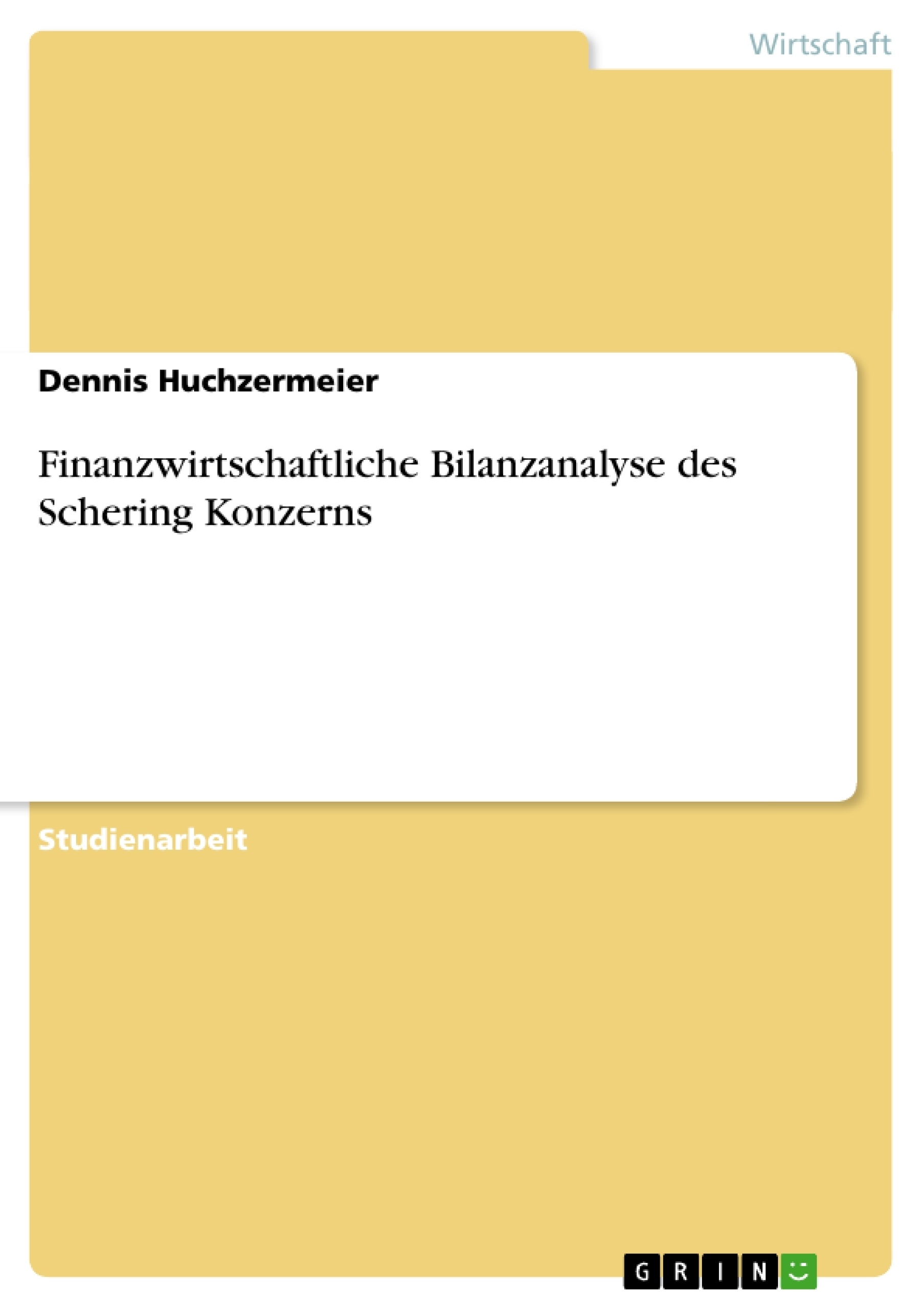Das Thema der folgenden Seminararbeit ist die Analyse der Bilanzen des Schering-Konzerns in den Jahren 2001, 2002 sowie 2003. Danach folgt eine Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, die am Ende zu einem abschließenden Gesamturteil zusammengefasst wird. Die finanzwirtschaftliche Analyse besteht aus der Vermögens- und Kapitalstrukturanalyse sowie der horizontale Bilanzstrukturanalyse (Liquiditätsanalyse). Ausgangspunkt für die Bilanzanalyse bildet eine Strukturbilanz. Diese resultiert aus der Aufbereitung der Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2001 bis 2003. Ziel ist es, vorhandene bilanzielle Ansatz- und Bewertungswahlrechte, Ermessensspielräume sowie Sachverhaltsgestaltungen zu bereinigen, die um Erkenntnisse aus dem Konzernanhang und Konzernlagebericht ergänzt werden. Der Zeitvergleich des Schering-Konzerns wird um den Betriebsvergleich mit den Unternehmen BASF, und Beiersdorf erweitert, wobei einbezogene Kennzahlen dieser beider Unternehmen nicht selbstständig ermittelt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die finanzwirtschaftliche Analyse
- 2.1. Zwecke und Ziele der finanzwirtschaftlichen Analyse
- 2.2. Die Vermögensstrukturanalyse
- 2.2.1. Aufgaben und Ziele der Vermögensstrukturanalyse
- 2.2.2. Die Analyse des Anlagevermögens
- 2.2.2.1. Anlagenintensität
- 2.2.2.2. Anlagenabnutzungsgrad
- 2.2.2.3. Investitionsquote
- 2.2.2.4. Wachstumsrate
- 2.2.3. Die Analyse des Umlaufvermögens
- 2.2.3.1. Umschlaghäufigkeit der Vorräte
- 2.2.3.2. Umschlaghäufigkeit der Forderungen
- 2.3. Die Kapitalstrukturanalyse
- 2.3.1. Aufgaben und Ziele der Kapitalstrukturanalyse
- 2.3.2. Eigenkapitalquote
- 2.3.3. Fremdkapitalstruktur
- 2.3.4. Kapitalumschlaghäufigkeit
- 2.4. Die Horizontale Bilanzstrukturanalyse
- 2.4.1. Aufgaben und Ziele der Horizontalen Bilanzstrukturanalyse
- 2.4.2. Goldene Finanzierungsregeln
- 2.4.3. Anlagendeckungsgrade
- 2.4.4. Liquiditätsgrade und Working Capital
- 3. Zusammenfassendes Teilurteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Bilanzen des Schering-Konzerns der Jahre 2001 bis 2003. Ziel ist die umfassende Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Fokus liegt auf der Anwendung finanzwirtschaftlicher Analysemethoden zur Ermittlung der finanziellen Stabilität.
- Vermögensstrukturanalyse des Schering-Konzerns
- Kapitalstrukturanalyse des Schering-Konzerns
- Horizontale Bilanzstrukturanalyse (Liquiditätsanalyse)
- Vergleich mit BASF und Beiersdorf (basierend auf bereitgestellten Kennzahlen)
- Gesamtbeurteilung der finanziellen Lage des Konzerns
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Gegenstand der Arbeit: die finanzwirtschaftliche Analyse der Bilanzen des Schering-Konzerns für die Jahre 2001 bis 2003. Es wird erläutert, dass die Analyse die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage umfasst und in einem abschließenden Gesamturteil mündet. Die Methodik beinhaltet die Vermögens- und Kapitalstrukturanalyse sowie die horizontale Bilanzstrukturanalyse (Liquiditätsanalyse). Die Analyse basiert auf den Jahresabschlüssen und wird durch Informationen aus dem Konzernanhang und Konzernlagebericht ergänzt. Ein Vergleich mit BASF und Beiersdorf wird angedeutet, wobei die Kennzahlen dieser Unternehmen extern bereitgestellt werden.
2. Die finanzwirtschaftliche Analyse: Dieses Kapitel stellt den Kern der Arbeit dar. Es beginnt mit der Definition und den Zielen der finanzwirtschaftlichen Analyse, welche die Kapitalverwendung (Vermögensstruktur) und die Kapitalherkunft (Finanzierungsstruktur) sowie deren Zusammenhänge untersucht. Die Analyse gliedert sich in drei Teilbereiche: Vermögensstrukturanalyse, Kapitalstrukturanalyse und horizontale Bilanzstrukturanalyse. Jeder Teilbereich wird im Detail behandelt, unter Verwendung von Kennzahlen und deren Interpretation für den Fall des Schering Konzerns.
Schlüsselwörter
Finanzwirtschaftliche Analyse, Schering Konzern, Vermögensstrukturanalyse, Kapitalstrukturanalyse, Horizontale Bilanzstrukturanalyse, Liquiditätsanalyse, Bilanzanalyse, Jahresabschluss, Kennzahlen, BASF, Beiersdorf.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Finanzwirtschaftliche Analyse des Schering-Konzerns
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die Bilanzen des Schering-Konzerns der Jahre 2001 bis 2003. Ziel ist eine umfassende Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns mittels finanzwirtschaftlicher Analysemethoden.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet die Vermögensstrukturanalyse, die Kapitalstrukturanalyse und die horizontale Bilanzstrukturanalyse (Liquiditätsanalyse). Diese Analysen basieren auf den Jahresabschlüssen des Schering-Konzerns, ergänzt durch Informationen aus dem Konzernanhang und Konzernlagebericht. Ein Vergleich mit BASF und Beiersdorf (basierend auf extern bereitgestellten Kennzahlen) wird ebenfalls durchgeführt.
Welche Aspekte der finanziellen Lage werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Vermögensstruktur (z.B. Anlagenintensität, Anlagenabnutzungsgrad, Umschlaghäufigkeit von Vorräten und Forderungen), die Kapitalstruktur (z.B. Eigenkapitalquote, Fremdkapitalstruktur, Kapitalumschlaghäufigkeit) und die Liquidität (horizontale Bilanzstrukturanalyse, Liquiditätsgrade, Working Capital). Die Arbeit bewertet die finanzielle Stabilität des Konzerns.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur finanzwirtschaftlichen Analyse (mit Unterkapiteln zu Vermögensstruktur, Kapitalstruktur und horizontaler Bilanzstrukturanalyse), und ein zusammenfassendes Teilurteil. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Kennzahlen werden verwendet?
Die Arbeit verwendet zahlreiche Kennzahlen der Finanzwirtschaft, darunter Anlagenintensität, Anlagenabnutzungsgrad, Investitionsquote, Wachstumsrate, Umschlaghäufigkeit von Vorräten und Forderungen, Eigenkapitalquote, Fremdkapitalstruktur, Kapitalumschlaghäufigkeit, Anlagendeckungsgrade und Liquiditätsgrade. Die spezifischen Kennzahlen und ihre Interpretation im Kontext des Schering-Konzerns werden im Hauptteil detailliert dargestellt.
Warum werden BASF und Beiersdorf zum Vergleich herangezogen?
Der Vergleich mit BASF und Beiersdorf dient als Benchmark und ermöglicht eine Einordnung der finanziellen Lage des Schering-Konzerns in den Kontext der Branche. Die dafür verwendeten Kennzahlen werden extern bereitgestellt.
Was ist das Ergebnis der Analyse?
Das Ergebnis der Analyse ist eine umfassende Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Schering-Konzerns für den Zeitraum 2001 bis 2003, die in einem abschließenden Gesamturteil zusammengefasst wird. Die Arbeit zeigt die Stärken und Schwächen der finanziellen Situation des Unternehmens auf.
- Quote paper
- Dennis Huchzermeier (Author), 2004, Finanzwirtschaftliche Bilanzanalyse des Schering Konzerns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28803