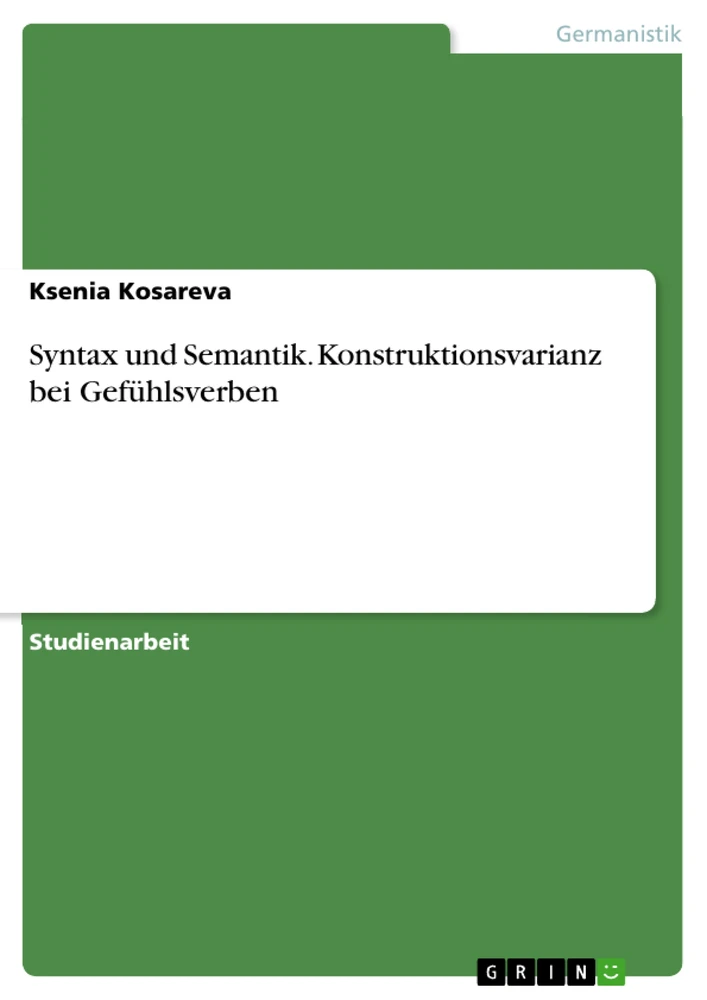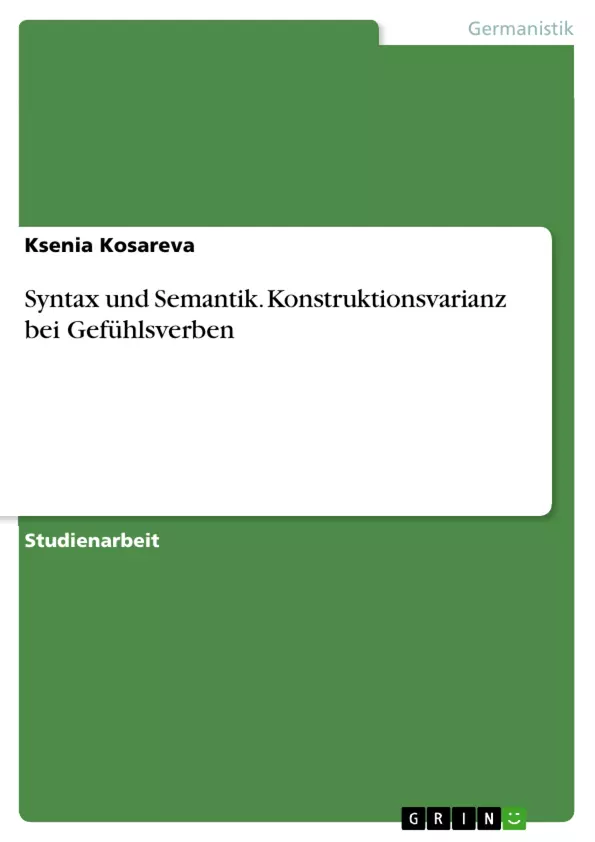Der Zusammenhang zwischen Semantik und Syntax steht heutzutage im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Diskussion. Mehrere Theorien nehmen sich zum Ziel, Probleme der Syntax-Semantik-Schnittstelle zu untersuchen. Eine der interessantesten Fragen ist die der Zuordnung von thematischen Rollen zu syntaktischen Funktionen im Satz.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Problemfall, der das 1:1-Verhältnis zwischen Syntax und Semantik in Frage stellt und zwar: Konstruktionsvarianz bei psychologischen Verben.
Unter psychologischen Verben (psychische Verben, psych-Verbs) im engeren Sinne versteht man Gefühlsverben wie ängstigen, fürchten, bewundern, lieben, hassen, anhimmeln, gefallen, mögen. Diese Verben bezeichnen Emotionen, Gefühle, psychische Zustände
Aus der Bedeutung psychologischer Verben folgern 2 Argumente: Experiencer (Wahrnehmer) und Stimulus (Reiz, Auslöser)
(1) a) Maria fürchtet Hans.
b) Hans ängstigt Maria.
In Bezug auf Ereignisstruktur zeichnen sich psychologische Verben dadurch aus, dass sie eine Konstruktionsvarianz aufweisen. Wenn man Beispielsätze 1a und 1b vergleicht, stellt man fest, dass zwei partiell synonymische Verben unterschiedliche Realisierungsmöglichkeiten haben. Im Satz 1a tritt Experiencer als Satzsubjekt auf, im Satz 1b wird Experiencer in der Objektposition realisiert.
In dieser Hinsicht sind psychologische Verben ein Problem für Argumentselektion.
Aufgrund der Unterschiede in der Argumentrealisierung unterscheidet man 2 Klassen der psychologischen Verben:
• fürchten-Verben, Experiencer-Subjekt- oder Experiencer-Stimulus-Verben (weiter E-S-Verben): lieben, mögen, hassen, bewundern, fürchten, verabscheuen.
• ängstigen-Verben, Experiencer-Objekt- oder Stimulus-Experiencer-Verben (weiter S-E-Verben): ängstigen, überraschen, langweilen, nerven, ermüden, aufregen.
Es stellt sich die Frage, warum diese Verben, die auf den ersten Blick gleiche Situationen bezeichnen und gleiche Argumente implizieren, verschiedene syntaktische Realisierungsmuster haben.
Diese Frage wird in den Aufsätzen von Dowty, Grimshaw, Van Voorst, Marin/McNally behandelt. Diese Ansätze bilden die wissenschaftliche Grundlage dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Psychologische Verben in der wissenschaftlichen Diskussion
- 3. Kritik an Aufsatz von Van Voorst (1992)
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konstruktionsvarianz bei psychologischen Verben im Deutschen, ein Phänomen, das das 1:1-Verhältnis zwischen Syntax und Semantik in Frage stellt. Sie analysiert verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung dieser Varianz und bewertet deren Stärken und Schwächen.
- Konstruktionsvarianz bei psychologischen Verben
- Theorien der Argumentselektion (Dowty, Grimshaw)
- Ereignisstruktur psychologischer Verben
- Kritische Auseinandersetzung mit der Theorie von Van Voorst
- Unterschiedliche Aktionsarten und deren Einfluss auf die Syntax
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Konstruktionsvarianz bei psychologischen Verben ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen dieser Varianz dar. Sie erläutert die Bedeutung des Problems für die Syntax-Semantik-Schnittstelle und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Psychologische Verben in der sprachwissenschaftlichen Diskussion: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene wissenschaftliche Ansätze zur Erklärung der Konstruktionsvarianz bei psychologischen Verben. Es werden die Theorien von Dowty (mit seinen Proto-Rollen), Grimshaw, Van Voorst und McNally/Marin vorgestellt, wobei deren unterschiedliche Perspektiven auf die Rolle der Ereignisstruktur und Aktionsart herausgestellt werden. Der Fokus liegt auf der Darstellung der verschiedenen theoretischen Positionen und ihrer jeweiligen Herangehensweise an das Problem der Argumentrealisierung.
3. Kritik an Aufsatz von Van Voorst (1992): Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Auseinandersetzung mit der Theorie von Van Voorst. Im Gegensatz zu anderen Ansätzen argumentiert Van Voorst, dass psychologische Verben innerhalb ihrer Klasse keine aspektuellen Unterschiede aufweisen. Das Kapitel analysiert die Argumentation von Van Voorst und diskutiert kritisch die Stärken und Schwächen seiner ereignisstrukturellen Diagnostiken im Kontext der Konstruktionsvarianz bei psychologischen Verben. Es wird detailliert auf die gegensätzlichen Positionen eingegangen und ein Vergleich der verschiedenen Ansätze vorgenommen.
Schlüsselwörter
Psychologische Verben, Konstruktionsvarianz, Argumentselektion, Ereignisstruktur, Aktionsart, Syntax-Semantik-Schnittstelle, Dowty, Grimshaw, Van Voorst, McNally/Marin, Proto-Rollen.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über Konstruktionsvarianz bei psychologischen Verben
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Konstruktionsvarianz bei psychologischen Verben im Deutschen. Dies bedeutet, dass sie sich mit der Frage beschäftigt, warum psychologische Verben auf unterschiedliche Weisen syntaktisch realisiert werden können, obwohl sie semantisch ähnlich sind. Das 1:1-Verhältnis zwischen Syntax und Semantik wird dadurch in Frage gestellt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung dieser Varianz und bewertet deren Stärken und Schwächen. Sie untersucht insbesondere Theorien der Argumentselektion und die Rolle der Ereignisstruktur und Aktionsart psychologischer Verben.
Welche Theorien werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Theorien von Dowty (mit seinen Proto-Rollen), Grimshaw, Van Voorst und McNally/Marin. Diese Theorien werden vorgestellt und miteinander verglichen, wobei ihre unterschiedlichen Perspektiven auf die Rolle der Ereignisstruktur und Aktionsart hervorgehoben werden.
Welche Rolle spielt Van Voorsts Theorie (1992)?
Ein ganzes Kapitel ist der kritischen Auseinandersetzung mit der Theorie von Van Voorst gewidmet. Van Voorst argumentiert, dass psychologische Verben innerhalb ihrer Klasse keine aspektuellen Unterschiede aufweisen. Die Arbeit analysiert seine Argumentation und diskutiert kritisch die Stärken und Schwächen seiner ereignisstrukturellen Diagnostiken im Kontext der Konstruktionsvarianz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über psychologische Verben in der sprachwissenschaftlichen Diskussion, ein Kapitel mit Kritik an Van Voorsts Theorie (1992) und eine Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Psychologische Verben, Konstruktionsvarianz, Argumentselektion, Ereignisstruktur, Aktionsart, Syntax-Semantik-Schnittstelle, Dowty, Grimshaw, Van Voorst, McNally/Marin, Proto-Rollen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist die nach den Ursachen der Konstruktionsvarianz bei psychologischen Verben im Deutschen.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und die Forschungsfrage formuliert. Es folgt ein Kapitel, das verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung der Konstruktionsvarianz vorstellt. Ein weiteres Kapitel widmet sich der kritischen Auseinandersetzung mit der Theorie von Van Voorst. Abschließend fasst die Arbeit die Ergebnisse zusammen.
- Arbeit zitieren
- M.A. Ksenia Kosareva (Autor:in), 2012, Syntax und Semantik. Konstruktionsvarianz bei Gefühlsverben, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287796