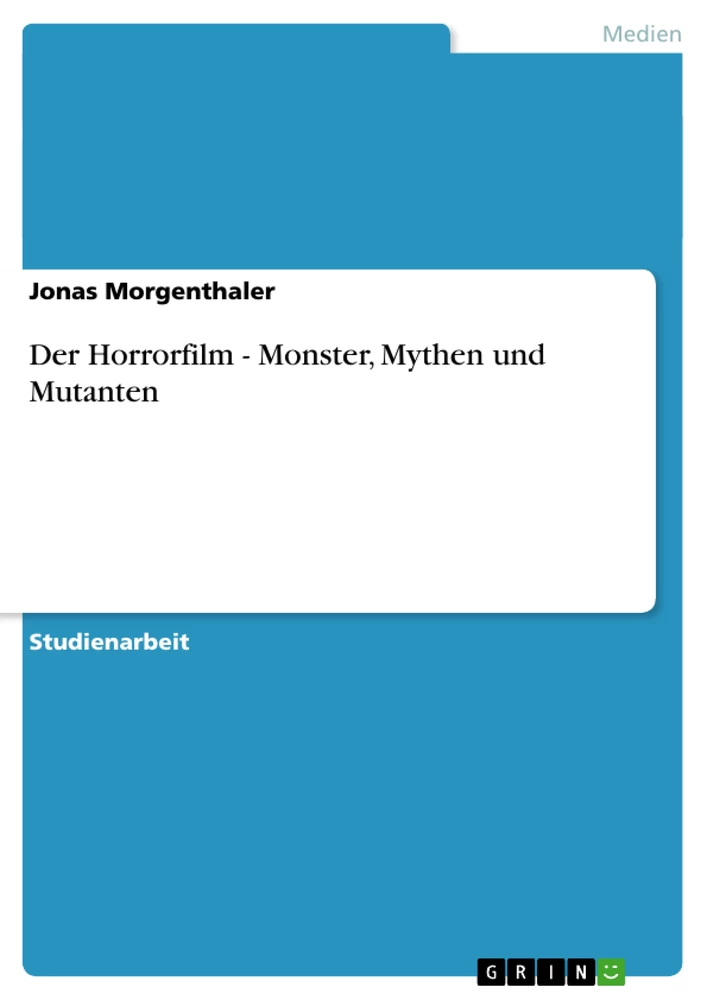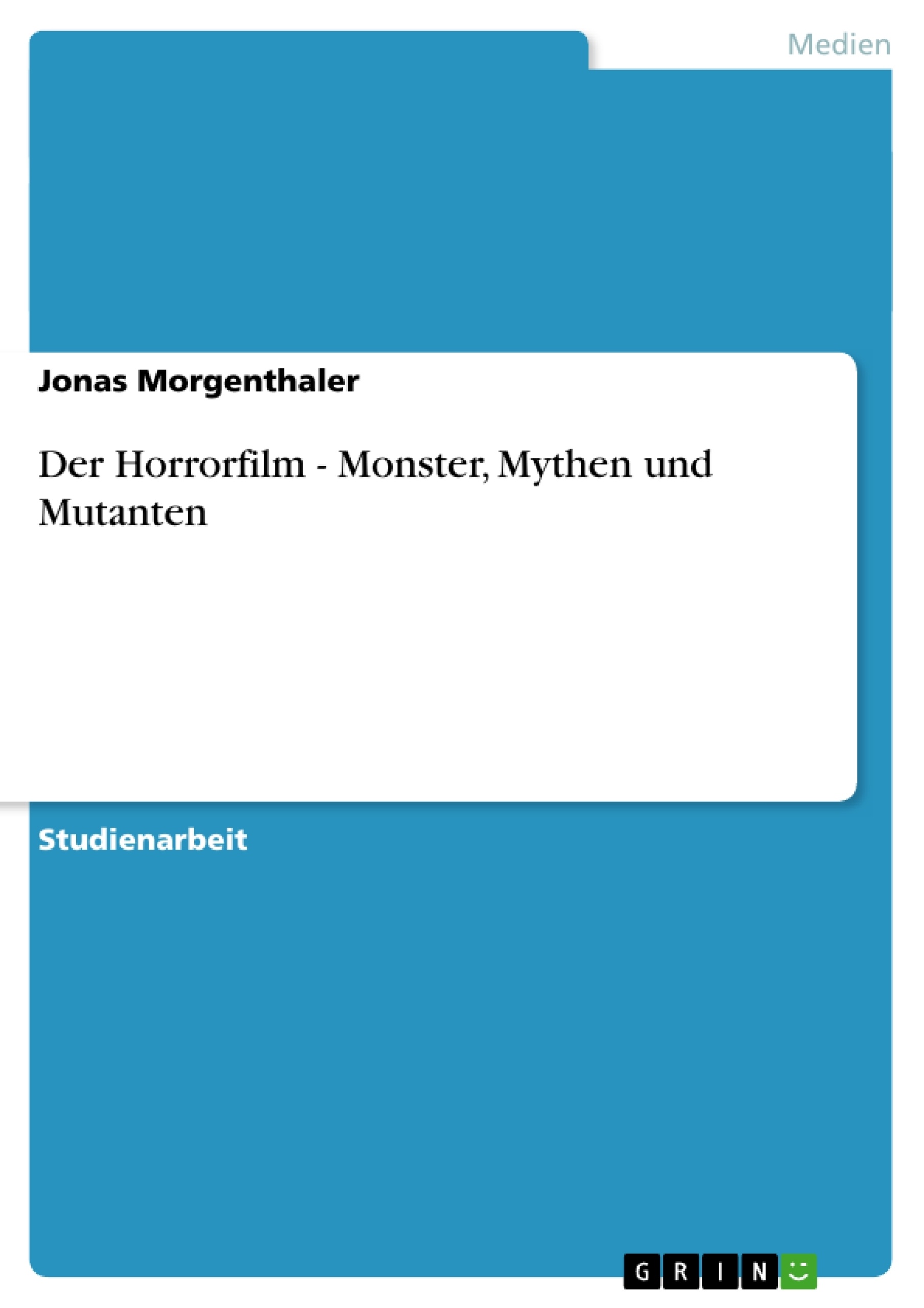„There is some fascination, surely, when I am moved by the mere presence of such a one, even lying as she lay in a tomb fretted with age and heavy with the dust of cenuries, though there be that horrid odour such as the lairs of the Count have had. Yes, I was moved – I, Van Helsing, with all my purpose and with my motive of hate – I was moved to a yearning for delay which seemed to paralyse my faculties and to clog my very soul.“ (aus: Bram Stoker, Dracula, S.439).
Die Faszination, die sogar der Vampirjäger Van Helsing gegenüber einer im Tagesschlaf liegenden Vampirin verspürt, steht sinnbildlich für die Faszination des Menschen am Horror, am Andersartigen und Dunklen. Obschon er durch seinen Verstand, seine Erfahrung und dem üblen Todesgeruch abgestossen sein sollte vom halbtoten Wesen im Sarg, macht eine nicht fassbare Anziehungskraft diese rationellen Überlegungen zunichte. Und so pendelt auch der Mensch zwischen Ekel und Faszination, zwischen existentieller Angst und genussvollem Schauder angesichts des fiktiven Horrors in Büchern, Filmen und anderswo.
Diese Arbeit will unter anderem versuchen, diese ambivalenten Gefühle am Beispiel des Horrorfilms zu untersuchen und verschiedene Einordnungs- und Erklärungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die sich häufig widersprechenden oder ganz unterschiedliche Perspektiven einnehmenden Theorieansätze werden dabei möglichst sinnvoll integriert, um einen Überblick über das Themengebiete zu geben. Zuerst wird das Genre definiert, danach wird in drei Phasen dessen Entwicklung nachgezeichnet.
Desweiteren beschäftigt sich die Arbeit mit Theorieansätzen und möglichen Interpretationsversuchen des Horrorfilm-Genres, sowohl psychologischen wie auch gesellschaftlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Definition
- Genreentwicklung
- Ursprung
- Die klassische Periode 1919 - 1960
- Die Periode der Auflösung und der Pluralisierung 1960 – 2003
- Theorieansätze und Deutungsversuche
- Allgemein
- Psychologische und psychoanalytische Ansätze
- Gesellschaftlich orientierte Ansätze
- Schlussbemerkungen
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ambivalenten Gefühle, die der Horrorfilm beim Zuschauer auslöst – Faszination und Ekel, Angst und Schaudern. Sie beleuchtet verschiedene Ansätze zur Einordnung und Erklärung dieser Reaktionen. Die Arbeit integriert unterschiedliche, teilweise widersprüchliche theoretische Perspektiven, um einen umfassenden Überblick über das Genre zu bieten.
- Definition des Horrorfilm-Genres und seine Schwierigkeiten
- Entwicklung des Horrorfilms über die Zeit
- Psychologische und psychoanalytische Interpretationen des Horrors
- Gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse auf das Genre
- Die Rolle des Monsters im Horrorfilm
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Arbeit beginnt mit der Darstellung der ambivalenten Faszination des Menschen für das Horrorgenre, illustriert am Beispiel von Van Helsings Reaktion auf eine Vampirin. Sie skizziert die Zielsetzung: die Untersuchung dieser ambivalenten Gefühle am Beispiel des Horrorfilms und die Präsentation verschiedener Erklärungsansätze. Die Struktur der Arbeit wird umrissen, mit Fokus auf Definition, Genreentwicklung und theoretische Ansätze.
2. Definition: Dieses Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten, das Horrorfilm-Genre präzise zu definieren. Es werden verschiedene Definitionen von Autoren wie Noël Carrol (Fokus auf die beabsichtigte Wirkung des Horrors) und Georg Seesslen/Claudius Weil (Betonung des Halbwesens und des Phantastischen) vorgestellt und kritisch diskutiert. Die Arbeit argumentiert gegen eine zu restriktive Definition und wählt einen eher umfassenden Ansatz, der auch neuere Filme berücksichtigt, die über die Grenzen des klassischen Monsterfilms hinausgehen.
3. Genreentwicklung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Horrorfilms. Es wird der Ursprung des Genres in mündlichen Erzählungen und der Gothic Novel erörtert und der historische Überblick auf dem Werk von Paul Wells basiert. Die Entwicklung wird in verschiedene Perioden unterteilt, wobei die Arbeit die unterschiedlichen Phasen und ihre charakteristischen Merkmale beleuchtet.
Schlüsselwörter
Horrorfilm, Genreanalyse, Genreentwicklung, Monster, Mythen, Psychoanalyse, Gesellschaftliche Ansätze, Faszination, Ekel, Angst, Theorieansätze, Filmgeschichte, Definition, Subgenres.
Häufig gestellte Fragen (FAQs): Analyse des Horrorfilm-Genres
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Analyse des Horrorfilm-Genres. Sie beinhaltet eine Einführung, eine Definition des Genres, die Entwicklung des Genres über die Zeit, verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung der Wirkung von Horrorfilmen, sowie eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel und eine Literaturliste (nicht im HTML-Auszug enthalten). Der Fokus liegt auf der ambivalenten Wirkung von Horrorfilmen – Faszination und Ekel, Angst und Schaudern – und den verschiedenen Erklärungsansätzen dafür.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Definition des Horrorfilm-Genres und die damit verbundenen Schwierigkeiten, die Entwicklung des Genres von seinen Ursprüngen bis in die Gegenwart, psychologische und psychoanalytische Interpretationen des Horrors, gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse auf das Genre, und die Rolle des Monsters im Horrorfilm. Die Arbeit integriert unterschiedliche, teilweise widersprüchliche theoretische Perspektiven.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Eine Einführung, ein Kapitel zur Definition des Genres, ein Kapitel zur Genreentwicklung (inklusive Ursprung, klassischer Periode und Periode der Auflösung/Pluralisierung), ein Kapitel zu Theorieansätzen (allgemein, psychologisch/psychoanalytisch und gesellschaftlich orientiert) und Schlussbemerkungen. Jedes Kapitel wird in der HTML-Vorschau kurz zusammengefasst.
Welche theoretischen Ansätze werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht verschiedene theoretische Ansätze, darunter psychologische und psychoanalytische Ansätze sowie gesellschaftlich orientierte Ansätze, um die Wirkung von Horrorfilmen zu erklären. Sie berücksichtigt dabei auch unterschiedliche, teilweise widersprüchliche Perspektiven.
Welche Schwierigkeiten bei der Definition des Genres werden angesprochen?
Die Arbeit hebt die Schwierigkeiten hervor, das Horrorfilm-Genre präzise zu definieren. Sie diskutiert verschiedene Definitionen und argumentiert gegen einen zu restriktiven Ansatz. Sie berücksichtigt auch neuere Filme, die über die Grenzen des klassischen Monsterfilms hinausgehen.
Welche Perioden der Genreentwicklung werden unterschieden?
Die Genreentwicklung wird in verschiedene Perioden unterteilt: den Ursprung des Genres, die klassische Periode (1919-1960) und die Periode der Auflösung und Pluralisierung (1960-2003). Jede Periode wird mit ihren charakteristischen Merkmalen beschrieben.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Horrorfilm, Genreanalyse, Genreentwicklung, Monster, Mythen, Psychoanalyse, Gesellschaftliche Ansätze, Faszination, Ekel, Angst, Theorieansätze, Filmgeschichte, Definition, Subgenres.
- Quote paper
- Jonas Morgenthaler (Author), 2003, Der Horrorfilm - Monster, Mythen und Mutanten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28776