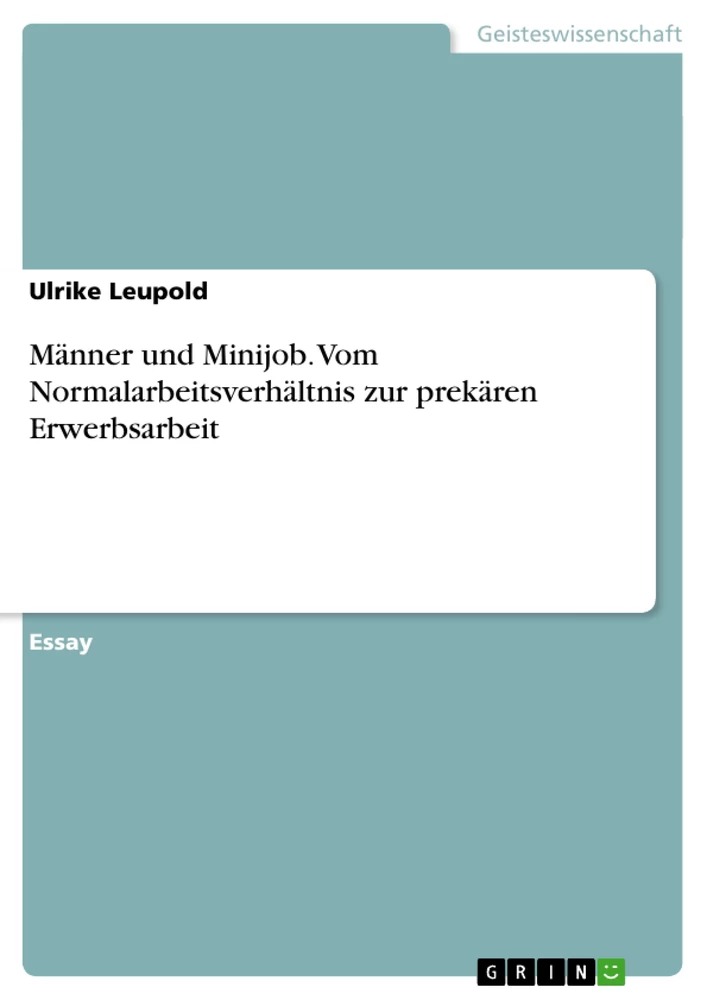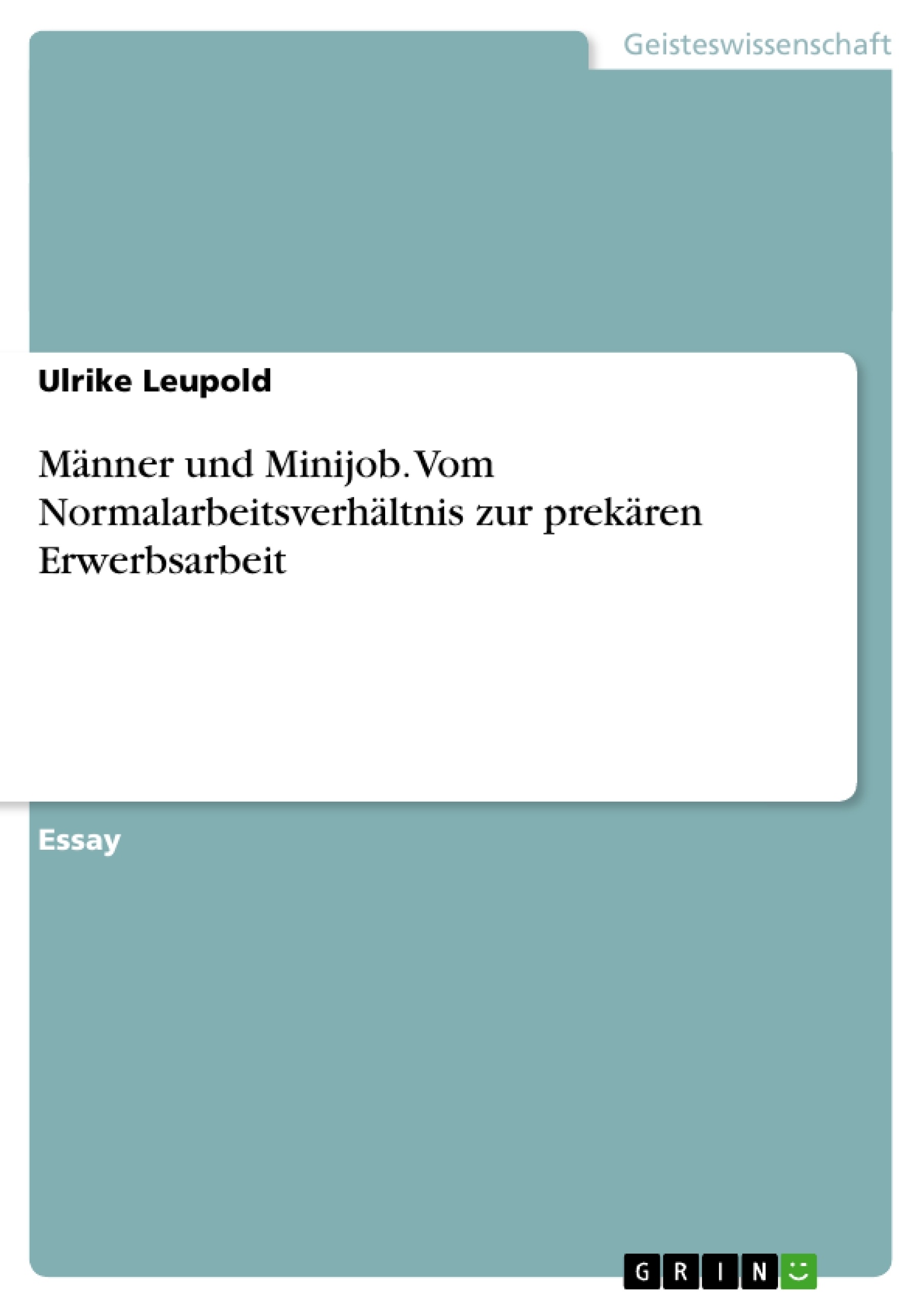Die reguläre, 'normale' Erwerbsarbeit wurde und wird immernoch mit einer Ausübung spezifischer Sicherheitsgarantien und Rechtsansprüche in Verbindung gebracht, die eine stabile gesellschaftliche Statusposition begründen. Statt ihrer breiten sich ,,prekäre Erwerbsformen wie Zeit- und Leiharbeit, befristete Beschäftigung, Minijobs, abhängige Selbstständigkeit oder Teilzeit"aus. Für die Männer unserer Gesellschaft kann dieser Wandel auf dem Arbeitsmarkt eine immense Bedeutung mit sich bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Stünde man vor der Aufgabe, sich einen richtig typischen Mann in seinem ganzen Ursprung vorzustellen, so hätte man bald ein Bild im Kopf: Einen Mann, der schwer arbeitet, tagelang schwitzt und ackert, um seine Familie zu ernähren.
- Früher, zu Zeiten der Industrialisierung und auch in der Moderne, war dieses Bild gang und gäbe.
- Doch auch wenn es heute noch in unseren Köpfen fortlebt, so ist es nicht mehr das, was wir tagtäglich im 21.Jahrhundert in wohlhabenden Industrienationen zu Gesicht bekommen.
- Stattdessen führen Transformationsprozesse seit den 70er Jahren mehr und mehr zu einer weniger vollzeitlich kontinuierlichen Erwerbsarbeit¹.
- Das lange Zeit bewährte industriegesellschaftliche Normalarbeitsverhältnis wird im Rahmen betrieblicher Rationalisierungsstrategien abgebaut eine Folge von Ökonomisierung und Vermarktlichung².
- Die reguläre, 'normale' Erwerbsarbeit wurde und wird immernoch mit einer Ausübung spezifischer Sicherheitsgarantien und Rechtsansprüche in Verbindung gebracht, die eine stabile gesellschaftliche Statusposition begründen³.
- Statt ihrer breiten sich „prekäre Erwerbsformen wie Zeit- und Leiharbeit, befristete Beschäftigung, Minijobs, abhängige Selbstständigkeit oder Teilzeit aus.
- Diese gelten zumeist als prekär, da sie die für ein „Normalarbeitsverhältnis charakteristischen sozialen, rechtlichen und betrieblichen Standards“ unterschreiten.
- Demzufolge kann von prekärer Arbeit gesprochen werden, „wenn sich die Erwerbslage von anderen, als 'normal' oder 'regulär' wahrgenommenen Beschäftigungsverhältnissen durch strukturelle Benachteiligungen unterscheidet, die den Zugang zu Ressourcen und Rechten sowie die Zuschreibung von Anerkennung betreffen“. Darin inbegriffen sind soziale Unsicherheitserfahrungen, die desintegrierend wirken und befristete Arbeitsverträge, die eine längerfristige Planungssicherheit für den eigenen Lebensentwurf blockieren'.
- Prekäre Arbeit kann zu einer berufsbiographischen Bedrohung heranwachsen, die 1,Unsicherheit und Diskontinuität schafft und letztendlich soziale Desintegration begünstigt.
- Für die Männer unserer Gesellschaft kann dieser Wandel auf dem Arbeitsmarkt eine immense Bedeutung mit sich bringen.
- Trotz der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses und der damit einhergehenden finanziellen Unsicherheit, halten Männer an diesem Punkt der Identitätsbildung fest, was zu Unsicherheiten in der Identitätsbildung von Männern führen kann.
- Zuweilen wird dieser Vorgang als 'Krise der Männlichkeit' bezeichnet.
- Michael Meuser charakterisiert ein spezifisches Männlichkeitskonstrukt, das sich zu Zeiten der Industrialisierung herausbildete, wie folgt: „eine Ausrichtung auf lebenslange, kontinuierliche und die materielle Existenz sichernde Erwerbsarbeit, eine hohe Identifikation mit dem Beruf […]. In seinem Kern ist das Männlichkeitskonstrukt von einer Berufsorientierung bestimmt, während die Familienorientierung sekundär ist.
- Gleichwohl aber sind Beruf und Familie über die Position des Familienernährers in einer hierarchisierenden Weise miteinander verknüpft“10.
- Dieses Männlichkeitskonstrukt ist sehr zählebig und die Erwerbsarbeit bildet nach wie vor den zeitlichen Schwerpunkt im Leben eines Mannes.
- Grundlegend hat sich an diesen Vorstellungen von Arbeit und Leben nichts geändert, auch wenn Männer mittlerweile deutlich präsenter in Haushalt und Familie sind".
- Im Rahmen einer Studie über mittlere Führungskräfte fanden Behnke und Liebold heraus, dass die interviewten Personen Arbeit als etwas 'Gesamtes' sehen - Arbeit und Leben sollen sich gegenseitig durchdringen.
- Im Gegensatz dazu bildet die Familie für den arbeitenden Mann eine emotionale Absicherung, Kontrollinstanz, Sinnstiftung und soziale Ressource¹²
- Mithilfe der Erwerbsarbeit ist es dem Individuum möglich, sich im sozialen Raum zu positionieren.
- Die Erwerbsarbeit hat für den Einzelnen demnach eine identitätsstiftende Bedeutung 13.
- Vorrangig im Bereich der Ausbildungs- und Berufslaufbahn werden Identität und Geschlecht entworfen.
- So kann der Verlust von Erwerbsarbeit durchaus zu einer Verunsicherung von männlicher Identität führen¹. 8 Vgl. Kraemer, Klaus u.a., Prekarisierung von Erwerbsarbeit. Zur Transformation des arbeitsweltlichen Integrationsmodus, in: W.Heitmeyer u. P.Imbusch (Hg.), Integrationspotenziale einer modernen Gesellschaft. Analysen zu gesellschaftlicher Integration und Desintegration, Wiesbaden 2005, S.380.
- Männlichkeit ist mit Erwerbsarbeit strukturell und symbolisch verknüpft.
- Das bewährte und bekannte Ernährerleitbild ist fest in die Institutionen Familie und Arbeitsmarkt eingeschrieben und hat nicht an Aktualität eingebüßt.
- Helga Krüger bezeichnet diesen Umstand als 'historisch verfestigte Segmentation'.
- Durch sie wird den Männern die Entwicklung alternativer Identitätskonzepte eingeschränkt.
- Doch auch im Hinblick auf verschlechterte Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und Veränderungen im Erwerbssystem, orientieren sich Männer weiterhin an einem auf Arbeit zentrierten Lebenslauf, wobei die Erwerbsarbeit als zentrale Referenz für männliche Identitätskonstruktion erhalten bleibt.
- Es mangelt ihnen an Erzähl- und Identitätsmustern, um Männlichkeit anderweitig zu konstruieren.
- Michael Meuser ist der Ansicht, dass Männer gleichsam kein anderes Vokabular besitzen, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen.
- Männlichkeit könne nur vom Beruf her konzipiert werden¹5.
- Dieser Prozess schlägt weitere Kreise als man vermuten würde und hat nicht nur Auswirkungen auf die Identitätsbildung des Mannes, sondern auch auf sein Familienleben.
- Wird das industriegesellschaftliche Männlichkeitskonstrukt nicht erreicht, kann dies zu einem späten Übergang in die Familiengründung, aber auch zur Kinderlosigkeit führen.
- Früher waren Männer die Alleinernährer der Familie, während sich die Frauen um Familie und Haushalt sorgten.
- In der Zeit der Postmoderne sind die Frauen mehr und mehr ins Erwerbssystem integriert und der Status der Männer als Alleinernährer ihrer Familie schwindet¹6.
- Aus Unsicherheiten in der beruflichen Entwicklung und veränderten Vorstellungen von Vaterschaft und Partnerschaftsstatus resultiert eine zunehmende Kinderlosigkeit unter Männern.
- Diese Reproduktionsproblematik ist vor allem unter jüngeren Männern mit niedriger Qualifikation verbreitet.
- Um im Beruf erfolgreich zu sein, muss man viel Zeit investieren, was das Entstehen und auch die Umsetzung von Familienplänen verhindert.
- Die vielfach gewünschte Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nicht möglich, weil die im Beruf notwendige Flexibilität und Mobilität dies verwehren.
- Helferrich und andere Autoren gehen davon aus, dass niedrig qualifizierte Männer bezüglich ihrer Familiengründung einem Ideal von zwei Lebensabschnitten folgen.
- In der ersten Phase, dem sogenannten 'wilden Leben', existieren große Handlungsspielräume sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben.
- In der zweiten Phase des Lebens finden sich dann die Familiengründung, sowie ein höheres Maß an Beständigkeit und Ruhe.
- Grundsetzlich ließen sich diese beiden Abschnitte in 'Jugend' und 'Familie' einteilen.
- Dieses Konzept suggeriert einen Reifungs- und Transformationsprozess, den die männlichen Jugendlichen durchlaufen müssen, um schließlich Männer und Väter zu werden.
- Innerhalb einer Familie kann man kein Mann werden - „Mann muss erst ein Mann sein, bevor man Vater werden kann“17.
- Berufliche und identitätsstiftende Erfahrungen aus der Arbeitswelt formen das Männlichkeitskonstrukt.
- Demzufolge verzögert ein unsicherer Erwerbsstatus nicht nur den Übergang in eine Ehe, sondern eben auch die Familiengründung per se¹8.
- Prekäre Arbeit hat aber nicht nur Konsequenzen für das familiäre Umfeld, sondern eben auch für die Männlichkeitskonstruktion.
- Vor allem Männer, die auf die Berufskarriere fokussiert sind, erleben die Erwerbsarbeit als einen Rahmen, innerhalb dessen sie Selbstverwirklichung und Anerkennung erfahren¹. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse vermitteln deshalb zumeist Unsicherheit und subjektive Prekarisierungsängste²º.
- Weil aber auch zunehmend Frauen beruflich tätig sind, sind beide Geschlechter von der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses betroffen.
- Angesichts der historisch konstituierten unterschiedlichen Bedeutung der Erwerbsarbeit für geschlechtliche Identitätsbildung, trifft es Männer jedoch anders als Frauen²¹.
- Nach Ansicht Klaus Dörres unterscheiden sich die subjektiven Verarbeitungsformen von Prekarität bei Männern und Frauen nicht hinsichtlich ihrer Orientierung auf ein Normalarbeitsverhältnis, sondern „,in ihrer Bereitschaft, sich mit weniger zufrieden zu geben“. Das liegt zum einen an der historisch ungleichen Verankerung im Normalarbeitsverhältnis, aber auch an der zwar modifizierten, aber letztendlich ungebrochenen Wirksamkeit symbolischer Formen männlicher Herrschaft.
- Durch eine ehemals willkürliche Einteilung homologer Gegensätze sind selektierte Handlungsstrategien entstanden.
- So dient der biologische Unterschied als natürliche Rechtfertigung für den gesellschaftlich konstruierten Unterschied zwischen den Geschlechtern und mithin der geschlechtlichen Arbeitsteilung23.
- Arbeit ist nötig, um Geschlecht hervorzubringen, was wiederum zu einer Vergeschlechtlichung von Arbeit führt 24.
- Die nahezu starren Erwartungen an geschlechtliche Arbeitsteilung werden nun mithin der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses aufgebrochen.
- Die meisten der potentiell prekären Beschäftigungsformen weisen eine deutliche Überrepräsentanz von Frauen auf, die jedoch zunehmend mit männlicher Konkurrenz konfrontiert werden 25.
- Und das, obwohl die in der sozialen Praxis hergestellte Unterschiedlichkeit der Geschlechter dieser Entwicklung zugegenläuft.
- So sind prekäre Beschäftigungsformen zumeist typisch weibliche Dienstleistungsbereiche.
- Dieser Umstand kann dazu beitragen, dass Männer in prekären Arbeitsverhältnissen eine doppelte Zwangsfeminisierung durchlaufen.
- Einerseits sind sie nicht in der Lage, die traditionelle Rolle des Vollernährers der Familie genügend auszufüllen.
- Andererseits sind sie gezwungen, in einem aus ihrer Sicht 'femininen' Beschäftigungsverhältnis zu arbeiten.
- Wie Dörre schreibt, bedeutet dieses neue Konkurrenzverhältnis eine „Einmündung in quasi-feminisierte Strukturen des Arbeitsmarktes"26.
- So durchleben beispielsweise Leiharbeiter in der Automobilindustrie eine Art 'Zwangsfeminisierung'.
- Statt den traditionellen Part des männlichen Vollzeiternährers zu bewältigen, sehen sie sich gezwungen, typisch weibliche Arbeiten zu erledigen.
- Die Befragten fühlten sich unter diesen Umständen nicht als 'richtige' Männer und waren nicht in der Lage aus dieser Arbeitssituation 'Produzentenstolz' zu entwickeln². In- nerhalb der Zone der Prekarität, die Dörre in seiner Typologie über (Des-)integrations- potentiale von Erwerbsarbeit zusammengestellt hat, nehmen sie den fünften und sechs- ten Platz ein.
- Sie haben sich also entweder bereits damit abgefunden, dieser Arbeit dauerhaft nachzugehen oder aber sehen sie als Chance und Sprungbrett für eine Festanstellung 28.
- Trotzdessen wird man alles daran setzen, eine solche Beschäftigungsform zu vermeiden, um die 'wirkliche' Männlichkeit nicht zu gefährden, denn geheimhin werden 23 Vgl. Dörre, Klaus, Prekäre Arbeit. Unsichere Beschäftigungsverhältnisse und ihre sozialen Folgen, in: Arbeit. Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik, 15. Jg., 2006, H.3, S.294.
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Auswirkungen der Prekarisierung von Erwerbsarbeit auf die Konstruktion männlicher Identität in der heutigen Gesellschaft. Er untersucht, wie die Erosion des traditionellen Normalarbeitsverhältnisses und die Verbreitung prekärer Beschäftigungsformen die Identitätsbildung von Männern beeinflussen und zu einer "Krise der Männlichkeit" führen können.
- Die Bedeutung der Erwerbsarbeit für die Konstruktion männlicher Identität
- Die Herausforderungen der Prekarisierung von Erwerbsarbeit für Männer
- Die Auswirkungen der Prekarisierung auf die Familiengründung und das Familienleben
- Die "Krise der Männlichkeit" im Kontext der Prekarisierung
- Die Rolle der geschlechtlichen Arbeitsteilung und die "Zwangsfeminisierung" von Männern in prekären Beschäftigungsverhältnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit der Darstellung des traditionellen Bildes vom "richtigen Mann" als schwer arbeitenden Familienernährer und zeigt, wie dieses Bild in der heutigen Zeit durch die Prekarisierung von Erwerbsarbeit in Frage gestellt wird. Er beschreibt die verschiedenen Formen prekärer Arbeit und ihre Auswirkungen auf die soziale und berufliche Integration von Männern.
Im weiteren Verlauf wird die Bedeutung der Erwerbsarbeit für die Konstruktion männlicher Identität beleuchtet. Der Text argumentiert, dass die Erwerbsarbeit für Männer eine zentrale Rolle bei der Identitätsbildung spielt und dass der Verlust von Erwerbsarbeit zu einer Verunsicherung der männlichen Identität führen kann.
Es wird auch die Verbindung zwischen Prekarisierung und Familiengründung untersucht. Der Text zeigt, wie die Unsicherheit in der beruflichen Entwicklung und die veränderten Vorstellungen von Vaterschaft und Partnerschaft zu einer zunehmenden Kinderlosigkeit unter Männern führen können.
Schließlich wird die "Zwangsfeminisierung" von Männern in prekären Beschäftigungsverhältnissen analysiert. Der Text argumentiert, dass Männer in prekären Arbeitsverhältnissen mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert sind: Sie können die traditionelle Rolle des Vollernährers nicht mehr erfüllen und sind gleichzeitig gezwungen, in "femininen" Beschäftigungsverhältnissen zu arbeiten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Prekarisierung von Erwerbsarbeit, die Konstruktion männlicher Identität, die "Krise der Männlichkeit", die Familiengründung, die geschlechtliche Arbeitsteilung und die "Zwangsfeminisierung" von Männern.
- Quote paper
- Ulrike Leupold (Author), 2012, Männer und Minijob. Vom Normalarbeitsverhältnis zur prekären Erwerbsarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287707