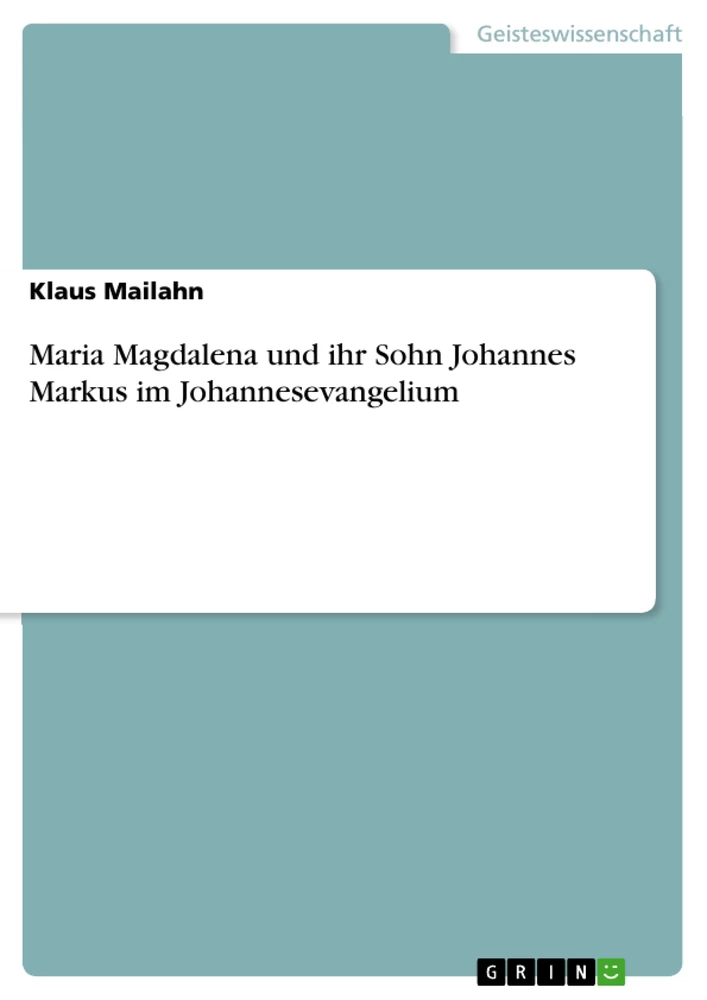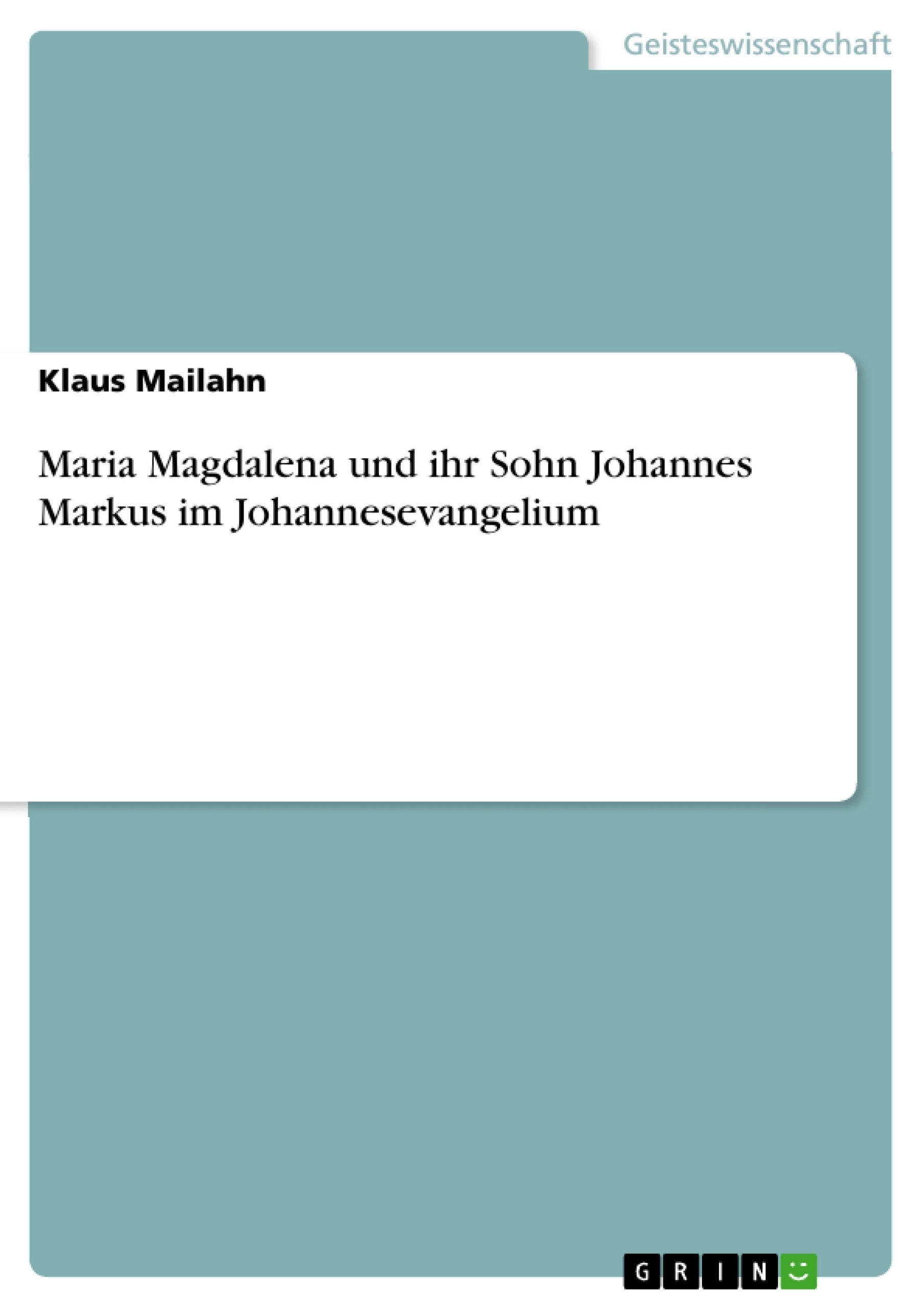In dieser exegetischen Arbeit geht es in erster Linie um die Rollen von Maria Magdalena und ihres Sohnes Johannes Markus im Johannesevangelium. Um dabei den Part dieser Frau richtig verstehen zu können, erfolgt zunächst die Beweisführung, dass Johannes Markus ihr Sohn war und das Johannesevangelium wohl unter ihrer Anleitung verfasste. Daher muss auch die Konzeption des Weiblichen, wie sie uns in aller Regel in den meisten Übersetzungen des Neuen Testaments entgegentritt, neugefasst werden: Die vor allem durch falsche Übersetzungen zum männlichen Heiligen Geist umgewandelte Ruachmutter nimmt wieder den ihr gebührenden Platz als weibliche Gottheit ein, ebenso die ganz aus dem Evangelium gestrichene und durch den Logos ersetzte Frau Weisheit, Sophia. In der Neuübersetzung bestimmter Passagen klingt ihre wahre Bedeutung als Göttliche Mutter an, und man versteht besser, warum die Gnostiker, welche vor allem das Johannesevangelium für ihre Zwecke verwendeten, Maria Magdalena als deren Inkarnation ansahen. Ein weiterer, mindestens genauso wichtiger Punkt ist es, die Konzeption des Evangeliums von Maria Magdalena und Jesus Christus als Göttliches Paar zu erkennen. Dies wie auch der Frau Jesu Vergangenheit als Priesterin der Taubengöttin Ashima in Samaria wird vor allem anhand theologischer und etymologischer Gesichtspunkte herausgearbeitet. Dabei kommen Erkenntnisse ans Tageslicht, die so manchen interessierten Leser in Erstaunen versetzen dürften.
Inhaltsverzeichnis
- Unkorrekte Übersetzungen - eine Frage der Perspektive
- Das Johannesevangelium – Einordnung, Datierung und Verfasserschaft
- Maria Magdalena, Johannes Markus und die Entstehung des Johannesevangeliums
- Maria Magdalena war die Mutter von Johannes Markus
- Zum Namen Johannes Markus
- Relevante Bibelstellen
- Ein ikonographischer Aspekt: Mutter und Sohn in der Buchmalerei des Book of Kells
- Verdrängung und Bekämpfung von Mutter und Sohn
- Die Situation nach der Passion und Auferstehung Jesu
- Die Verbindung des Johannesevangeliums mit der Gnosis
- Die Entwicklung der johanneischen Gemeinde
- Warum der Beiname Magdalena nicht im Johannesevangelium zu finden ist und warum ihr ihre Heimatstadt Magdala später zugeordnet wurde
- Zum Beinamen Magdalena
- Zur Stadt Magdala
- Übersetzung und Kommentar wichtiger Passagen
- Zum Prolog
- Übersetzung
- Kommentar
- Der Austausch von Sophia gegen Logos
- Die Sophia der Gnosis
- Sophia bei den Ophiten
- Der Sophia-Mythos der Pistis Sophia
- Sophia und Maria Magdalena
- Die Folgen der Verdrängung Sophias
- Zu Jesu Taufe im Jordan
- Übersetzung
- Kommentar
- Die Ruachmutter im AT
- Von der Ruachmutter des ATs zum Heiligen Geist im NT
- Die Ruachmutter in der Gnosis
- Ruach in der Ikonographie
- Ruach in der christlichen Tradition
- Ruach und Maria Magdalena
- Bei Hippolyt
- Bei Origenes
- Bei Augustinus
- Die Ruachmutter und Maria Magdalena bei der Taufe Jesu
- Zum Kapitel „Das erste Zeichen: Die Hochzeit“
- Jesus und die Samariterin am Brunnen
- Übersetzung
- Kommentar
- Die Begegnung der Samariterin am Brunnen mit Jesus – ein Liebesgeplänkel
- Die Taubengöttin Ashima
- Weitere etymologische Überlegungen
- Essenz der Begegnung Jesu mit der Frau am Brunnen
- Parallelen zu Joh 4,11-29 im Alten Testament
- Die Hochzeit zu Kana
- Übersetzung
- Kommentar
- Die Erfüllung der Liebeswerbung
- Überarbeitungen des Textes durch Bearbeiter
- Die Komposition des Werkes als Göttliches Paar
- Die geistige Bedeutung der Hochzeit
- Von Wasser zu Wein
- Verschiedene Stellen zu Sophia und Ruach. Maria Magdalena im Symbol des Fisches
- Sophia
- Ruach
- Die versteckte Maria Magdalena bei der Speisung der 5000
- Kreuzigung und Passion
- Die Frauen unter dem Kreuz
- Durst und Wein
- Auferstehung und Erscheinung Jesu vor Maria Magdalena
- Übersetzung
- Kommentar
- Der weggerollte Stein
- Die zwei Engel in weißen Gewändern
- Höhe- und Schlusspunkt: Das Göttliche Paar
- Die Verbindung zu Shabbat Hamalka
- Zum Epilog
- Übersetzung
- Kommentar
- Essenz der wichtigsten Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle von Maria Magdalena und Johannes Markus im Johannesevangelium, insbesondere die These, dass Maria Magdalena die Mutter von Johannes Markus war. Ziel ist es, durch textanalytische und ikonographische Methoden die Darstellung von Maria Magdalena im Evangelium neu zu interpretieren und ihren möglichen Bezug zur gnostischen Sophia-Figur aufzuzeigen.
- Die Rolle von Maria Magdalena im Johannesevangelium
- Die These von Maria Magdalena als Mutter Johannes Markus
- Der Einfluss gnostischer Vorstellungen auf das Johannesevangelium
- Ikonographische Darstellungen von Mutter und Sohn
- Die Bedeutung von Sophia und Ruach im Kontext des Johannesevangeliums
Zusammenfassung der Kapitel
Unkorrekte Übersetzungen - eine Frage der Perspektive: Dieses Kapitel legt dar, wie unterschiedliche Übersetzungen des Johannesevangeliums zu verschiedenen Interpretationen der Rolle Marias Magdalena führen können. Es betont die Bedeutung genauer Übersetzungen und die Berücksichtigung des historischen und kulturellen Kontextes.
Das Johannesevangelium – Einordnung, Datierung und Verfasserschaft: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das Johannesevangelium, beleuchtet seine Einordnung in den Kontext anderer Evangelien, diskutiert seine Datierung und erörtert die Frage nach seiner Autorenschaft. Es legt den Grundstein für die anschließende Analyse der Rolle Marias Magdalena innerhalb des Evangeliums.
Maria Magdalena, Johannes Markus und die Entstehung des Johannesevangeliums: Dieses Kapitel stellt die zentrale These der Arbeit vor: Maria Magdalena war die Mutter von Johannes Markus, und diese Beziehung beeinflusste die Entstehung des Johannesevangeliums. Es skizziert die Argumentationslinie und die Beweisführung der folgenden Kapitel.
Maria Magdalena war die Mutter von Johannes Markus: Dieses Kapitel präsentiert Beweise für die These, dass Maria Magdalena die Mutter von Johannes Markus war, indem es verschiedene Bibelstellen und historische Quellen analysiert. Es betrachtet die impliziten und expliziten Hinweise im Text und legt die logischen Verbindungen dar.
Zum Namen Johannes Markus: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des Namens Johannes Markus im historischen und religiösen Kontext, um seine Verbindung zu Maria Magdalena und dem Johannesevangelium zu beleuchten. Die etymologischen und theologischen Aspekte werden hier ausführlich betrachtet.
Relevante Bibelstellen: Dieses Kapitel analysiert verschiedene relevante Bibelstellen, die als Beweis für die These der Mutterschaft Marias Magdalena dienen. Jede Stelle wird im Detail interpretiert und in den Gesamtkontext des Evangeliums eingeordnet.
Ein ikonographischer Aspekt: Mutter und Sohn in der Buchmalerei des Book of Kells: Dieses Kapitel untersucht ikonographische Darstellungen von Mutter und Sohn in mittelalterlichen Manuskripten, wie dem Book of Kells, um mögliche Parallelen zur Beziehung zwischen Maria Magdalena und Johannes Markus aufzuzeigen. Es analysiert die Symbolik und die künstlerische Gestaltung dieser Darstellungen.
Verdrängung und Bekämpfung von Mutter und Sohn: Dieses Kapitel erörtert die mögliche Verdrängung und Bekämpfung der Figur Marias Magdalena und ihres Sohnes Johannes Markus im Laufe der Kirchengeschichte und deren Auswirkungen auf die Interpretation des Johannesevangeliums. Es untersucht die theologischen und politischen Gründe für diese Entwicklung.
Die Situation nach der Passion und Auferstehung Jesu: Dieses Kapitel beschreibt die Situation nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu und die Rolle Marias Magdalena in diesem Kontext. Es analysiert die verschiedenen Evangelienberichte und versucht, die Ereignisse aus der Perspektive der These der Arbeit zu rekonstruieren.
Die Verbindung des Johannesevangeliums mit der Gnosis: Dieses Kapitel untersucht die möglichen Verbindungen zwischen dem Johannesevangelium und gnostischen Strömungen, insbesondere im Hinblick auf die Figur Marias Magdalena und ihre mögliche Identifizierung mit der gnostischen Sophia.
Die Entwicklung der johanneischen Gemeinde: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der johanneischen Gemeinde und ihren Einfluss auf die Interpretation und Überlieferung des Johannesevangeliums, wobei der Fokus auf der Rolle Marias Magdalena und der möglichen Herausforderungen für die Gemeinde durch die These liegt.
Warum der Beiname Magdalena nicht im Johannesevangelium zu finden ist und warum ihr ihre Heimatstadt Magdala später zugeordnet wurde: Dieses Kapitel untersucht die Gründe, warum der Beiname Magdalena im Johannesevangelium nicht vorkommt und warum Magdala später als ihre Heimatstadt identifiziert wurde. Es untersucht die historischen und theologischen Gründe für diese Entwicklungen.
Übersetzung und Kommentar wichtiger Passagen: Dieses Kapitel bietet Übersetzungen und Kommentare wichtiger Passagen des Johannesevangeliums, die für die These der Arbeit relevant sind. Die Übersetzungen werden detailliert erläutert und in den Kontext eingeordnet.
Zu Jesu Taufe im Jordan: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Taufe Jesu im Johannesevangelium und setzt sie in Beziehung zur Figur Marias Magdalena und der gnostischen Ruachmutter. Die Symbolik der Taufe und ihre Bedeutung für die These werden untersucht.
Zum Kapitel „Das erste Zeichen: Die Hochzeit“: Dieses Kapitel interpretiert das Kapitel über die Hochzeit zu Kana im Johannesevangelium unter dem Aspekt der Verbindung zwischen Jesus und Maria Magdalena und deutet die Symbolik der Verwandlung von Wasser in Wein.
Jesus und die Samariterin am Brunnen: Dieses Kapitel interpretiert die Begegnung Jesu mit der Samariterin am Brunnen unter dem Aspekt der These, in Bezug auf die Liebeswerbung und die religiöse Symbolik.
Verschiedene Stellen zu Sophia und Ruach. Maria Magdalena im Symbol des Fisches: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Stellen im Johannesevangelium, in denen die Symbole von Sophia und Ruach vorkommen und untersucht die mögliche Verbindung zu Maria Magdalena, unter anderem durch das Symbol des Fisches.
Kreuzigung und Passion: Dieses Kapitel untersucht die Darstellung der Kreuzigung und Passion Jesu im Johannesevangelium, konzentriert sich auf die Rolle der Frauen und ihre Bedeutung für die These.
Die Frauen unter dem Kreuz: Dieses Kapitel konzentriert sich speziell auf die Rolle der Frauen, die bei der Kreuzigung Jesu anwesend waren, und untersucht ihre Bedeutung im Kontext der These.
Durst und Wein: Dieses Kapitel analysiert die Symbolik des Durstes und Weines im Kontext der Kreuzigung und deren Beziehung zu Maria Magdalena und der These.
Auferstehung und Erscheinung Jesu vor Maria Magdalena: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Auferstehung Jesu und seine Erscheinung vor Maria Magdalena im Johannesevangelium. Die Bedeutung dieses Ereignisses für die These wird hier im Detail erläutert.
Schlüsselwörter
Maria Magdalena, Johannes Markus, Johannesevangelium, Gnosis, Sophia, Ruach, Mutterschaft, Ikonographie, Textanalyse, Bibelstellen, Magdala.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Maria Magdalena, Johannes Markus und das Johannesevangelium
Was ist die zentrale These des Textes?
Die zentrale These des Textes ist, dass Maria Magdalena die Mutter von Johannes Markus war und diese familiäre Beziehung die Entstehung und Interpretation des Johannesevangeliums maßgeblich beeinflusste.
Welche Methoden werden im Text verwendet, um die These zu belegen?
Der Text verwendet eine Kombination aus textanalytischen, ikonographischen und historischen Methoden. Es werden Bibelstellen analysiert, ikonographische Darstellungen von Mutter-Sohn-Beziehungen untersucht und historische Quellen herangezogen, um die These zu stützen.
Welche Rolle spielt Maria Magdalena im Johannesevangelium laut dem Text?
Der Text argumentiert, dass Maria Magdalena eine viel wichtigere Rolle im Johannesevangelium spielt, als traditionell angenommen wird. Ihre Bedeutung wird im Kontext der gnostischen Figuren Sophia und Ruach interpretiert.
Welche Bedeutung haben Sophia und Ruach im Kontext des Textes?
Sophia und Ruach sind gnostische Figuren, die mit Maria Magdalena in Verbindung gebracht werden. Der Text argumentiert, dass die Verdrängung dieser Figuren in der christlichen Tradition auch die Rolle Marias Magdalena beeinflusste.
Wie wird die These der Mutterschaft von Maria Magdalena belegt?
Die These wird durch die Analyse von Bibelstellen, die Untersuchung von Namenssymbolismen (Johannes Markus) und die Berücksichtigung des historischen und kulturellen Kontextes des Johannesevangeliums belegt. Ikonographische Beweise aus mittelalterlichen Manuskripten, wie dem Book of Kells, werden ebenfalls herangezogen.
Welche Bedeutung hat die Übersetzung des Johannesevangeliums für die Interpretation des Textes?
Der Text betont die Wichtigkeit genauer Übersetzungen und die Berücksichtigung des historischen und kulturellen Kontextes. Unterschiedliche Übersetzungen können zu verschiedenen Interpretationen der Rolle Marias Magdalena führen.
Welche Kapitel werden im Text behandelt?
Der Text umfasst Kapitel zur Einordnung des Johannesevangeliums, zur Rolle von Maria Magdalena und Johannes Markus, zur Bedeutung von Sophia und Ruach, zur Analyse wichtiger Bibelstellen und ikonographischer Darstellungen, sowie zu den Folgen der möglichen Verdrängung dieser Figuren in der Kirchengeschichte. Es werden auch verschiedene Passagen des Evangeliums übersetzt und kommentiert.
Wie wird die Verbindung des Johannesevangeliums zur Gnosis dargestellt?
Der Text untersucht mögliche Verbindungen zwischen dem Johannesevangelium und gnostischen Strömungen, insbesondere im Hinblick auf die Figur Marias Magdalena und ihre mögliche Identifizierung mit der gnostischen Sophia.
Welche Rolle spielt die Stadt Magdala und der Beiname Magdalena?
Der Text untersucht die Gründe, warum der Beiname Magdalena nicht im Johannesevangelium vorkommt und warum Magdala später als ihre Heimatstadt identifiziert wurde. Es werden historische und theologische Gründe dafür erörtert.
Welche Schlüsselwörter kennzeichnen den Text?
Schlüsselwörter sind: Maria Magdalena, Johannes Markus, Johannesevangelium, Gnosis, Sophia, Ruach, Mutterschaft, Ikonographie, Textanalyse, Bibelstellen, Magdala.
- Citar trabajo
- Klaus Mailahn (Autor), 2015, Maria Magdalena und ihr Sohn Johannes Markus im Johannesevangelium, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287250