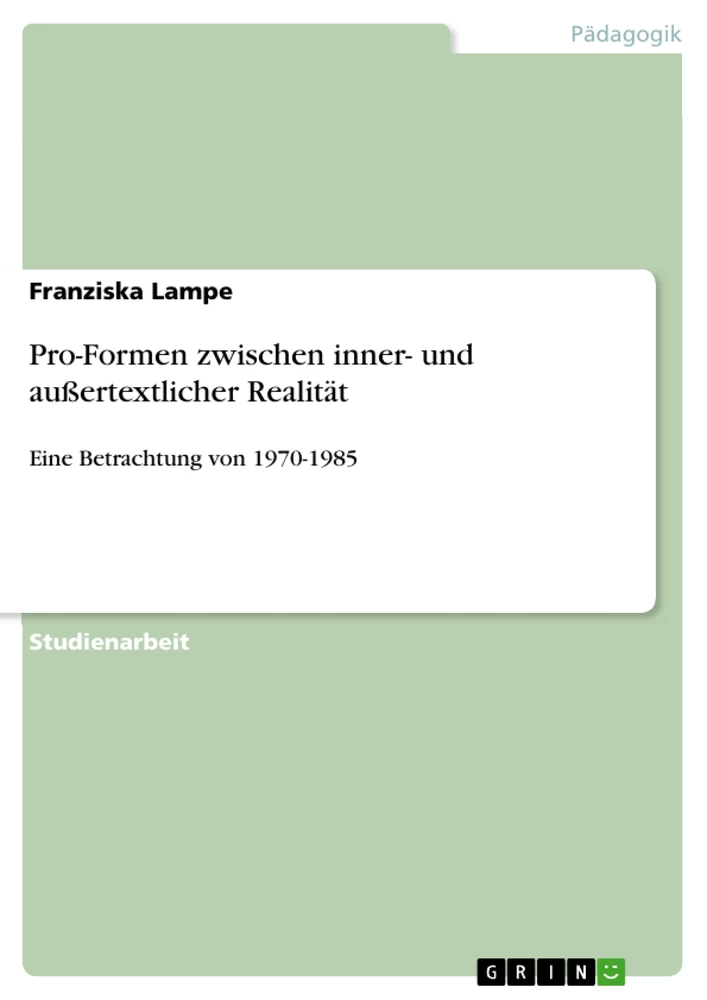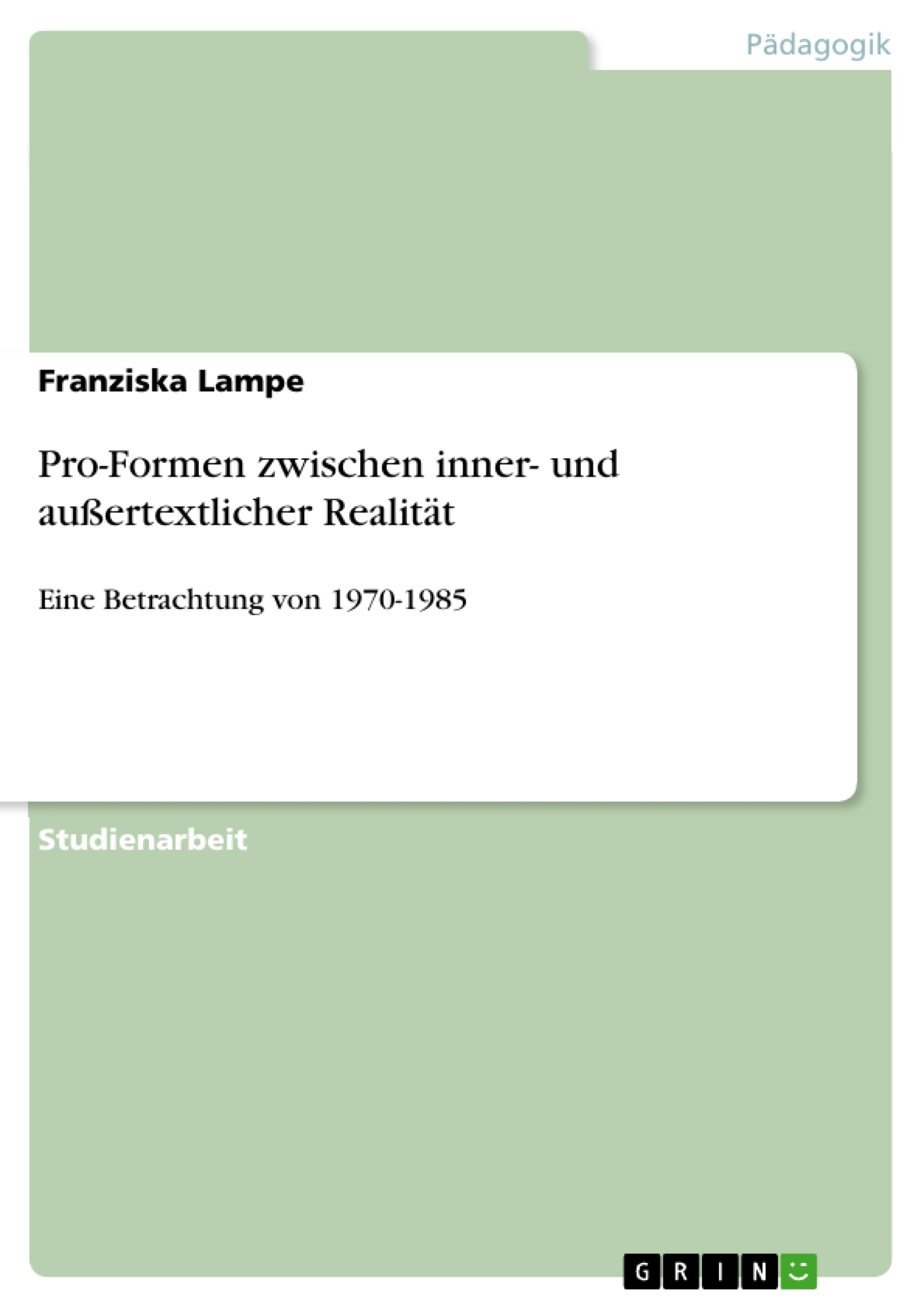Der Begriff Pro-Form ist eine Verallgemeinerung des traditionellen Begriffs ‘Pronomen‘. Es kann sich dabei sowohl um Pronomen handeln aber auch Verben, Adjektive und Adverben, ja sogar ganze Sätze oder Texte können als Pro-Form gesehen werden. Eine Pro-Form steht immer für eine grammatische Kategorie beliebiger Art (ebd.) Die Funktion der Konstituente „Pro“ dient dazu, die syntaktische Struktur, in der sich die Pro-Form befindet, zu markieren.
Pro-Formen sind in der Grammatik der Textkohäsion zuzuordnen. Sie bezeichnet den formalen Zusammenhalt eines Textes und grenzt sich dadurch von der Textkohärenz ab, die sich eher auf den inhaltlichen Zusammenhang bezieht. Als Referent oder auch Antezedent wird das Element angesehen, welches durch eine Pro-Form ersetzt wird wobei der Antezedent lediglich anaphorischer Natur ist, während der Referent ebenso in einen kataphorischen Verweis funktioniert. Die Pro-Form bezieht sich immer auf eine Person, ein Gegenstand, eine Handlung, eine Emotion etc. Häufig werden Pro-Formen anaphorisch verwendet, das heißt, der Antezedent taucht vorher auf und wird durch eine Pro-Form wieder aufgegriffen. Kataphorische Pro-Formen kommen häufig interrogativ vor und finden den Referenten im Anschluss wieder. Es werden im Verlauf der Auseinandersetzung die Forschungsstände von Steinitz 1974 und Vater 1975 kontrastiert. Weiterhin wird auch eine spätere Auffassung von Brinker 1997 konsultiert, um den aktuelleren Forschungsstand zu berücksichtigen. Schwerpunkt soll jedoch eine Gegenüberstellung Steinitz und Brinkers sein, die unterschiedliche Ergebnisse präsentieren. Es soll herausgefunden werden, wo die Unterschiede liegen und die jeweiligen Argumente kritisch betrachtet werden. Vorerst erfolgt jedoch eine Verortung der Pro-Formen in der Textkohäsion, gefolgt von umfangreichen Darstellung der Pro-Formen an sich.
„In eng verbundenen Einheiten wie Phrasen, Teilsätzen und Sätzen wird die Kohäsion durch das Einfügen der Elemente in grammatischen Abhängigkeiten aufrechterhalten. In längeren Textstrecken besteht die Hauptoperation darin, herauszufinden, wie schon verwendete Elemente und Muster wieder verwendet, verändert oder zusammengefügt werden können“ (Beaugrander 1980, 57)
Der Begriff Textkohäsion beschreibt die Einheit eines Textes als eine grammatisch verknüpfte Folge von Sätzen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- VERORTUNG DER PRO-FORMEN IN DER TEXTLINGUISTIK
- PRO-FORMEN
- PRO-NOMEN
- PRO-VERBEN
- PRO-ADVERBIALE UND PRO-ADJEKTIVE
- PRO-SÄTZE UND -TEXTE
- ZUR MOTIVATION UND HIERARCHIE VON PRO-FORMEN
- NOMINALE PRO-FORMEN
- DAS PRINZIP DER WIEDERAUFNAHME NACH RENATE STEINITZ 1974
- DIE WIEDERHOLUNG DES REFERENZTRÄGERS ALS PRO-NOMEN
- PRO-FORMEN UNTER DEM GESICHTSPUNKT DER ERSETZUNG
- PRO-FORMEN DES DEUTSCHEN NACH HEINZ VATER 1975
- ZWEIFELSFÄLLE DER PRO-FORMEN
- GEGENÜBERSTELLUNG
- ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die Verwendung von Pro-Formen in der Textlinguistik und analysiert ihre Funktion im Kontext der Textkohäsion. Das Ziel ist es, die verschiedenen Kategorien von Pro-Formen zu definieren und ihre Rolle bei der Wiederaufnahme von Referenzträgern zu beleuchten. Dabei werden die Forschungsansätze von Steinitz und Vater kontrastiert und die Bedeutung der expliziten und impliziten Wiederaufnahme im Textverständnis hervorgehoben.
- Die Definition und Klassifizierung von Pro-Formen
- Die Rolle von Pro-Formen in der Textkohäsion
- Die Unterscheidung zwischen expliziter und impliziter Wiederaufnahme
- Die Kontrastierung der Ansätze von Steinitz und Vater
- Die Bedeutung von Pro-Formen für das Textverständnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Pro-Formen als ein zentrales Element der Textlinguistik vor und verortet sie im Kontext der Textkohäsion. Sie erläutert die Funktion von Pro-Formen als Mittel der Wiederaufnahme und Verknüpfung von Texteinheiten.
Das zweite Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über die verschiedenen Kategorien von Pro-Formen, darunter Pronomen, Verben, Adverbiale, Adjektive, Sätze und Texte. Es beleuchtet die unterschiedlichen Motivationen und Hierarchien, die der Verwendung von Pro-Formen zugrunde liegen.
Das dritte Kapitel fokussiert auf nominale Pro-Formen und untersucht das Prinzip der Wiederaufnahme nach Steinitz. Es analysiert die Wiederholung des Referenzträgers als Pronomen und beleuchtet die verschiedenen Arten der Referenzidentität.
Das vierte Kapitel betrachtet Pro-Formen unter dem Gesichtspunkt der Ersetzung und stellt die Ansätze von Vater vor. Es diskutiert die verschiedenen Fälle der Pro-Formen und beleuchtet die Problematik von Zweifelsfällen.
Das fünfte Kapitel präsentiert eine Gegenüberstellung der verschiedenen Forschungsansätze und diskutiert die unterschiedlichen Ergebnisse und Argumente.
Schlüsselwörter
Pro-Formen, Textkohäsion, Wiederaufnahme, Referenzträger, explizite Wiederaufnahme, implizite Wiederaufnahme, Steinitz, Vater, Brinker, Anaphora, Kataphora, Referenzidentität, semantische Kontinuität
- Arbeit zitieren
- Franziska Lampe (Autor:in), 2014, Pro-Formen zwischen inner- und außertextlicher Realität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/287070