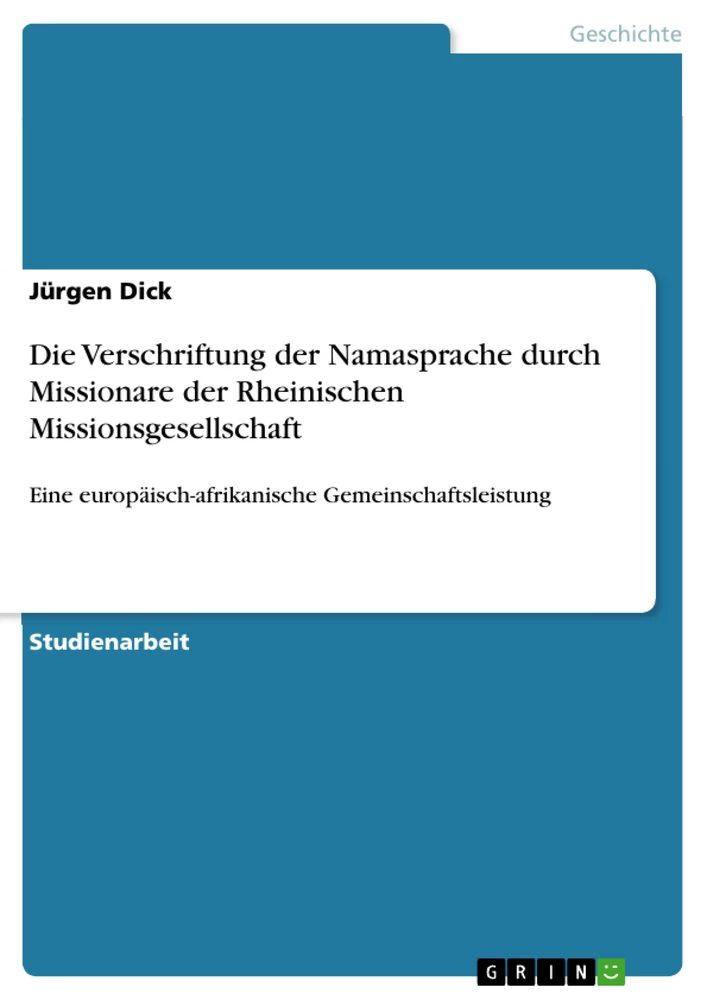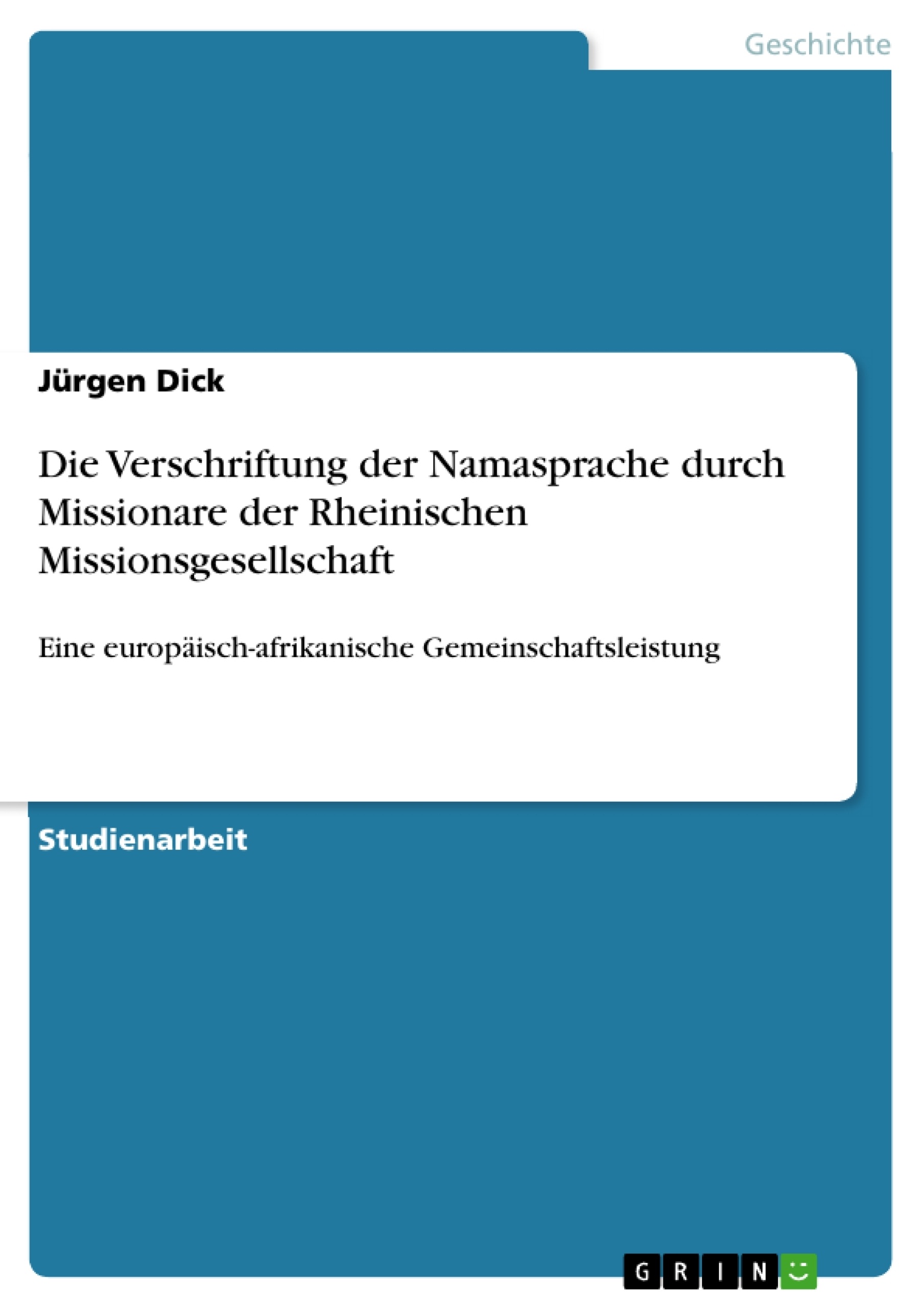Mit Beginn des 19. Jahrhunderts begannen protestantische Missionsgesellschaften mit der Verbreitung des Christentums auf dem Gebiet des heutigen Namibia. Im Jahre 1842 übernahm die Rheinische Missionsgesellschaft aus Barmen die Leitung der Namibiamission. Die ersten beiden Missionsgenerationen konnten sich noch nicht auf den Rückhalt einer kolonialen Macht abstützen. Sie waren mit den schwierigen Bedingungen eines mutiethnischen Gebietes konfrontiert, deren Bewohner sich in ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen um die knappen natürlichen Ressourcen des kargen Landes befanden. Dies musste Auswirkungen auf die Evangelisationsstrategie haben. Eine besondere Bedeutung hatte von vornherein die Beherrschung der indigenen Sprache, die sich nicht auf die Oralität beschränken sollte. Die darüber hinaus angestrebte Verschriftung stand ganz im Dienste des Missionsauftrages und war Teil des Transformationsprozesses, dessen Ziel darin bestand, die bisherigen Religionsvorstellungen zu verdrängen und das Christentum als neuen Religion zu etablieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Nama - Eine kurze ethnologische und linguistische Übersicht
- Eine Region im gesellschaftlichen Umbruch - die politische Lage in Groß- und Kleinnamaland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
- Die Rheinische Missionsgesellschaft und die Bedeutung der Sprache im Rahmen der Evangelisationsstrategie
- „Den Nama ein Nama sein“ – Johann Heinrich Schmelen, Missionspionier und Wegbereiter
- Die zweite Generation - Fortsetzung von missionarischer Erschließung und Sprachforschung durch Missionare der RMG
- Von Tsoe' kwab zu Elob – Die Verschriftung einer Sprache als Kulturtransfer
- Die Sprachenpolitik im Spannungsfeld zwischen Europäisierung und Erhalt der indigenen Sprache - Verschriftung als Sprachenretter?
- Fazit und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verschriftung der Nama-Sprache durch Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) im vorkolonialen Namibia (1805-1884). Sie analysiert die Rolle der linguistischen Arbeit innerhalb der Evangelisationsstrategie der RMG und beleuchtet den Einfluss von Inkulturation und Akkomodation auf den Kulturtransfer. Der Fokus liegt auf der Sprachenpolitik der Missionsgesellschaften und ihrer Umsetzung vor Ort unter den gegebenen vorkolonialen Bedingungen.
- Die Rolle der Sprache in der Evangelisationsstrategie der RMG
- Der Prozess der Verschriftung der Nama-Sprache und die damit verbundenen Herausforderungen
- Der Einfluss von Inkulturation und Akkomodation auf den Kulturtransfer
- Das Spannungsfeld zwischen europäischer und indigener Sprache
- Die Bedeutung einheimischer Akteure im Prozess der Verschriftung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der europäischen Missionierung in Namibia zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Sie hebt die Bedeutung der Beherrschung der Nama-Sprache für die Evangelisation hervor und erklärt die Verschriftung als integralen Bestandteil des Transformationsprozesses. Es wird die zentrale Rolle der Bibelübersetzung und die Notwendigkeit eingehender Kenntnisse der Nama-Kultur betont. Der Konflikt zwischen den missionarischen Zielen und den politischen und wirtschaftlichen Interessen der einheimischen Eliten wird angesprochen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Sprachenpolitik der Missionsgesellschaften und deren Umsetzung vor Ort, wobei der vorkoloniale Zeitraum von 1805 bis 1884 im Mittelpunkt steht.
Die Nama - Eine kurze ethnologische und linguistische Übersicht: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und muss aus dem Haupttext extrahiert werden)
Eine Region im gesellschaftlichen Umbruch - die politische Lage in Groß- und Kleinnamaland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und muss aus dem Haupttext extrahiert werden)
Die Rheinische Missionsgesellschaft und die Bedeutung der Sprache im Rahmen der Evangelisationsstrategie: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und muss aus dem Haupttext extrahiert werden)
„Den Nama ein Nama sein“ – Johann Heinrich Schmelen, Missionspionier und Wegbereiter: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und muss aus dem Haupttext extrahiert werden)
Die zweite Generation - Fortsetzung von missionarischer Erschließung und Sprachforschung durch Missionare der RMG: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und muss aus dem Haupttext extrahiert werden)
Von Tsoe' kwab zu Elob – Die Verschriftung einer Sprache als Kulturtransfer: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und muss aus dem Haupttext extrahiert werden)
Die Sprachenpolitik im Spannungsfeld zwischen Europäisierung und Erhalt der indigenen Sprache - Verschriftung als Sprachenretter?: (Kapitelzusammenfassung fehlt im Ausgangstext und muss aus dem Haupttext extrahiert werden)
Schlüsselwörter
Nama-Sprache, Rheinische Missionsgesellschaft, Evangelisation, Verschriftung, Sprachenpolitik, Kulturtransfer, Inkulturation, Akkomodation, Kolonialismus, Namibia, Bibelübersetzung, Khoisan-Sprachen, Linguistik.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Die Verschriftung der Nama-Sprache durch Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) im vorkolonialen Namibia (1805-1884)"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verschriftung der Nama-Sprache durch Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) in Namibia zwischen 1805 und 1884. Sie analysiert die Rolle der Linguistik innerhalb der Evangelisationsstrategie der RMG und beleuchtet den Einfluss von Inkulturation und Akkomodation auf den Kulturtransfer. Ein Schwerpunkt liegt auf der Sprachenpolitik der Missionsgesellschaften und deren Umsetzung vor Ort unter vorkolonialen Bedingungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der Sprache in der Evangelisationsstrategie der RMG, den Prozess der Verschriftung der Nama-Sprache und die damit verbundenen Herausforderungen, den Einfluss von Inkulturation und Akkommodation auf den Kulturtransfer, das Spannungsfeld zwischen europäischer und indigener Sprache und die Bedeutung einheimischer Akteure im Prozess der Verschriftung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in der Einleitung?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu einer Einleitung, einer ethnologischen und linguistischen Übersicht der Nama, der politischen Lage in Namaland im 19. Jahrhundert, der Rolle der RMG und ihrer Sprachenpolitik, Johann Heinrich Schmelen als Missionspionier, der Arbeit der zweiten Generation von Missionaren, der Verschriftung der Nama-Sprache als Kulturtransfer, der Sprachenpolitik im Spannungsfeld zwischen Europäisierung und dem Erhalt der indigenen Sprache und schliesslich einem Fazit und Diskussion. Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext der europäischen Missionierung in Namibia und betont die Bedeutung der Nama-Sprache für die Evangelisation und die Bibelübersetzung sowie den Konflikt zwischen missionarischen Zielen und den Interessen einheimischer Eliten.
Warum fehlen Kapitelzusammenfassungen in einigen Abschnitten?
Die bereitgestellten Kapitelzusammenfassungen sind unvollständig. Die fehlenden Zusammenfassungen müssen aus dem Haupttext der Arbeit extrahiert werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nama-Sprache, Rheinische Missionsgesellschaft, Evangelisation, Verschriftung, Sprachenpolitik, Kulturtransfer, Inkulturation, Akkomodation, Kolonialismus, Namibia, Bibelübersetzung, Khoisan-Sprachen, Linguistik.
Welchen Zeitraum behandelt die Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf den vorkolonialen Zeitraum von 1805 bis 1884 in Namibia.
Welche Rolle spielte Johann Heinrich Schmelen?
Johann Heinrich Schmelen wird als Missionspionier und Wegbereiter der Verschriftung der Nama-Sprache hervorgehoben. Ein eigenes Kapitel ist ihm gewidmet.
Wie wird der Prozess der Verschriftung der Nama-Sprache dargestellt?
Der Prozess der Verschriftung wird als komplexer Kulturtransfer beschrieben, der mit Herausforderungen verbunden war und im Spannungsfeld zwischen Europäisierung und Erhalt der indigenen Sprache stattfand. Die Arbeit untersucht, inwieweit die Verschriftung als "Sprachenretter" gewertet werden kann.
- Citation du texte
- Dr. med Jürgen Dick (Auteur), 2014, Die Verschriftung der Namasprache durch Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/286876