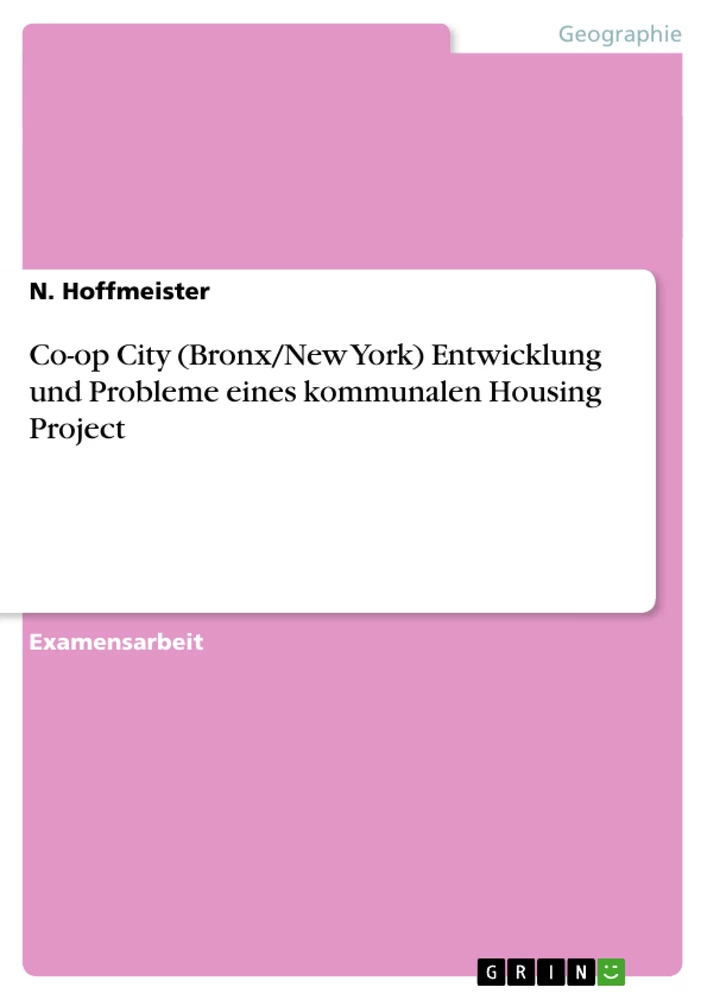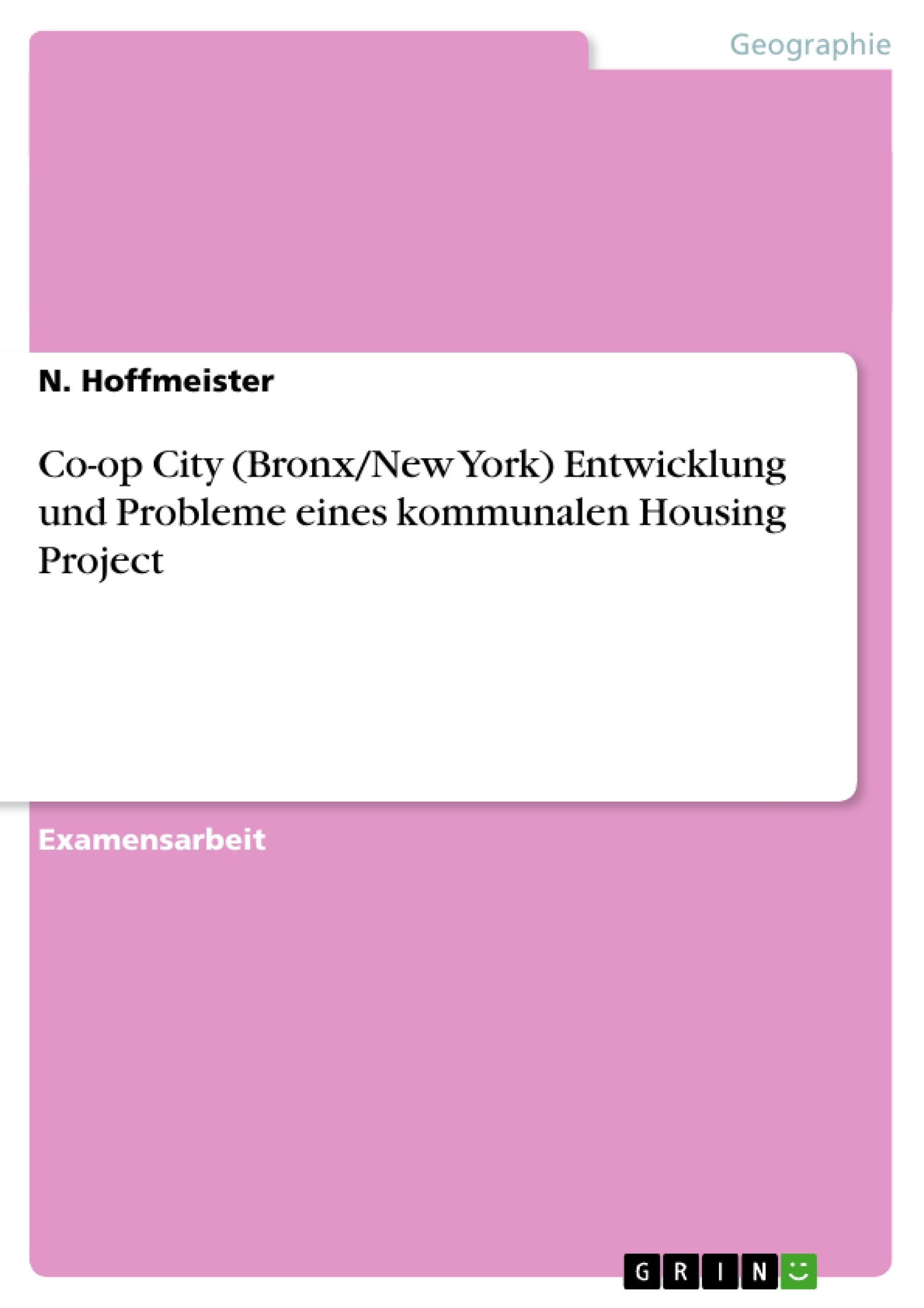Einleitung
Im Zeitalter der Globalisierung entsteht eine neue ‚Weltgesellschaft’ (vgl. KING/SCHNEIDER: S. 13). Vornehmlich die stark wachsende städtische Bevölkerung erleidet ein immer stärkeres Auseinanderdriften der armen und reichen Bevölkerungsschichten. Die Millionenstädte sind besonders von dieser Entwicklung betroffen. Die kleinere Gruppe der Reichen, deren Vermögen immer größere Ausmaße annimmt, entfernt sich mit zunehmender Geschwindigkeit vom großen ‚Meer der armen Bevölkerung’. Aus dieser Problematik heraus entstehen räumliche Disparitäten in Form von sozialer Polarisierung und Segregation.
In der globalen Städtehierarchie existierte bisher ein auffälliges Nord-Süd Gefälle. Die südlich gelegenen Megastädte der Dritten Welt nahmen einen deutlich niedrigeren Stellenwert im globalen Netz ein als die hoch industrialisierten nördlichen Städte (vgl. SASSEN, 2000: S. 16). Allerdings werden im Zuge der Globalisierung die peripheren Gebiete der Metropolen des Nordens denen im Süden immer ähnlicher. Die Stadt New York ist exemplarisch für diese Entwicklung.
In New York existierten bitterste Armut und glänzender Reichtum unmittelbar –aber dennoch streng getrennt– nebeneinander wie in kaum einer anderen Metropole (vgl. WINDHOFF-HERITIER: S. 8). Die Sichtweise von New York als Stadt der tiefen Gegensätze ist nicht neu: „[…] observers are again depicting New York as ‚two cities’, one rich and one poor“ (CASTELLS/MOLLENKOPF nach LUCID: S. 3). Man spricht in diesem Zusammenhang auch von New York als ‚Dual City’ (vgl. CASTELLS/MOLLENKOPF: S. 3).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Gegenstand und Ziel der Arbeit
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 New York - Strukturmerkmale
- 2.1 Lage und Stadtgebiet
- 2.2 Bevölkerungsstrukturelle Merkmale
- 2.2.1 Die Bevölkerungsdichte und allgemeine Wohnungssituation
- 2.2.2 Die Rasse und Sozialstruktur
- 2.2.3 Der Arbeitsmarkt
- 2.2.4 Armut in New York
- 2.3 New York: „Melting Pot“ oder „Salad Bowl“?
- 2.4 New York - Weltstadt und Global City
- 3 Co-op City - Entstehung eines kommunalen „Housing Project“
- 3.1 Lage
- 3.2 Die Initiatoren
- 3.2.1 Mitchell Lama Housing Program
- 3.2.2 Riverbay Cooperation
- 4 Co-op City - Die Strukturmerkmale
- 4.1 Einrichtungen
- 4.1.1 Das Bildungsangebot
- 4.1.2 Das Freizeitangebot
- 4.2 Die Infrastruktur
- 4.2.1 Die Verkehrsplanung
- 4.2.1 Innerstädtischer Austausch
- 5 Entwicklungsprozesse Co-op Citys seit 1979
- 5.1 Bevölkerung
- 5.1.1 NORC
- 5.2 Probleme und Lösungsversuche
- 5.2.2 Segregation und soziale Polarisierung
- 5.2.3 Kriminalität und Drogen in Co-op City
- 5.2.4 Wandlung zur größten NORC des Landes
- 5.3 Inwiefern sind die ursprünglichen Ziele erreicht worden?
- 6 Soziale Fragmentierung am Beispiel Co-op City - Eine Folge des Globalisierungsprozesses?
- 6.1 Ursachen und Entstehung der „negativen“ Globalisierungsauswirkungen
- 7 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung und die Herausforderungen des kommunalen Wohnprojekts Co-op City im Bronx-Stadtteil von New York. Ziel ist es, die Entstehung, Struktur und die sozioökonomischen Entwicklungen dieses Projekts im Kontext der Stadt New York zu analysieren und dessen Bedeutung im Kontext der Globalisierung zu beleuchten.
- Entstehung und Entwicklung von Co-op City
- Sozioökonomische Struktur von Co-op City und New York
- Infrastruktur und Einrichtungen in Co-op City
- Probleme und Herausforderungen von Co-op City (z.B. Kriminalität, Segregation)
- Bezug zu Globalisierungsprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Gegenstand und das Ziel der Arbeit, welches darin besteht, die Entwicklung und die Probleme des kommunalen Wohnprojekts Co-op City in New York zu untersuchen. Der Aufbau der Arbeit wird ebenfalls skizziert, um dem Leser einen klaren Überblick über die Struktur und den Verlauf der Analyse zu geben. Der Fokus liegt auf der Analyse von Co-op City als Fallbeispiel für die komplexen Herausforderungen städtischer Wohnungspolitik und sozialer Integration.
2 New York - Strukturmerkmale: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die Strukturmerkmale von New York City. Es analysiert die geographische Lage, die Bevölkerungsstruktur (einschließlich Dichte, ethnischer Zusammensetzung und sozialer Schichtung), den Arbeitsmarkt und das Problem der Armut. Es beleuchtet auch die vielschichtige kulturelle Zusammensetzung der Stadt und diskutiert den Status New Yorks als Weltstadt und Global City. Die verschiedenen Abschnitte sind miteinander verwoben, um ein komplexes Bild der Stadt und ihrer Herausforderungen zu zeichnen, welches den Kontext für die spätere Analyse von Co-op City bildet.
3 Co-op City - Entstehung eines kommunalen „Housing Project“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung von Co-op City. Es beschreibt die geographische Lage, die beteiligten Akteure (insbesondere das Mitchell-Lama Housing Program und die Riverbay Cooperation), und die dahinterliegenden Initiativen und Ziele. Es erläutert den Prozess der Gründung und Entwicklung dieser großen Wohnanlage und stellt die wichtigsten Akteure und ihr Engagement vor, um den Kontext der Entstehung von Co-op City zu verdeutlichen. Der Abschnitt beleuchtet die politischen und wirtschaftlichen Bedingungen, die zur Realisierung dieses Großprojekts geführt haben.
4 Co-op City - Die Strukturmerkmale: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Strukturmerkmale von Co-op City. Es beschreibt die Einrichtungen (Bildungs- und Freizeitangebote) und die Infrastruktur (Verkehrsplanung und innerstädtische Anbindung). Durch die detaillierte Beschreibung der Einrichtungen und der Infrastruktur wird ein umfassendes Bild des Lebens in Co-op City vermittelt. Die Beschreibung der Infrastruktur dient dazu, die Möglichkeiten und Einschränkungen des Wohnprojekts hinsichtlich der Anbindung an die Stadt und die Teilhabe am städtischen Leben zu beleuchten.
5 Entwicklungsprozesse Co-op Citys seit 1979: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklungsprozesse in Co-op City seit 1979. Es untersucht die Veränderungen der Bevölkerungsstruktur, insbesondere im Hinblick auf den Wandel zu einer „Naturally Occurring Retirement Community“ (NORC). Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Problemen und den Lösungsansätzen, die im Laufe der Zeit entstanden sind (z.B. Segregation, Kriminalität, Drogen). Die Darstellung der Entwicklungsprozesse verdeutlicht die Herausforderungen, denen sich das Wohnprojekt im Laufe der Zeit gegenübergestellt sah, und analysiert die Effektivität der eingeleiteten Maßnahmen.
6 Soziale Fragmentierung am Beispiel Co-op City - Eine Folge des Globalisierungsprozesses?: Dieses Kapitel untersucht die soziale Fragmentierung in Co-op City und fragt nach den Ursachen und Zusammenhängen mit der Globalisierung. Es analysiert kritisch die „negativen“ Auswirkungen der Globalisierung auf soziale Strukturen und untersucht, inwieweit diese Auswirkungen in Co-op City sichtbar werden. Das Kapitel verknüpft die lokale Situation mit globalen Prozessen und diskutiert die komplexen Ursachen und Folgen sozialer Fragmentierung im Kontext von Globalisierung.
Schlüsselwörter
Co-op City, New York, Wohnungsbau, kommunales Wohnprojekt, soziale Segregation, Kriminalität, Armut, Globalisierung, Mitchell-Lama Housing Program, Riverbay Cooperation, NORC (Naturally Occurring Retirement Community), soziale Integration, Stadtentwicklung, Infrastruktur.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Co-op City in New York
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung und Herausforderungen des kommunalen Wohnprojekts Co-op City im New Yorker Stadtteil Bronx. Im Fokus stehen Entstehung, Struktur, sozioökonomische Entwicklungen und die Bedeutung im Kontext der Globalisierung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel ist die Analyse der Entstehung, Struktur und sozioökonomischen Entwicklung von Co-op City im Kontext von New York City und die Beleuchtung der Bedeutung des Projekts im Kontext der Globalisierung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung von Co-op City, die sozioökonomische Struktur von Co-op City und New York, die Infrastruktur und Einrichtungen in Co-op City, Probleme und Herausforderungen (Kriminalität, Segregation), und den Bezug zu Globalisierungsprozessen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den Strukturmerkmalen New Yorks, der Entstehung und Struktur von Co-op City, den Entwicklungsprozessen seit 1979, der sozialen Fragmentierung im Kontext der Globalisierung und einem Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Analyse.
Welche Strukturmerkmale von New York City werden untersucht?
Die Analyse umfasst die geographische Lage, Bevölkerungsstruktur (Dichte, ethnische Zusammensetzung, soziale Schichtung), Arbeitsmarkt, Armut, kulturelle Vielfalt und New Yorks Status als Weltstadt und Global City.
Wie wird die Entstehung von Co-op City beschrieben?
Die Entstehung von Co-op City wird durch die Beschreibung der geographischen Lage, der beteiligten Akteure (Mitchell-Lama Housing Program und Riverbay Cooperation), der Initiativen und Ziele, sowie der politischen und wirtschaftlichen Bedingungen beleuchtet.
Welche Strukturmerkmale von Co-op City werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Einrichtungen (Bildungs- und Freizeitangebote) und die Infrastruktur (Verkehrsplanung und innerstädtische Anbindung) von Co-op City.
Welche Entwicklungsprozesse in Co-op City seit 1979 werden betrachtet?
Die Analyse umfasst Veränderungen der Bevölkerungsstruktur (insbesondere den Wandel zu einer NORC), Probleme (Segregation, Kriminalität, Drogen) und Lösungsansätze.
Wie wird die soziale Fragmentierung in Co-op City behandelt?
Die Arbeit untersucht die soziale Fragmentierung in Co-op City und deren mögliche Zusammenhänge mit den „negativen“ Auswirkungen der Globalisierung auf soziale Strukturen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Co-op City, New York, Wohnungsbau, kommunales Wohnprojekt, soziale Segregation, Kriminalität, Armut, Globalisierung, Mitchell-Lama Housing Program, Riverbay Cooperation, NORC, soziale Integration, Stadtentwicklung, Infrastruktur.
- Quote paper
- N. Hoffmeister (Author), 2004, Co-op City (Bronx/New York) Entwicklung und Probleme eines kommunalen Housing Project, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28660