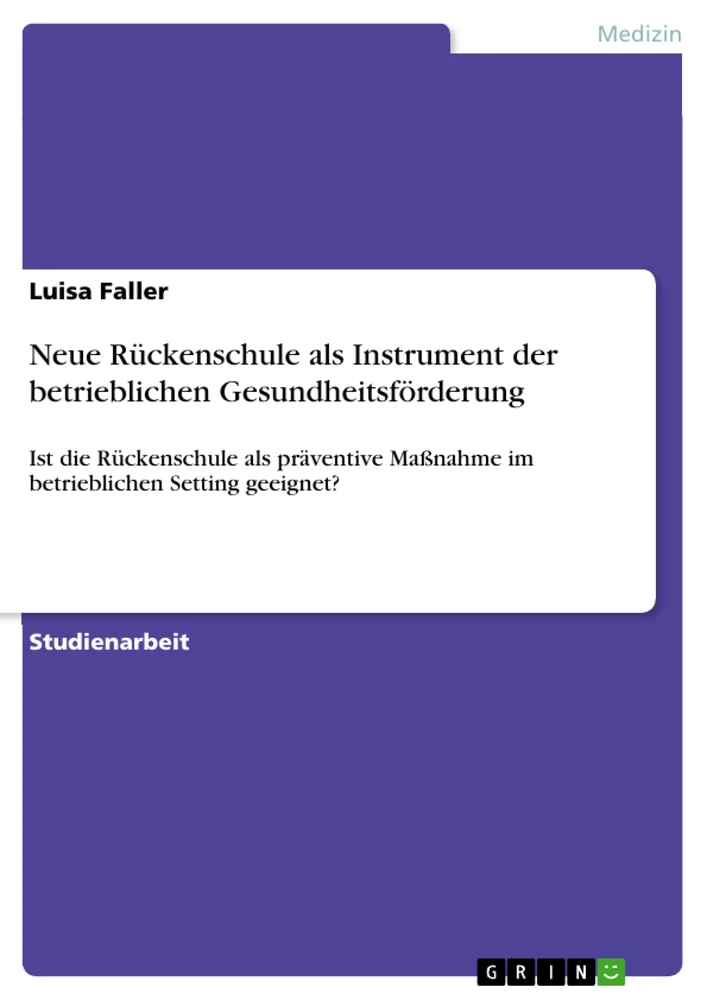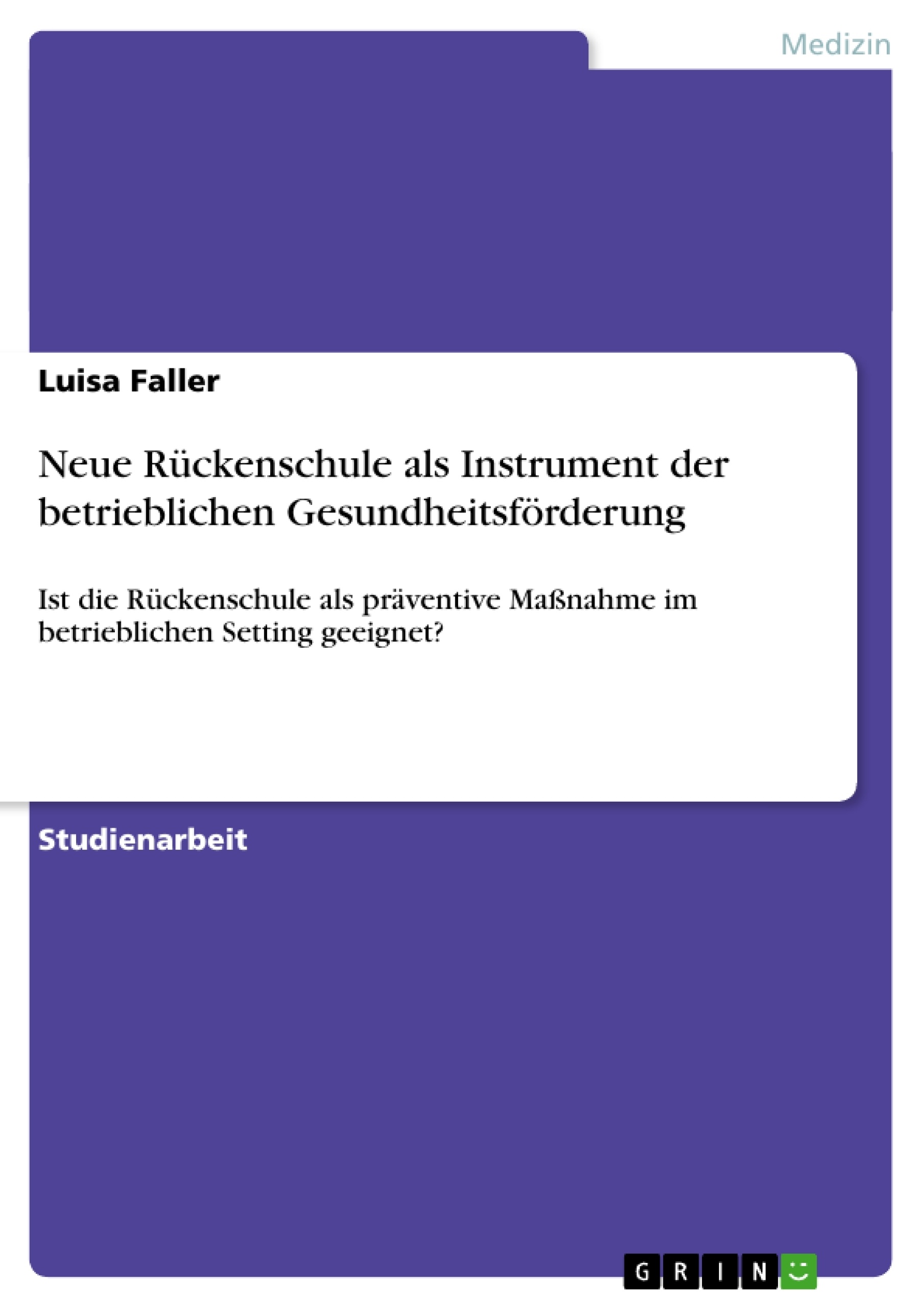Im "Betriebskrankenkassen" (BKK) Gesundheitsreport 2013 ist zu lesen: "Rückenschmerzen sorgen für die meisten Ausfalltage - Krankenstand 2013 steigt marginal über den Wert von 2012 (...). Obwohl die körperlichen Belastungen der Arbeitnehmer kontinuierlich abgenommen haben, bleibt der Rückenschmerz das Volksleiden Nummer eins." (BKK Presseinformation, 2013). Auch heißt es im Bericht "Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit" (Suga): "Mit 10,0 Milliarden Euro Produktionsausfall und 17,3 Milliarden Euro Ausfall an Bruttowertschöpfung besteht bei Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems das größte Präventionspotenzial.“ (Suga 2011, S. 41). Zu dieser Krankheitsklasse zählen vor allem die Rückenleiden. Aktuelle Zahlen des Fehlzeiten-Reports 2013 zeigen, dass Rückenbeschwerden als häufigste gesundheitliche Beschwerden zu 81,3 % in Zusammenhang zum Arbeitsplatz stehen (Badura, Ducki, Schörder, Klose & Meyer, 2013). Wie aktuelle Veröffentlichungen zeigen, sind Rückenschmerzen am Arbeitsplatz ein mit hohen Kosten verbundenes, häufig auftretendes Problem. Es bietet sich daher an im Betrieb Maßnahmen zur Senkung der Arbeitsunfähigkeit durch Rückenschmerzen durchzuführen.
Im Sinne dessen widmet sich die vorliegende Arbeit der Rückenschule als die am häufigsten durchgeführte Maßnahme zur Prävention von Rückenbeschwerden am Arbeitsplatz. Zunächst wird auf die Epidemiologie und Risikofaktoren von Rückenschmerzen eingegangen, anschließend die entstehenden ökonomischen Kosten erläutert und auf die Maßnahmen zur Förderung der Rückengesundheit im Betrieb inklusive der Rückenschule eingegangen. Diese wird in ihrer Wirksamkeit durch Betrachtung von Evaluationsstudien und ihrer Eignung als Instrument der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergründe zu unspezifischen Rückenschmerzen
- Definition und Verlauf von unspezifischen Rückenschmerzen
- Definition der unspezifischen Rückenschmerzen
- Verlauf bezüglich der Chronifizierung
- Prävalenz und Kosten von unspezifischen Rückenschmerzen
- Prävalenz von Rückenschmerzen
- Kosten der Rückenschmerzen
- Risikofaktoren der Rückenschmerzentstehung und Chronifizierung
- Arbeitsbedingte körperliche Risikofaktoren
- Arbeitsbedingte psychosoziale Risikofaktoren
- Chronifizierungsbegünstigende psychosoziale Risikofaktoren
- Allgemeine arbeitsplatzunabhängige Risikofaktoren
- Definition und Verlauf von unspezifischen Rückenschmerzen
- Maßnahmen zur Prävention chronischer Rückenschmerzen im betrieblichen Setting
- Vorteile rückenschmerzpräventiver Maßnahmen im Betrieb
- Handlungspunkte zur Prävention von Rückenschmerzen im betrieblichen Kontext
- Verhalten- und verhältnisorientierte Mehrkomponentenprogramme
- Das Instrument Rückenschule
- Klassische Rückenschulen
- Die neue Rückenschule
- Vergleich von klassischer und neuer Rückenschule
- Inanspruchnahme der Rückenschule in Betrieben
- Wirksamkeit der betrieblichen Rückenschule
- Wirksamkeit der klassischen Rückenschule
- Wirksamkeit der neuen Rückenschule
- Evaluation der neuen Rückenschule anhand einer Einzelstudie
- Diskussion über Stellenwert und Grenzen der Rückenschule
- Kritische Betrachtung der Studienlage
- Ausblick und Grenzen des Instruments Rückenschule
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung der Rückenschule als präventive Maßnahme im betrieblichen Kontext, insbesondere im Hinblick auf die Reduzierung von Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Rückenschmerzen. Die Arbeit analysiert die Wirksamkeit der Rückenschule, sowohl klassischer als auch neuer Ansätze, und beleuchtet die Bedeutung dieses Instruments im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF). Dabei wird auch auf die Herausforderungen und Grenzen der Rückenschule im betrieblichen Setting eingegangen.
- Epidemiologie und Risikofaktoren unspezifischer Rückenschmerzen
- Kosten und Präventionspotenzial von Rückenschmerzen im betrieblichen Kontext
- Wirksamkeit von Rückenschulprogrammen im Vergleich (klassisch vs. neu)
- Stellenwert der Rückenschule als Instrument der BGF
- Herausforderungen und Grenzen der Rückenschule im betrieblichen Setting
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Rückenschmerzen, beleuchtet die Prävalenz, Kosten und Risikofaktoren, die mit unspezifischen Rückenschmerzen im beruflichen Setting verbunden sind. Anschließend werden die Vorteile und Handlungspunkte rückenschmerzpräventiver Maßnahmen im Betrieb erläutert, wobei der Fokus auf Mehrkomponentenprogramme liegt. Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Instrument Rückenschule und analysiert die Unterschiede zwischen klassischen und neuen Rückenschulen. In Kapitel 5 wird die Wirksamkeit der Rückenschule anhand von Evaluationsstudien beleuchtet, wobei sowohl die klassische als auch die neue Rückenschule betrachtet werden. Kapitel 6 widmet sich einer kritischen Diskussion über den Stellenwert und die Grenzen der Rückenschule als Instrument der BGF.
Schlüsselwörter
Unspezifische Rückenschmerzen, Betriebliche Gesundheitsförderung, Prävention, Rückenschule, Mehrkomponentenprogramme, Wirksamkeit, Kosten, Risikofaktoren, Arbeitsunfähigkeit, Chronifizierung, Studienlage.
- Quote paper
- Luisa Faller (Author), 2014, Neue Rückenschule als Instrument der betrieblichen Gesundheitsförderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285933