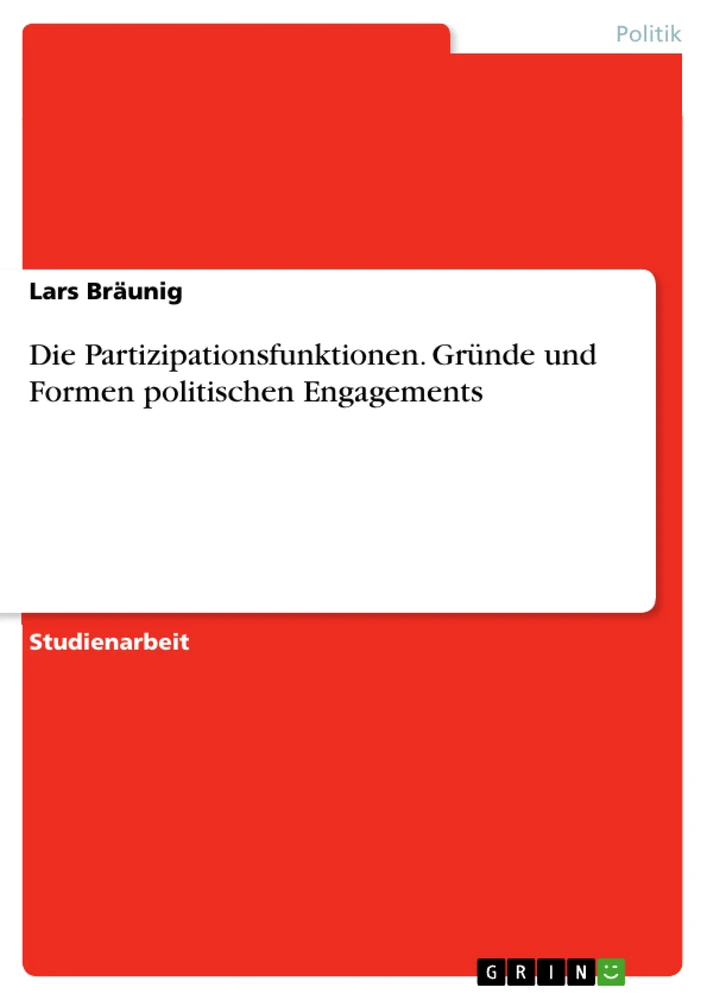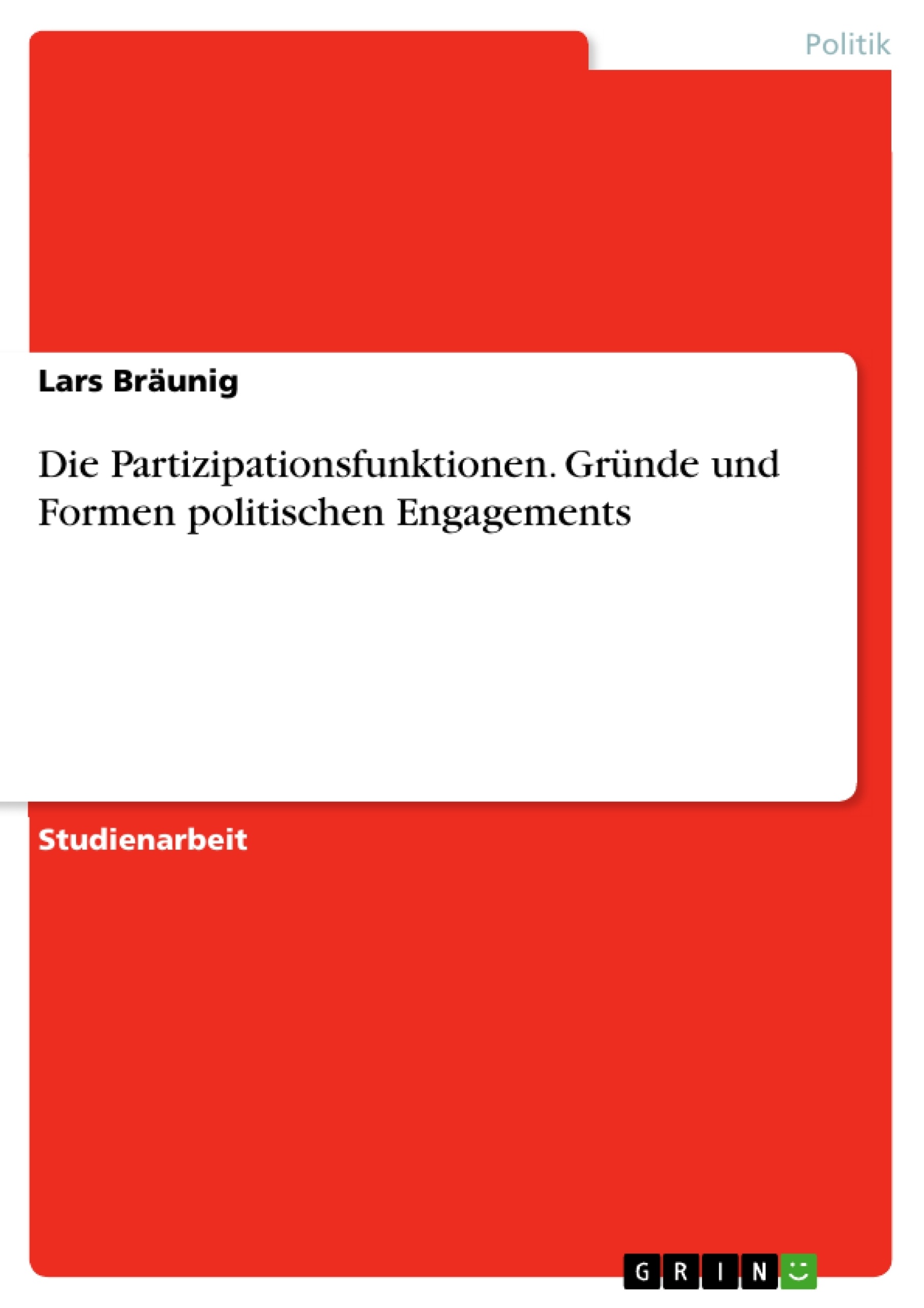Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Erörterung der politischen Partizipation in der Bundesrepublik Deutschland. Es sollen Kriterien und Indikatoren aufgezeigt werden, die eine Teilnahme an der politischen Willensbildung sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Es sollen Gründe aufgezeigt werden, wie und warum sich das politische Engagement in Deutschland unter welchen Bedingungen verändert hat.
Da sich in der Literatur keine eindeutige, sich zum Teil sogar widersprechende Definitionen für den Begriff „politischer Partizipation“ finden liess, werde ich zu Beginn klären, wie er während dieser Arbeit verstanden werden soll.
Zur Erlangung von Erkenntnissen innerhalb der Partizipationsforschung werden Informationen aus Bevölkerungsumfragen verwendet, die nach statistischen Korrelationsberechnungen Rückschlüsse auf Zusammenhänge erlauben. Gerade weil die hier erörterten Erkenntnisse aufgrund von Stichprobenauswertung auf die gesamte deutsche Bevölkerung übertragen werden, werden erste Fehlerquellen für allgemein angewendete Aussagen deutlich. Diese ergeben sich dadurch, dass Befragungen generell nicht in allen Bevölkerungsschichten durchführt werden, bzw. einige Personenkreise Erhebungen nicht zulassen.
Um eine politische Beteiligung der Bevölkerung nachvollziehen zu können, habe ich das Modell des „Rational-Choice-Ansatzes“ und spezifisch das von A. Downs für den „rationalen Wähler“ angewandt. Dieses grundsätzlich einfache Modell wurde in der Literatur unterschiedlich interpretiert. Aus diesem Grund halte ich es für angemessen, ihn eingangs ebenfalls kurz zu erklären.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist politisch motiviertes Handeln?
- 2.1 Der Nichtwähler
- 3. Messverfahren für politisches Engagement
- 4. Der „Rational-Choice-Ansatz“
- 5. Indikatoren für politisches Engagement
- 5.1 Faktor: Geschlecht
- 5.2 Faktor: Alter
- 5.3 Faktor: Bildung und Beruf
- 5.3.1 Faktor: sozio-ökonomische Situation
- 5.4 Faktor: soziales Umfeld
- 5.4.1 Die Wahlnorm
- 5.5 Faktor: Stellenwert des zu wählenden Organs
- 6. Fazit
- 7. Literaturverzeichnis
- 7.1 Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die politische Partizipation in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, Kriterien und Indikatoren aufzuzeigen, die die Teilnahme an der politischen Willensbildung beeinflussen, sowohl positiv als auch negativ. Es werden Gründe dafür erforscht, wie und warum sich das politische Engagement in Deutschland verändert hat.
- Definition und Abgrenzung politischer Partizipation
- Analyse des „Rational-Choice-Ansatzes“ im Kontext politischer Partizipation
- Einfluss soziodemografischer Faktoren auf politisches Engagement
- Untersuchung verschiedener Formen politischen Engagements (legal und illegal)
- Das Phänomen der Nichtwähler
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der politischen Partizipation in Deutschland ein und erläutert die Forschungsfrage. Sie thematisiert die Schwierigkeiten bei der Definition von „politischer Partizipation“ und die methodischen Herausforderungen der Partizipationsforschung, insbesondere die Einschränkungen von Stichprobenauswertungen und die Problematik der Übertragbarkeit auf die Gesamtbevölkerung. Die Arbeit kündigt die Anwendung des „Rational-Choice-Ansatzes“ an und begründet dessen Verwendung.
2. Was ist politisch motiviertes Handeln?: Dieses Kapitel definiert politisch motiviertes Handeln und beleuchtet die verschiedenen Formen des politischen Engagements, von konventionellen (Wahlen, Parteimitgliedschaft) bis hin zu unkonventionellen Methoden (Demonstrationen, Boykotte). Es wird die Problematik der Einordnung illegaler Handlungen diskutiert und der Einfluss von Faktoren wie der Wahlbeteiligung und dem Engagement von NGOs betrachtet. Das Kapitel stellt die Frage nach der Berücksichtigung mentaler oder geistiger Partizipation.
2.1 Der Nichtwähler: Dieser Abschnitt fokussiert sich auf das Phänomen des Nichtwählens und differenziert zwischen technischen (z.B. nicht in Wählerlisten vermerkt) und bekennenden Nichtwählern. Er hebt die Schwierigkeiten bei der Ermittlung der genauen Zahl der Nichtwähler und die damit verbundenen methodischen Herausforderungen hervor.
Schlüsselwörter
Politische Partizipation, Deutschland, Rational-Choice-Ansatz, Wahlbeteiligung, Nichtwähler, soziodemografische Faktoren, politisches Engagement, legale und illegale Formen des Protests, NGOs.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Politische Partizipation in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die politische Partizipation in der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die Faktoren, die die Teilnahme an der politischen Willensbildung beeinflussen, und erforscht die Gründe für Veränderungen im politischen Engagement.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung politischer Partizipation, den Rational-Choice-Ansatz im Kontext politischer Partizipation, den Einfluss soziodemografischer Faktoren (Geschlecht, Alter, Bildung, Beruf, soziales Umfeld), verschiedene Formen politischen Engagements (legal und illegal), das Phänomen der Nichtwähler und die methodischen Herausforderungen der Partizipationsforschung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Was ist politisch motiviertes Handeln? (inkl. Unterkapitel zum Nichtwähler), Messverfahren für politisches Engagement, Der „Rational-Choice-Ansatz“, Indikatoren für politisches Engagement (mit Unterkapiteln zu Geschlecht, Alter, Bildung/Beruf, sozio-ökonomischer Situation, sozialem Umfeld und dem Stellenwert des zu wählenden Organs), Fazit und Literaturverzeichnis.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit will Kriterien und Indikatoren aufzeigen, die die Teilnahme an der politischen Willensbildung beeinflussen (positiv und negativ). Sie untersucht, wie und warum sich das politische Engagement in Deutschland verändert hat.
Wie wird der „Rational-Choice-Ansatz“ in der Arbeit verwendet?
Der „Rational-Choice-Ansatz“ wird angewendet, um das politische Engagement zu analysieren und zu erklären. Die Arbeit begründet die Verwendung dieses Ansatzes und diskutiert seine Anwendbarkeit im Kontext der politischen Partizipation.
Welche soziodemografischen Faktoren werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Geschlecht, Alter, Bildung und Beruf (inkl. sozio-ökonomischer Situation) und sozialem Umfeld auf das politische Engagement.
Wie wird das Phänomen der Nichtwähler behandelt?
Der Abschnitt zum Nichtwähler differenziert zwischen technischen und bekennenden Nichtwählern und hebt die Schwierigkeiten bei der Ermittlung der genauen Zahl der Nichtwähler und die damit verbundenen methodischen Herausforderungen hervor.
Welche Formen politischen Engagements werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet sowohl konventionelle Formen des politischen Engagements (Wahlen, Parteimitgliedschaft) als auch unkonventionelle Methoden (Demonstrationen, Boykotte) und diskutiert die Problematik der Einordnung illegaler Handlungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Politische Partizipation, Deutschland, Rational-Choice-Ansatz, Wahlbeteiligung, Nichtwähler, soziodemografische Faktoren, politisches Engagement, legale und illegale Formen des Protests, NGOs.
Welche methodischen Herausforderungen werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Schwierigkeiten bei der Definition von „politischer Partizipation“, die Einschränkungen von Stichprobenauswertungen und die Problematik der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Gesamtbevölkerung.
- Quote paper
- Lars Bräunig (Author), 2005, Die Partizipationsfunktionen. Gründe und Formen politischen Engagements, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285785