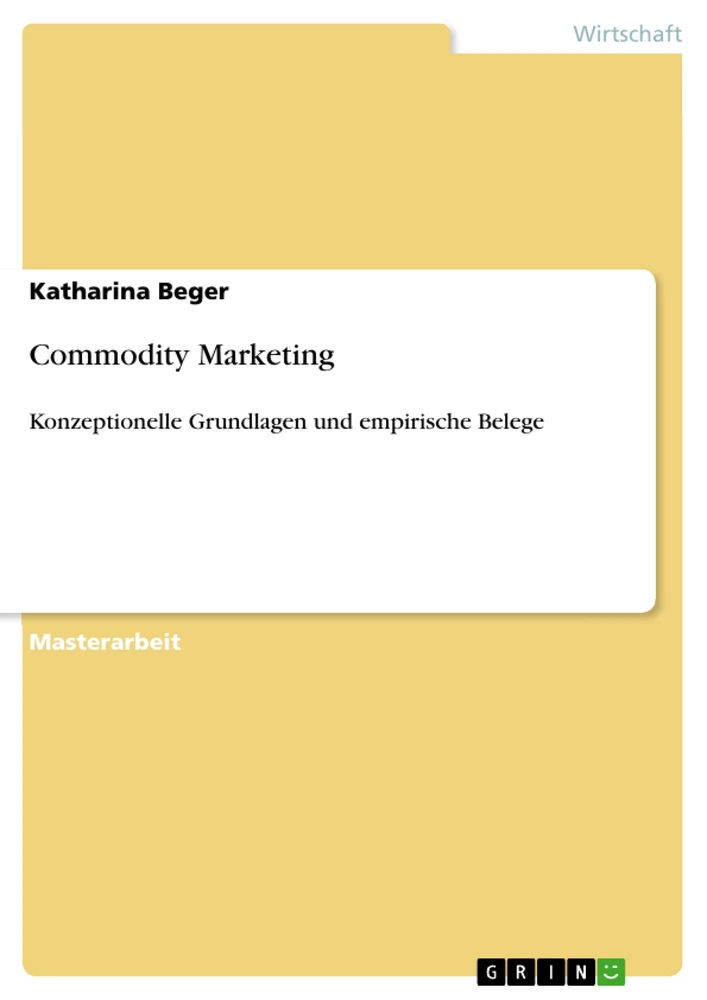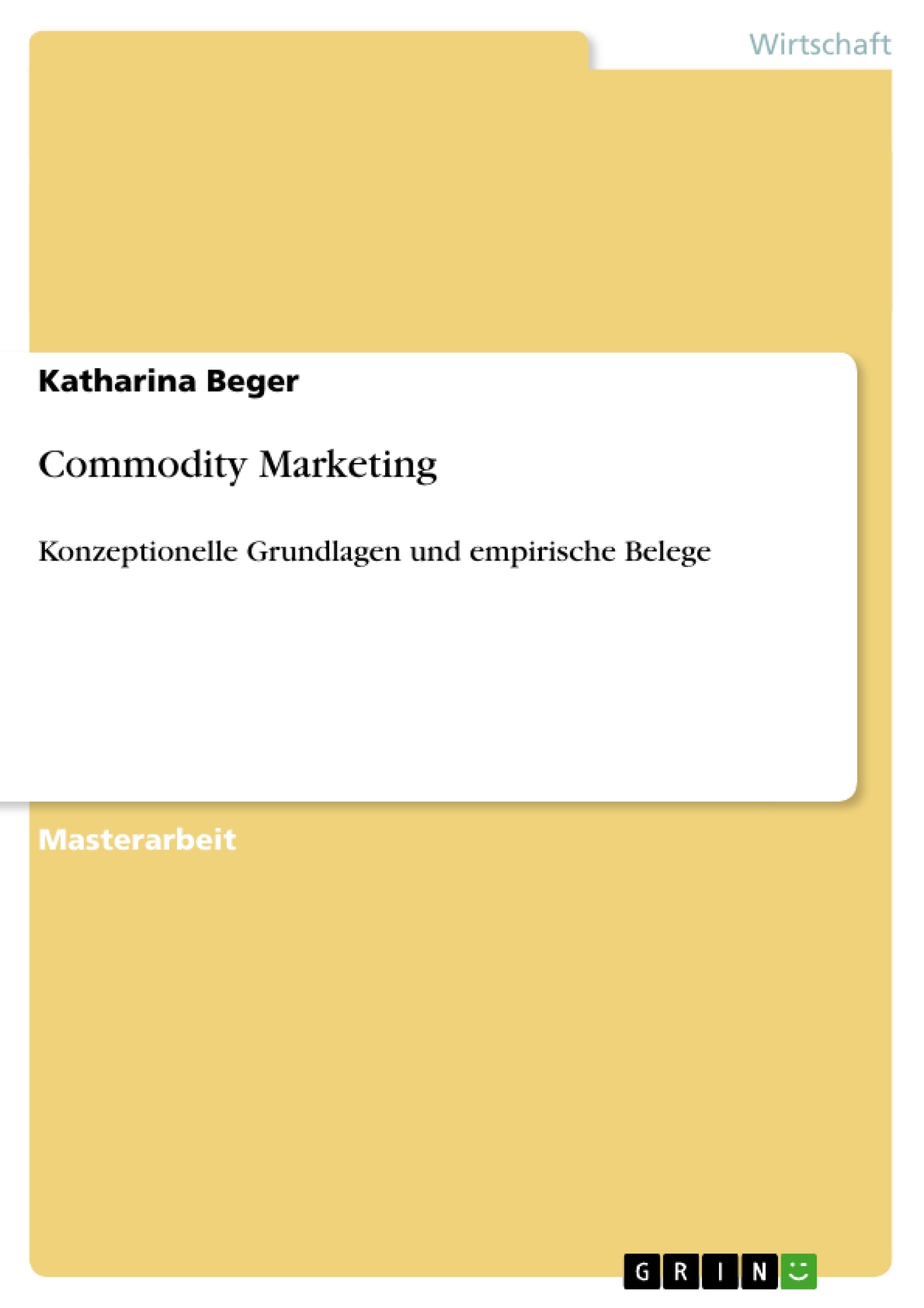„Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, de-livering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large” (American Marketing Association 2013). Gemäß dieser Definition dient Marketing der Generierung eines Nutzens – dem Grad der Bedürfnisbefriedigung, den ein Kunde erlangt, wenn er ein Gut erwirbt (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2012, S. 16). Kunden entscheiden sich immer dann für den Kauf eines Gutes, wenn dieses im Vergleich zu den Angeboten anderer Unternehmen eher geeignet ist, ein Kundenbedürfnis zu befriedigen (vgl. Chamberlin 1965, S. 56; Dickson/Ginter 1987, S. 2). Diese Eignung zur Bedürfnisbefriedigung steigt, je differenzierter ein Angebot im Vergleich zu Alternativangeboten positioniert ist (vgl. Dickson/Ginter 1987, S. 2). Unternehmen stehen folglich vor der Aufgabe, ihre eigenen Angebote vom Wettbewerb zu differenzieren (vgl. Enke/Geigenmüller/Leischnig 2014, S. 4).
Viele Unternehmen produzieren und vermarkten jedoch Produkte oder Dienstleistungen, die von Natur aus undifferenziert sind oder aus verschiedenen Gründen von den Nachfragern als undifferenziert wahrgenommen werden – sogenannte Commodities. Für diese Art der Ange-bote ist es folglich ungleich schwieriger, eine differenzierte Etablierung am Markt zu erzielen. Doch immer mehr Industrien sehen sich mit einem Trend der Commoditisierung – dem Pro-zess, durch den Leistungen den Commodity-Status annehmen – konfrontiert. Waren es vor einigen Jahren nur Papiertaschentücher, Chemikalien oder Bananen, zählen heute auch High-tech-Industrien dazu, die einst eine überragende Marktposition innehatten. Kennzeichnend für diese Art von Leistungen ist der Fokus der Kunden auf den Preis als hauptsächliches Ent-scheidungskriterium beim Kauf (vgl. Calori/Ardisson 1988, S. 255; Enke/Geigenmül-ler/Leischnig 2014, S. 4f.; Greenstein 2004, S. 73; Matthyssens/Vandenbempt 2008, S. 317; Reimann/Schilke/Thomas 2010, S. 188).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Vollkommener Wettbewerbsmarkt
- Produktlebenszyklus
- Individuelle Entscheidungen
- Commodities und Commoditisierung
- Begriffsabgrenzung
- Definitionsanalyse
- Leistungstypologien
- Operationalisierung des Konstrukts Commodity
- Empirisch untersuchte Dimensionen und Skalen
- Konzeption weiterer Dimensionen und Skalen
- Ursachen der Commoditisierung
- Klassifikation der Ursachen
- Leistungsbezogene Ursachen
- Kundenbezogene Ursachen
- Unternehmensbezogene Ursachen
- Marktbezogene Ursachen
- Wirkungen der Commoditisierung
- Begriffsabgrenzung
- Implikationen für Forschung und Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen umfassenden Überblick über die Phänomene Commodity und Commoditisierung zu bieten. Dazu werden zunächst theoretische Modelle vorgestellt und anschließend auf Grundlage einer umfassenden Literaturanalyse definiert und abgegrenzt. Anschließend werden Möglichkeiten zur Messung der Konstrukte präsentiert. Aufgrund der bisher gering ausgeprägten Operationalisierung von Commodities und Commoditisierung werden in diesem Zusammenhang ausgehend von der analytischen Herleitung des Begriffsverständnisses weitere Dimensionen und Skalen zur Operationalisierung entwickelt. Im weiteren Verlauf werden die Ursachen der Commoditisierung identifiziert und systematisiert. In den einzelnen Bereichen Leistung, Kunde, Unternehmen und Markt werden verschiedene Determinanten vorgestellt, die die Commoditisierung von Leistungen begünstigen können. Abschließend wird das komplexe Wirkungsgeflecht von Commoditisierung abgebildet und inhaltlich beleuchtet, bevor Implikationen für weitere Forschungsarbeiten und die Praxis erläutert werden.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Commodity und Commoditisierung
- Operationalisierung und Messung des Konstrukts Commodity
- Identifizierung und Systematisierung der Ursachen der Commoditisierung
- Analyse des Wirkungsgefüges der Commoditisierung
- Implikationen für Forschung und Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel dieser Arbeit führt in die Thematik von Commodities und Commoditisierung ein und legt die Bedeutung der Differenzierung von Leistungen im Marketing dar.
- Im zweiten Kapitel werden die relevanten theoretischen Grundlagen vorgestellt. Dazu gehören das Modell des vollkommenen Wettbewerbsmarktes, das Konzept des Produktlebenszyklus und die ökonomische Theorie der individuellen Entscheidungen.
- Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Begriffsabgrenzung von Commodities und Commoditisierung. Anhand einer Analyse verschiedener Definitionen aus der Literatur werden Arbeitsdefinitionen für beide Begriffe abgeleitet. Weiterhin werden Leistungstypologien aus der Literatur vorgestellt, die Commodities direkt oder indirekt zuordnen.
- Kapitel 3.2 befasst sich mit der Operationalisierung des Konstrukts Commodity. Es werden empirisch untersuchte Dimensionen und Skalen zur Messung des Commoditisierungsgrades vorgestellt, die bisher nur von Reimann/Schilke/Thomas (2010) untersucht wurden. Ausgehend von den abgeleiteten Arbeitsdefinitionen werden weitere Dimensionen und Skalen zur Operationalisierung des Phänomens konzeptionell entwickelt.
- Kapitel 3.3 widmet sich der Analyse der Ursachen von Commoditisierung. Die verschiedenen Ursachen werden in vier Kategorien klassifiziert: leistungsbezogene, kundenbezogene, unternehmensbezogene und marktbezogene Ursachen.
- Im letzten Kapitel werden die Wirkungen der Commoditisierung beleuchtet. Es wird gezeigt, wie die Commoditisierung zu negativen Folgen für Unternehmen und Märkte führen kann.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Begriffen Commodity und Commoditisierung. Im Zentrum stehen die Definition und Abgrenzung dieser Konstrukte sowie die Identifizierung von Ursachen und Wirkungen des Commoditisierungsprozesses. Weitere Schwerpunkte sind die Operationalisierung des Konstrukts Commodity und die Ableitung von Implikationen für Forschung und Praxis.
- Quote paper
- Katharina Beger (Author), 2014, Commodity Marketing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285385