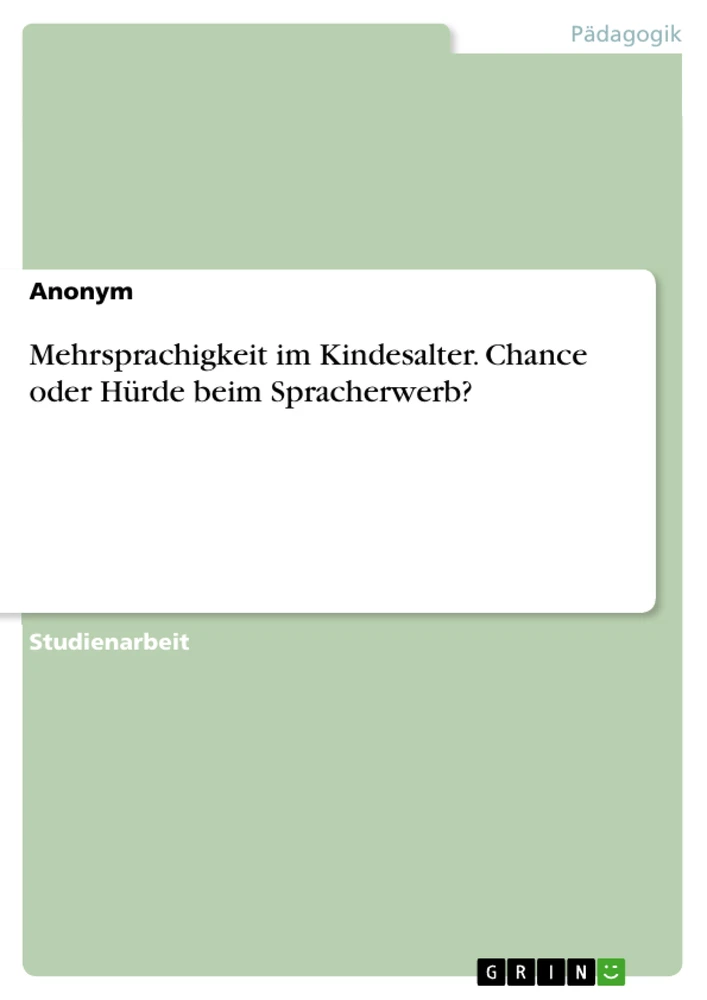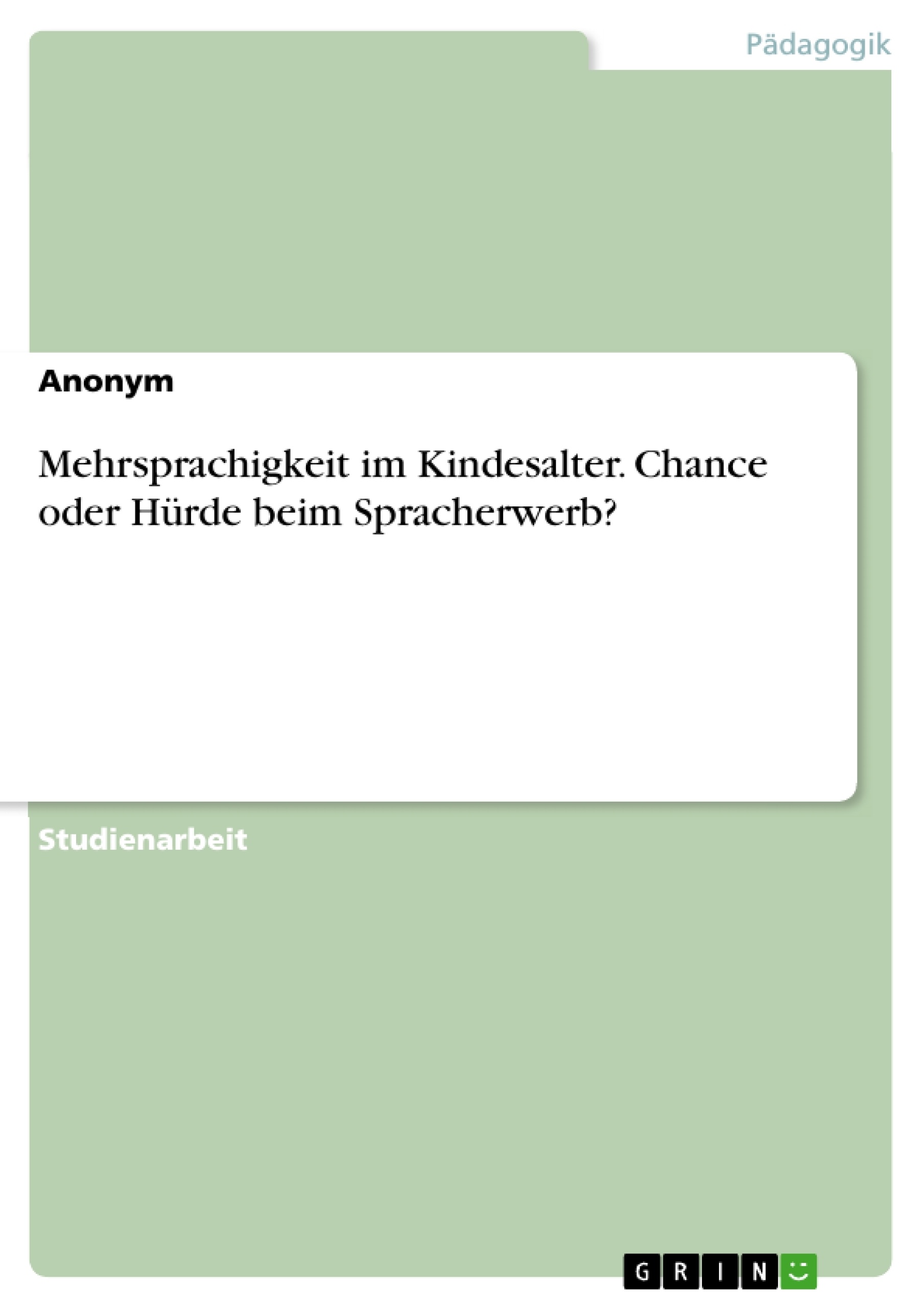Der Weg zu einer gelungenen Integration führt über den Spracherwerb. Sprache ist nämlich im menschlichen Miteinander das wichtigste Mittel zur Verständigung. Für Integration, Bildungserfolg, kulturelle Vielfalt und interkulturellen Dialog ist der Erwerb der Sprache des Aufnahmelandes „[…]die Schlüsselqualifikation, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft“ (Hesse 2008: 208). Und so hat sich Mehrsprachlichkeit zu einem festen Bestandteil unserer Gesellschaft entwickelt und stellt weltweit keine Ausnahme mehr dar.
[...]
Der Spracherwerb beginnt bereits mit der Geburt und ist äußerst komplex. Die ersten Lebensjahre des Kindes werden als sehr wichtig eingestuft (vgl. BZgA). Es sind nämlich die aufnahmefähigsten Jahre (vgl. ebd.). Für den Spracherwerb und Ausbau seiner Kompetenzen ist es der perfekte Zeitpunkt und dieser Weg zur Sprache ist mit vielen Hindernissen verbunden (vgl. ebd.). Wenn der Spracherwerb ohnehin als eine diffizile Bewältigungsaufgabe angesehen wird, die das Kind meistern muss, stellt sich hier natürlich die wichtige Frage, ob es der optimale Zeitpunkt ist, das Kind mit zwei (oder mehr) Sprachen simultan zu konfrontieren. Genau weil der frühkindliche Spracherwerb eine derartig herausgehobene Stellung in Verlauf der sprachlichen Entwicklung einnimmt und der Schlüssel für die gesellschaftliche Integration und den Bildungserfolg ist, widmet sich die vorliegende Hausarbeit der Fragestellung, was für und gegen eine mehrsprachige Erziehung spricht bzw. ob ein multilingualer Spracherwerb im Kindesalter als Chance oder Hürde zu sehen ist.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über den empirischen Forschungsstand dieser Fragestellung darzulegen. Dazu werden zunächst grundlegende Begriffe eingeführt und voneinander abgegrenzt. Um der Komplexität der Spracherwerbsaufgabe nahekommen zu können, werden dann die Phasen des Spracherwerbs beschrieben. Im darauffolgenden Kapitel werden auf Basis des Theorieteils die unterschiedlichen Pro- und Kontrapositionen dargestellt und diskutiert. Im letzten Kapitel der Arbeit werden die wichtigsten Ergebnisse noch einmal zusammengefasst. Mit einem Fazit, das einen Beitrag zu der Frage, ob Mehrsprachigkeit als Chance oder Hürde beim Spracherwerb zu sehen ist, leisten soll, schließt die Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Was heißt Mehrsprachigkeit?
- Phasen des Spracherwerbs
- Das „Für und Wider“ der kindlichen Mehrsprachigkeit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Frage, ob Mehrsprachigkeit im Kindesalter eine Chance oder eine Hürde beim Spracherwerb darstellt. Ziel ist es, einen Überblick über den empirischen Forschungsstand zu diesem Thema zu geben und die unterschiedlichen Pro- und Kontrapositionen zu beleuchten.
- Definition und Formen der Mehrsprachigkeit
- Phasen des Spracherwerbs und deren Einfluss auf die Mehrsprachigkeit
- Vorteile und Herausforderungen der kindlichen Mehrsprachigkeit
- Kognitive und soziale Auswirkungen von Mehrsprachigkeit
- Rolle des Elternhauses und der Bildungseinrichtungen bei der Förderung der Mehrsprachigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der interkulturellen Bildung und Kompetenz ein und erläutert die Bedeutung der Mehrsprachigkeit in einer globalisierten und heterogenen Gesellschaft. Der "Pisa-Schock" von 2001 wird als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Sprachkompetenz von mehrsprachig aufwachsenden Kindern genannt. Die Arbeit zielt darauf ab, die Frage zu beantworten, ob Mehrsprachigkeit im Kindesalter als Chance oder Hürde betrachtet werden sollte.
Hauptteil
Was heißt Mehrsprachigkeit?
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Mehrsprachigkeit und differenziert zwischen simultanem und sukzessivem Bilingualismus. Die verschiedenen Formen des Spracherwerbs werden erklärt, wobei der Schwerpunkt auf dem frühen und kindlichen Zweitspracherwerb liegt.
Phasen des Spracherwerbs
Der Erwerb einer Sprache wird als ein komplexer Prozess beschrieben, der verschiedene Entwicklungsstufen durchläuft. Die vier Meilensteine des Spracherwerbs in der deutschen Sprache werden erläutert und es wird gezeigt, dass der Erwerb der zweiten Sprache in hohem Maße der monolingualen Sprachentwicklung gleicht.
Das „Für und Wider“ der kindlichen Mehrsprachigkeit
Dieses Kapitel beleuchtet die kontroversen Diskussionen über die Auswirkungen der Mehrsprachigkeit auf die sprachliche, kognitive und emotionale Entwicklung von Kindern. Verschiedene Studien und Forschungsergebnisse werden vorgestellt, die sowohl für als auch gegen die Vorteile der Mehrsprachigkeit sprechen.
Es wird die These vertreten, dass die Mehrsprachigkeit zu einem "ungemein großen Aufwand an Zeit und geistiger Kraft" führt, aber dennoch die Aneignung der strukturellen Grundgerüste beider Sprachen sehr ähnlich wie eine einsprachige Entwicklung vollzieht.
Die Fähigkeit zum Codeswitching wird nicht als sprachliches Defizit, sondern als eine Strategie betrachtet, die bilinguale Kinder entwickeln, um temporäre Lücken im Wortschatz zu schließen. Gleichzeitig wird deutlich, dass bilinguale Kinder durch den ständigen Vergleich zwischen den Sprachen eine viel tiefere Kenntnis und Orientierung in ihrer Muttersprache erlangen.
Die Arbeit geht auf die häufig geäußerte Befürchtung ein, dass mehrsprachige Kinder einen "Rückstand" in der Zweitsprache haben. Es wird argumentiert, dass dieser "Rückstand" ausgeglichen werden kann, da die Wortschatzaneignung ein lebenslanger Prozess ist.
Die Bedeutung der Eltern als Sprachvorbilder wird hervorgehoben und das Prinzip "une personne, une langue" als erfolgsversprechend dargestellt, um eine doppelte Halbsprachigkeit zu vermeiden.
Es wird gezeigt, dass bilinguale Kinder aufgrund ihrer Sprachreflexionsfähigkeit, einer tieferen Sprachkenntnis und einem differenzierten Denken entwickeln können. Die Untersuchung der Hirnareale bei monolingualen und bilingualen Kindern belegt, dass bilinguale Kinder einen Vorteil beim Erwerb weiterer Sprachen haben.
Die Forschungsergebnisse von E. Bialystok zeigen, dass mehrsprachige Kinder in metasprachlichen Aufgaben besser abschneiden und eine größere sprachliche Flexibilität sowie bessere Aufmerksamkeitskontrolle entwickeln.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Bilingualität, Spracherwerb, kindliche Entwicklung, kognitive Entwicklung, Sprachkompetenz, Codeswitching, Sprachreflexion, Interkulturelle Bildung, Integration, Heterogenität, Bildungserfolg.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Mehrsprachigkeit im Kindesalter. Chance oder Hürde beim Spracherwerb?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285359