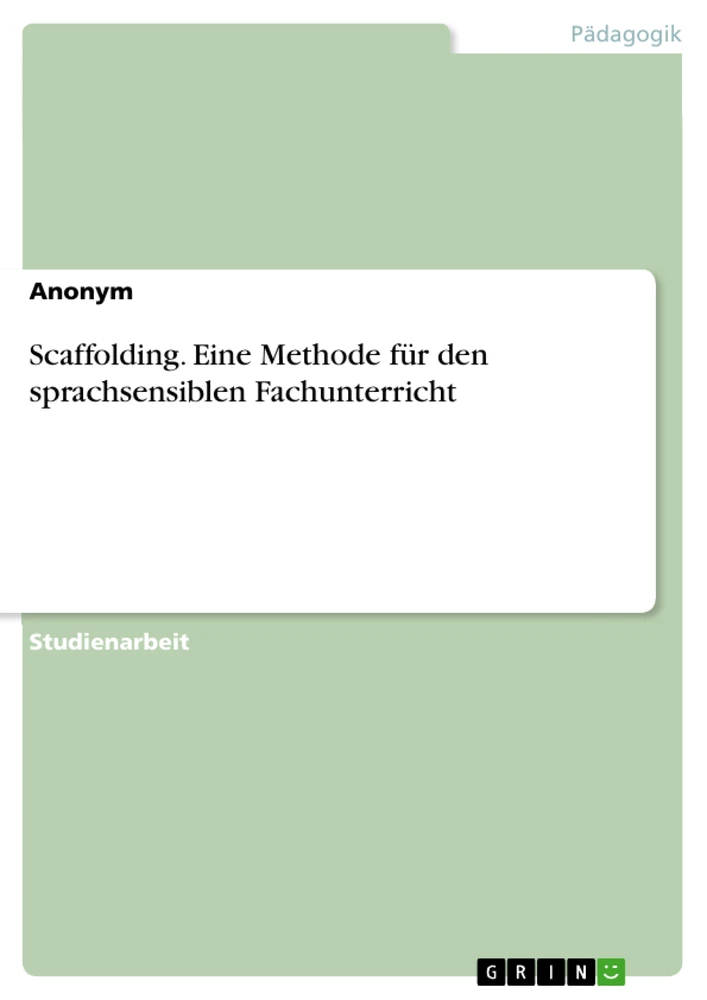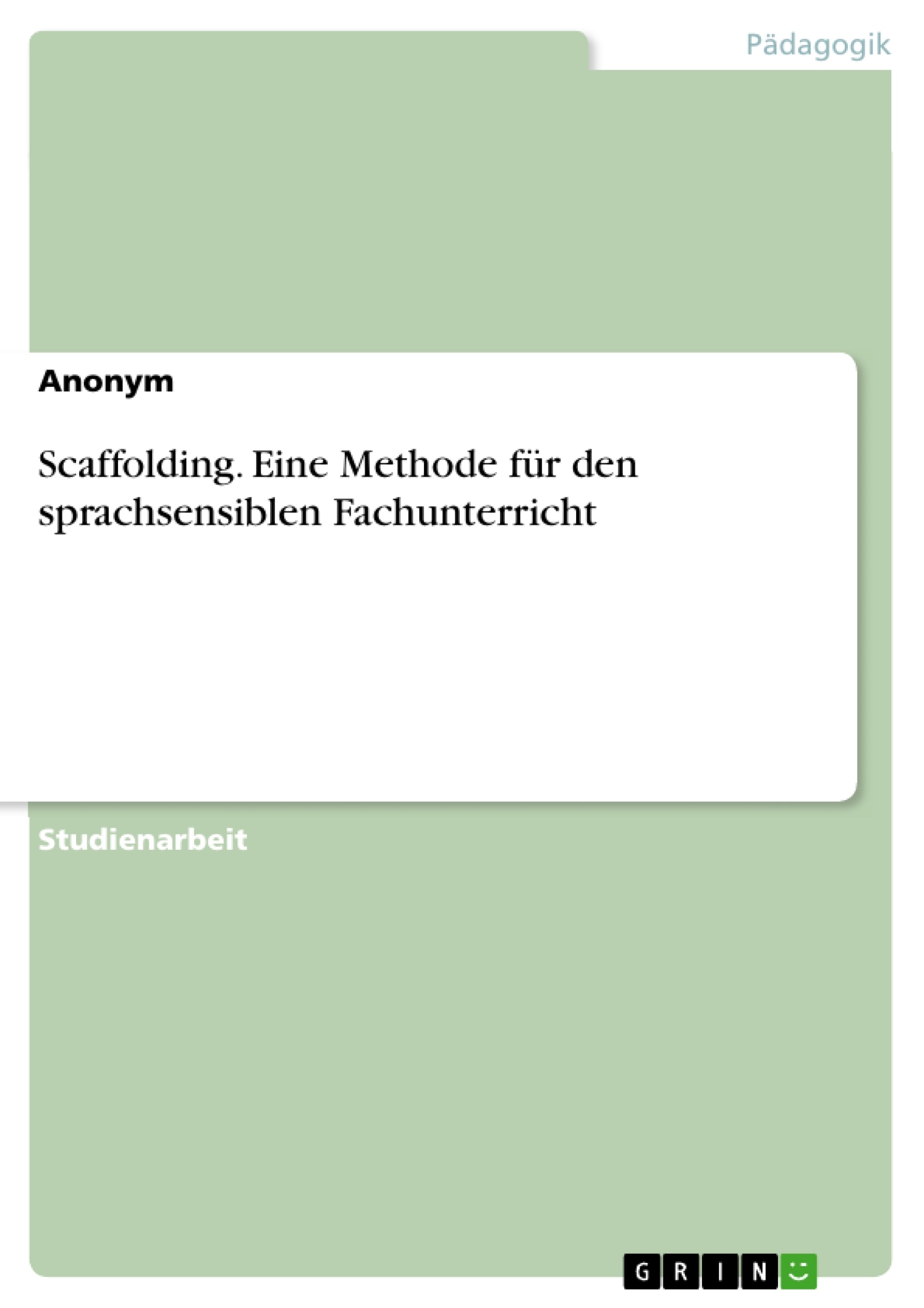Der Begriff der „Bildungssprache“ ist in der Fachliteratur kein neuer Terminus, er hat jedoch in den letzten Jahren sehr viel an Bedeutung gewonnen und ist ein zentrales Thema der Bildungspolitik (vgl. Feilke 2012: 4). Der Grund dafür ist, dass die Schule bestimmte sprachliche Kompetenzen, welche die Voraussetzungen der Bildungssprache sind, nicht lehrt. Die Sprache ist das Medium des Lehrens und Lernens (vgl. Quehl, Trapp 2013: 9). Aufgrund von defizitären bildungssprachlichen Fähigkeiten werden somit viele Schülerinnen und Schüler in der Bildungsteilhabe benachteiligt. Darunter fallen vor allem Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die mit zwei oder mehr Sprachen aufwachsen, jedoch nicht ausschließlich (vgl. Beese, Benholz et al. 2014: 7).
Dieses Problem steht seit vielen Jahren in der Bildungspolitik zur Debatte. Die internationalen Schulleistungsvergleichsstudien zeigen, dass die Interdependenz zwischen sprachlichen Kompetenzen und dem fachlichen Lernerfolg sehr groß ist (vgl. Stanat, Watermann 2002: 15). So wirken sich sprachliche Mängel auch auf das fachliche Lernen aus. „Ohne ausreichende sprachliche Kompetenzen können auch keine Kenntnisse in den Naturwissenschaften erworben werden“ (Kniffka, Siebert-Ott 2007: 9). Sprachliche Kompetenzen sind also der Schlüssel, um bildungserfolgreich sein zu können.
Daraus erwächst für die Schulen die didaktische Herausforderung eines sprachsen-siblen und sprachbewussten Unterrichts, der den unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen, gerecht werden muss. In didaktischer Hinsicht muss dabei die sprachliche Bildung als fächerübergreifende Aufgabe verstanden werden (sog. durchgängige Sprachbildung) (vgl. Beese, Benholz et al. 2014: 7).
Den Lehrerinnen und Lehrern kommt die wichtige Aufgabe zu, die sprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schülern gezielt und konsequent durch einen sprachsensiblen Fachunterricht zu fördern. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer sollten didaktische Wege einleiten, um die sprachlichen Defizite der Schülerinnen und Schüler zu kompensieren und ihre bildungssprachlichen Fähigkeiten auszubauen, und das über Fächergrenzen hinweg.
Das sogenannte „Scaffolding-Learning“ ist ein sehr junges Bildungskonzept, das genau auf dieses Ziel gerichtet ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildungssprache: Begriffsbestimmung und Abgrenzung
- Scaffolding: Begriffsbestimmung und theoretische Grundlagen
- Der Scaffolding-Unterricht und seine Merkmale und Prinzipien
- Makro-Scaffolding
- Mikro-Scaffolding
- Phasen des Scaffoldings
- Der Scaffolding-Unterricht und seine Merkmale und Prinzipien
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Scaffolding-Learning als einem Förderkonzept für den sprachsensiblen Fachunterricht und untersucht dessen Funktionsweise und Möglichkeiten, bildungssprachliche Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern zu erweitern.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Bildungssprache
- Thematisierung des Scaffolding-Learnings und seiner theoretischen Grundlagen
- Erläuterung der verschiedenen Ebenen des Konzepts (Makro- und Mikro-Scaffolding)
- Darstellung der Anwendung des Konzepts anhand eines Beispiels aus dem Geografieunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung befasst sich mit der Bedeutung der Bildungssprache im Bildungssystem und den Herausforderungen, die mit defizitären bildungssprachlichen Fähigkeiten einhergehen.
- Bildungssprache: Begriffsbestimmung und Abgrenzung: Dieses Kapitel definiert den Begriff Bildungssprache, grenzt ihn von anderen Sprachformen ab und beschreibt seine besonderen Merkmale, wie z. B. komplexere grammatische Strukturen und spezifischen Wortschatz.
- Scaffolding: Begriffsbestimmung und theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel stellt das Scaffolding-Konzept vor und erläutert seine theoretischen Grundlagen, die auf der interaktionistischen Lerntheorie von Wygotski und der funktionalen Sprachtheorie von Halliday basieren.
- Der Scaffolding-Unterricht und seine Merkmale und Prinzipien: In diesem Kapitel werden die verschiedenen Bausteine des Scaffolding-Konzepts beschrieben, die sich in Makro- und Mikro-Scaffolding gliedern.
Schlüsselwörter
Bildungssprache, Scaffolding, sprachsensibler Fachunterricht, sprachliche Förderung, Zweitspracherwerb, Unterrichtsinteraktion, Makro-Scaffolding, Mikro-Scaffolding, Lernstandsanalyse, Bedarfsanalyse, Unterrichtsplanung, Unterrichtsgespräche, Phasen des Scaffoldings.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2014, Scaffolding. Eine Methode für den sprachsensiblen Fachunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285353