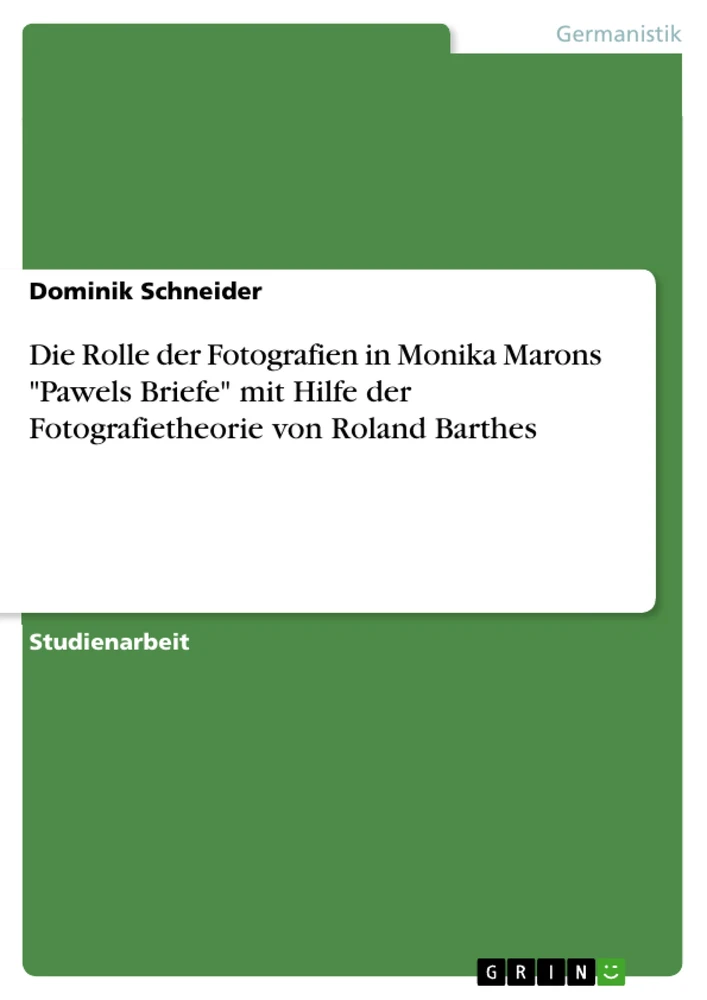Monika Maron rekonstruiert in „Pawels Briefe“ auf erzählende Weise ihre Familiengeschichte anhand von Fotografien ihrer Verwandten. Im Fokus dieser Untersuchung steht die Gattung des Foto-Textes. In diesem literarischen Genre werden zwei scheinbar unterschiedliche Medien zu einem Ganzen verbunden.
In „Die Helle Kammer“ entwickelte Roland Barthes eine Theorie der Fotografie, die zeigt, dass sich beide Medien - Bild und Schrift - nicht grundsätzlich unterscheiden. Anhand einer von Barthes nicht abgebildeten Fotografie seiner Mutter, exemplifiziert er die Versprachlichung eines Fotos und entwickelt daraus Analyseinstrumente in Form einer Studium-Punctum-Dichotomie.
Der Frage nach der Anwendung dieser Theorie in eine literaturtheoretische Untersuchung geht die folgende Analyse nach. Es wird vor allem exemplarisch an ausgewählten Abbildungen aus „Pawels Briefe“ gezeigt, ob und inwieweit die Theorie Barthes in der Praxis angewendet werden kann.
Im ersten Kapitel wird Marons „Pawels Briefe“ literaturtheoretisch eingeordnet und die Strukturen von „Die Helle Kammer“ vorgestellt. In Kapitel C werden die Analyseinstrumente Barthes in ihrer Praxistauglichkeit geprüft und angewendet. Dementsprechend wurden die beiden wichtigsten Instrumente des Punctum-Begriffs in der Gliederung zweigeteilt, um die Mehrdeutigkeit und Wandlung des Analyseinstruments aufzuzeigen. Neben der Betrachtung des Detail-Punctums eines Fotos wird die Zeitlichkeit der Fotografie in Kapitel D zu einem wichtigen Teil dieser Untersuchung.
Monika Maron und „Pawels Briefe“ sind Gegenstand zahlreicher Publikationen. Das liegt einerseits an der Problematik einer Erinnerungsrekonstruktion ohne Erinnerung mit Hilfe von Erzählungen und Dokumenten in Form von Bild und Schrift. Andererseits wurde Marons Gegnerschaft zum DDR-System und ihre Tätigkeit für die Staatssicherheit in den Feuilletons der Zeitschriften und Zeitungen kontrovers diskutiert. Ebenso sind die Rezeptionen zu Barthes Lebenswerk und im einzelnen „Die Helle Kammer“ sehr umfangreich und informativ.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Einführung in die behandelten Werke
- I. Marons „Pawels Briefe“ – Eine literaturtheoretische Einordnung
- II. „Die Helle Kammer“ und ihre Strukturmerkmale
- III. Die Fotografie wird zu Sprache
- C) Die Barthesche Fotografietheorie in der literaturtheoretischen Praxis
- I. Im Blickpunkt die Studium-Punctum-Dichotomie
- II. Das Punctum als Detail – Fotografien und ihre Detailvergrößerungen in „Pawels Briefe“
- III. Die Studium-Punctum-Dichotomie im Hinblick auf „Pawels Briefe“
- D) Das „memento mori“ der Fotografie
- I. Die Fotografie und der Tod
- II. „Es-ist-so-gewesen“ – Das Noema der Fotografie
- E) „Die Helle Kammer“ als Methode literaturtheoretischer Analysen von Foto-Texten?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle der Fotografien in Monika Marons „Pawels Briefe“ und die Anwendung der Fotografietheorie von Roland Barthes auf literarische Texte. Sie analysiert, inwieweit Barthes Konzept der Studium-Punctum-Dichotomie auf die fotografischen Elemente in Marons Roman angewendet werden kann und welche Bedeutung die Fotografie für die literaturtheoretische Interpretation des Textes hat.
- Die gattungsspezifische Einordnung von Marons „Pawels Briefe“
- Die Strukturmerkmale von Barthes „Die Helle Kammer“
- Die Anwendung der Studium-Punctum-Dichotomie auf Fotografien in „Pawels Briefe“
- Die Bedeutung der Zeitlichkeit in der Fotografie und die Rolle des „memento mori“
- Die Frage nach der Relevanz der Fotografietheorie von Barthes für die literaturtheoretische Analyse von Foto-Texten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die literaturtheoretische Einordnung von Marons „Pawels Briefe“ und stellt die Strukturen von Barthes „Die Helle Kammer“ vor. Der Fokus liegt auf der Erinnerungskonstruktion, die Maron anhand von Fotografien und Dokumenten aufbaut. Die Analyse zeigt die Bedeutung des „Vergessens“ und „Erinnerns“ in der Erzählung.
Kapitel C beschäftigt sich mit der Anwendung der Bartheschen Fotografietheorie in der literaturtheoretischen Praxis. Die Studium-Punctum-Dichotomie wird eingeführt und auf ausgewählte Fotografien in „Pawels Briefe“ angewendet. Der Text beleuchtet den Unterschied zwischen Studium und Punctum und deren Relevanz für die Interpretation von Fotografien.
Kapitel D fokussiert auf das „memento mori“ der Fotografie. Der Text erörtert die Verschmelzung von Realität und Vergangenheit in der Fotografie und die Rolle des Todes in diesem Kontext. Die Bedeutung des Noema der Fotografie („Es-ist-so-gewesen“) für die Rekonstruktion der Familiengeschichte in Marons Roman wird analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Fotografie, Literaturtheorie, Erinnerung, Studium-Punctum-Dichotomie, „memento mori“, „postmemory“, Foto-Text, Authentizität, Familiengeschichte, Vergangenheit, Gegenwart, Tod, Vergänglichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzt Monika Maron Fotografien in "Pawels Briefe"?
Maron rekonstruiert ihre Familiengeschichte erzählend anhand von Fotos ihrer Verwandten, um Erinnerungslücken zu füllen und Identität zu finden.
Was ist der Unterschied zwischen Studium und Punctum nach Barthes?
Das "Studium" ist das allgemeine kulturelle Interesse an einem Bild, während das "Punctum" ein zufälliges Detail ist, das den Betrachter persönlich trifft und emotional bewegt.
Was bedeutet das "Noema" der Fotografie?
Das Noema ist laut Barthes das "Es-ist-so-gewesen" – die unumstößliche Gewissheit, dass das Abgebildete in der Vergangenheit wirklich vor der Kamera existiert hat.
Wie hängen Fotografie und Tod zusammen?
Barthes sieht in jeder Fotografie ein "memento mori", da sie einen Augenblick festhält, der bereits vergangen ist und auf die Sterblichkeit des Abgebildeten hinweist.
Was ist ein Foto-Text in der Literatur?
Ein Foto-Text ist ein literarisches Genre, in dem Bild und Schrift so miteinander verbunden werden, dass sie gemeinsam eine neue erzählerische Einheit bilden.
- Quote paper
- Dominik Schneider (Author), 2011, Die Rolle der Fotografien in Monika Marons "Pawels Briefe" mit Hilfe der Fotografietheorie von Roland Barthes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285219