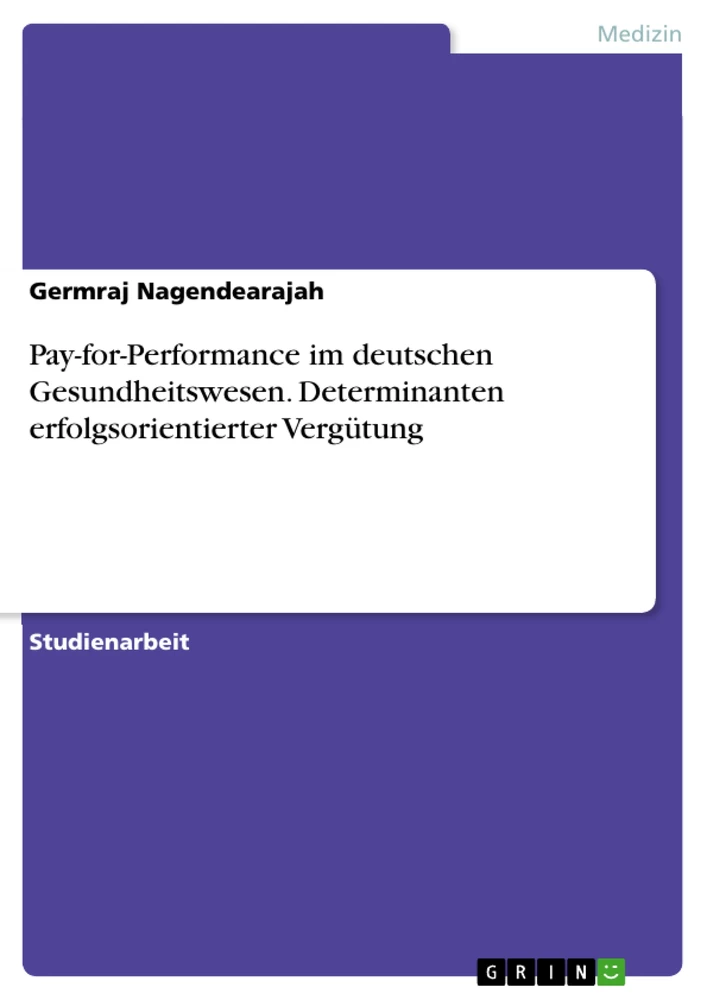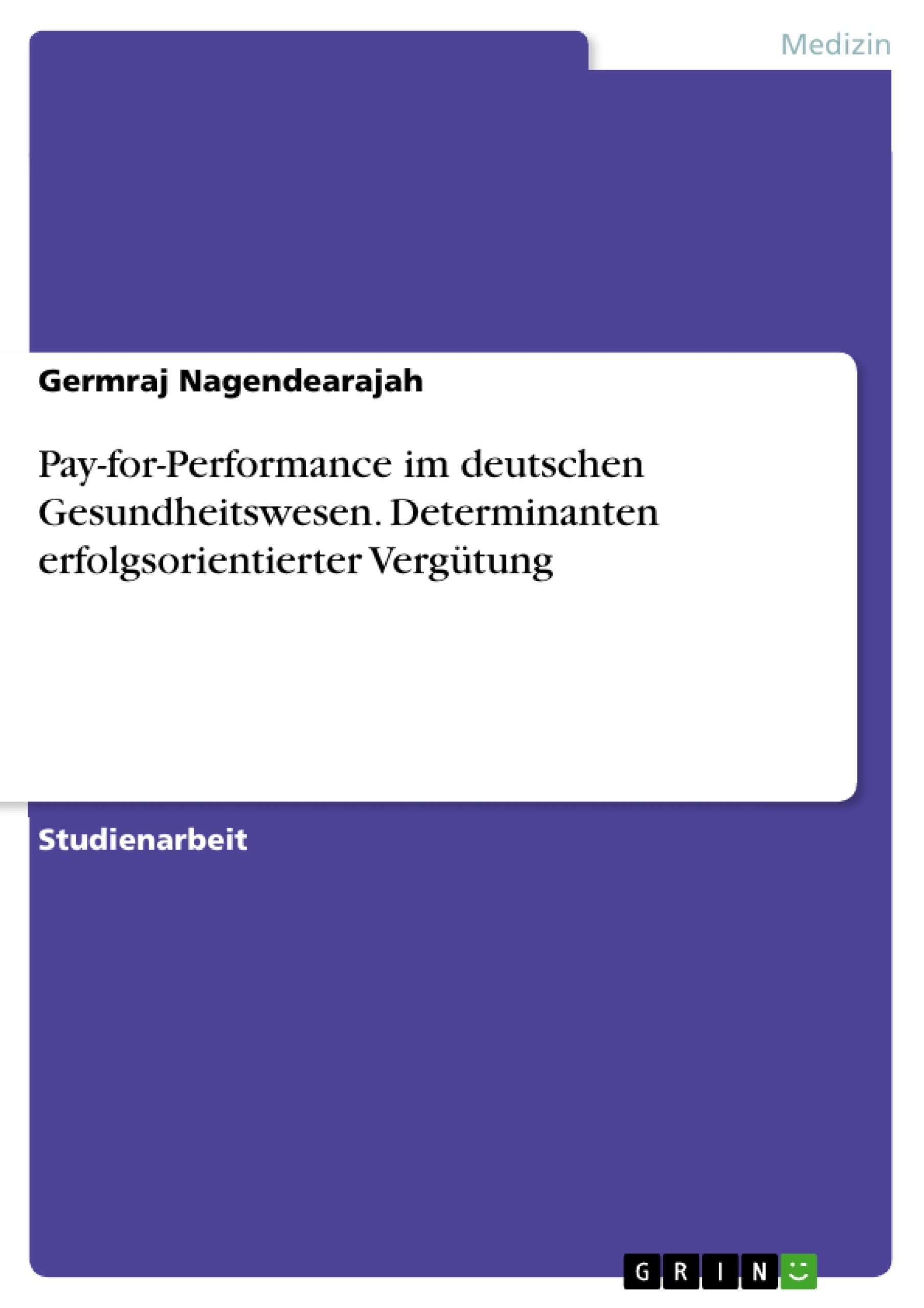In der vorliegenden Seminararbeit möchte ich die relevanten Determinanten des Pay-for-Performance-Konzeptes darlegen. Dabei gehe ich der Frage nach, was die Idee des Pay-for-Performance beinhaltet. Hierfür beginne ich mit einer Definition des Begriffes. Danach werde ich auf die Thematik der Qualitätsindikatoren eingehen, um folglich die Anforderungen von Pay-for-Performance zu untersuchen. Als nächstes werde ich die Anreizgestaltung in der Pay-for-Performance-Vergütung skizzieren, woraufhin ich drei verschiedene Konzeptionen dieser Vergütungsform vorstellen werde.
Seit dem vermeintlichen Ausschluss der Veto-Position der Kassenärztlichen Bundesvereinigung spätestens im Jahre 2008 infolge der Neuordnung des §140 SGB V sind neue Spielräume für die Leistungsvergütung in Form der Integrierten Versorgung entstanden.
Hierzu zählt auch die Pay-for-Performance-Vergütung, auch erfolgsorientierte Vergütung genannt. Sie stellt ein qualitätsorientiertes Vergütungssystem dar, welches mittels finanzieller Anreize die Qualitätssicherung in der Gesundheitsversorgung infolge einer Verhaltenssteuerung der Leistungserbringerseite erwirken soll (vgl. Universität Bremen & Bertelsmann-Stiftung, 2006).
Gerade bei den ,,US-amerikanischen Managed-Care-Ansätzen” hat sich die erfolgsorientierte Vergütung einen Namen gemacht (Braun et. al., 2009, S. 139): Speziell im Gebiet der ,,chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Asthma” tritt Pay-for-Performance als ausschlaggebende Vergütungsform in Erscheinung (s. ebd.).
Der Fokus in dieser Arbeit hingegen soll auf das deutsche Gesundheitswesen gelegt werden, so wird verschiedentlich erklärt, dass grundlegende nationale Interpretationen bezüglich des Pay-for-Performance-Modells im jeweiligen Gesundheitssystem vorliegen (vgl. Pfaff & Schrappe, 2010, S. 36; vgl. Lüngen et al., 2008, S. 164).
Die Vertragsparteien in der erfolgsorientierten Vergütung sind auf der einen Seite die Leistungserbringer, welche als Einzelpersonen agieren oder sich als Akteur in einem Netzwerk an einem Gesundheitsunternehmen bewegen (Braun et al., 2009, S. 12).
Der Pay-for-Performance-Ansatz verfügt als bisher einzige Vergütungsform über zwei Varianten der Ausgestaltung: Die monetären Mittel lassen sich zum einen durch einen Leistungsbezug betrachten, zum anderen auch durch eine Outcomekomponente (Ergebnisbezug) (vgl. Güssow et al. 2009, S. 13)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition
- 3. Qualitätsindikatoren
- 4. Anforderungen von Pay-for-Performance
- 4.1. Anreizgestaltung bei Pay-for-Performance
- 4.2. Beispiele für Pay-for-Performance-Konzepte
- 5. Positive Aspekte von Pay-for-Performance
- 6. Negative Aspekte von Pay-for-Performance
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die grundlegenden Determinanten von Pay-for-Performance (P4P) im deutschen Gesundheitswesen. Sie beleuchtet die Idee von P4P, analysiert Qualitätsindikatoren und deren Anforderungen, skizziert Anreizgestaltung und verschiedene Konzepte, und schließlich werden positive und negative Aspekte von P4P erörtert.
- Definition und Konzept von Pay-for-Performance
- Qualitätsindikatoren im Kontext von P4P (Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität)
- Anreizgestaltung und verschiedene P4P-Modelle
- Positive Auswirkungen von P4P auf das Gesundheitswesen
- Negative Folgen und Herausforderungen von P4P
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Pay-for-Performance-Vergütung im deutschen Gesundheitswesen ein. Sie beleuchtet den historischen Kontext, insbesondere die Veränderungen im §140 SGB V und die Entstehung neuer Spielräume für leistungsorientierte Vergütungsmodelle. Der Fokus liegt auf der nationalen Interpretation von P4P und den beteiligten Vertragsparteien (Leistungserbringer). Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die Forschungsfrage, die sich mit den relevanten Determinanten des P4P-Konzeptes beschäftigt.
2. Definition: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Pay-for-Performance (P4P). Es wird deutlich, dass es keine allgemein gültige Definition gibt, und verschiedene Perspektiven und Interpretationen des Begriffs präsentiert werden, einschließlich der Verknüpfung von Qualität und Vergütungshöhe, der Ergänzung der Vergütungsfunktion um Qualitätsindikatoren und der Gewinnausschüttung bei Zielerreichung. Der erwünschte Effekt wird als Qualitätsverbesserung beschrieben, bei der Arzt- und Patienteninteresse kongruent sein sollen. Das Kapitel hebt hervor, dass der Fokus auf Qualität und Effektivität der Behandlung liegt, nicht auf dem Ausmaß der medizinischen Versorgung.
3. Qualitätsindikatoren: Dieses Kapitel beschreibt Qualitätsindikatoren und ihre Zuordnung zu Indikatorensystemen. Es differenziert zwischen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Strukturqualität bezieht sich auf die Rahmenbedingungen, Prozessqualität auf die eingesetzten Verfahren und Methoden, und Ergebnisqualität auf das Outcome der Behandlung und die Zielerreichung. Das Kapitel erläutert die Bedeutung jeder Qualitätskategorie und wie sie zur Bewertung medizinischer Leistungen beitragen. Der Schwerpunkt liegt auf der umfassenden Darstellung der drei Qualitätsdimensionen und ihrer jeweiligen Bedeutung innerhalb des P4P-Systems.
4. Anforderungen von Pay-for-Performance: Dieses Kapitel behandelt die Anforderungen an Pay-for-Performance-Systeme. Es analysiert die Anreizgestaltung und stellt verschiedene Konzeptionen vor. Die detaillierte Erörterung dieser Aspekte gibt Einblick in die Komplexität und die Herausforderungen bei der Implementierung und Gestaltung von erfolgsorientierten Vergütungsmodellen. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Ansätzen und ihrer Auswirkung auf die Effektivität des Systems.
Schlüsselwörter
Pay-for-Performance, Erfolgsorientierte Vergütung, Qualitätsindikatoren, Gesundheitswesen, Anreizgestaltung, Qualitätsverbesserung, Strukturqualität, Prozessqualität, Ergebnisqualität, Deutschland, Gesundheitsversorgung, Leistungserbringer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Pay-for-Performance im deutschen Gesundheitswesen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Pay-for-Performance (P4P) im deutschen Gesundheitswesen. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Die Arbeit untersucht die Definition von P4P, analysiert Qualitätsindikatoren (Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität), beleuchtet die Anreizgestaltung und verschiedene P4P-Konzepte, und diskutiert schließlich positive und negative Aspekte.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die grundlegenden Determinanten von P4P im deutschen Gesundheitswesen. Sie beleuchtet die Idee von P4P, analysiert Qualitätsindikatoren und deren Anforderungen, skizziert Anreizgestaltung und verschiedene Konzepte, und erörtert positive und negative Aspekte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition von Pay-for-Performance, Qualitätsindikatoren, Anforderungen von Pay-for-Performance (inkl. Anreizgestaltung und Beispiele), positive Aspekte von Pay-for-Performance, negative Aspekte von Pay-for-Performance und Fazit. Jedes Kapitel wird in der bereitgestellten HTML-Datei kurz zusammengefasst.
Was wird unter Pay-for-Performance (P4P) verstanden?
Die Arbeit zeigt, dass es keine einheitliche Definition von P4P gibt. Es wird als Verknüpfung von Qualität und Vergütungshöhe beschrieben, die die Vergütungsfunktion um Qualitätsindikatoren ergänzt und bei Zielerreichung eine Gewinnausschüttung vorsieht. Der Fokus liegt auf der Qualitätsverbesserung und der Kongruenz von Arzt- und Patienteninteresse, nicht auf dem Umfang der medizinischen Versorgung.
Welche Arten von Qualitätsindikatoren werden betrachtet?
Die Arbeit differenziert zwischen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Strukturqualität beschreibt die Rahmenbedingungen, Prozessqualität die Verfahren und Methoden, und Ergebnisqualität das Behandlungsergebnis und die Zielerreichung. Die Bedeutung jeder Kategorie für die Bewertung medizinischer Leistungen wird erläutert.
Welche Anforderungen werden an Pay-for-Performance-Systeme gestellt?
Das Kapitel zu den Anforderungen an P4P-Systeme analysiert die Anreizgestaltung und stellt verschiedene Konzepte vor. Es wird die Komplexität und die Herausforderungen bei der Implementierung und Gestaltung erfolgsorientierter Vergütungsmodelle hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Pay-for-Performance, Erfolgsorientierte Vergütung, Qualitätsindikatoren, Gesundheitswesen, Anreizgestaltung, Qualitätsverbesserung, Strukturqualität, Prozessqualität, Ergebnisqualität, Deutschland, Gesundheitsversorgung, Leistungserbringer.
Welche Aspekte von P4P werden positiv und negativ bewertet?
Die Arbeit erörtert sowohl positive als auch negative Aspekte von P4P. Die genauen Inhalte dieser Bewertung sind in den Kapiteln 5 und 6 detailliert beschrieben, jedoch werden in der bereitgestellten HTML-Datei keine konkreten Punkte genannt.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die bereitgestellte HTML-Datei enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, die einen Überblick über den Inhalt geben. Für detaillierte Informationen muss auf die vollständige Arbeit zugegriffen werden.
- Quote paper
- Germraj Nagendearajah (Author), 2013, Pay-for-Performance im deutschen Gesundheitswesen. Determinanten erfolgsorientierter Vergütung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285092