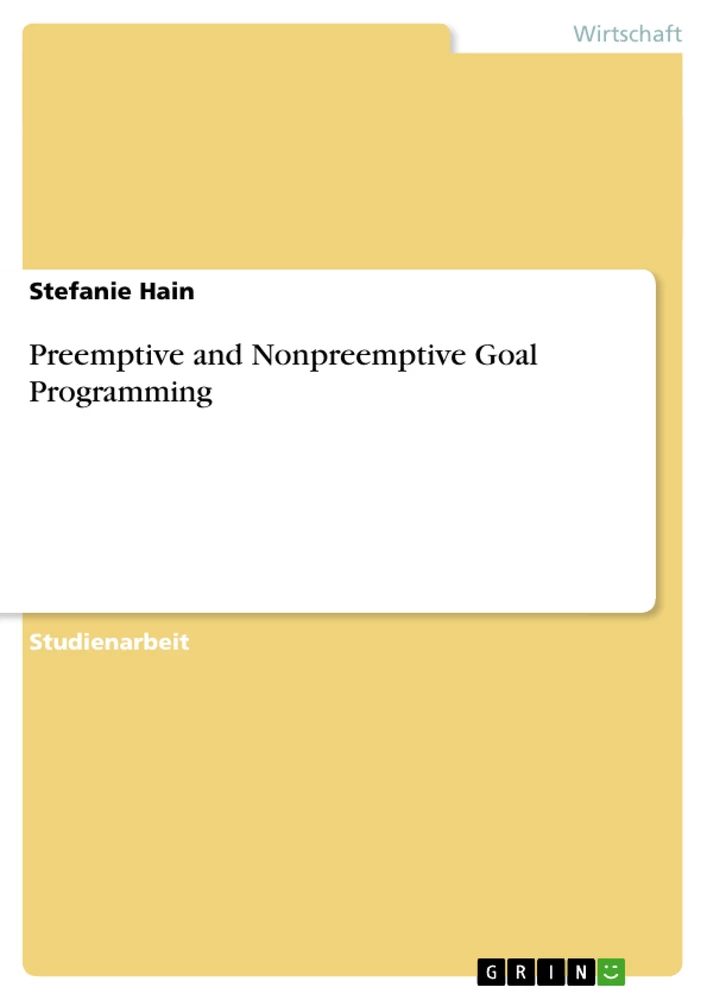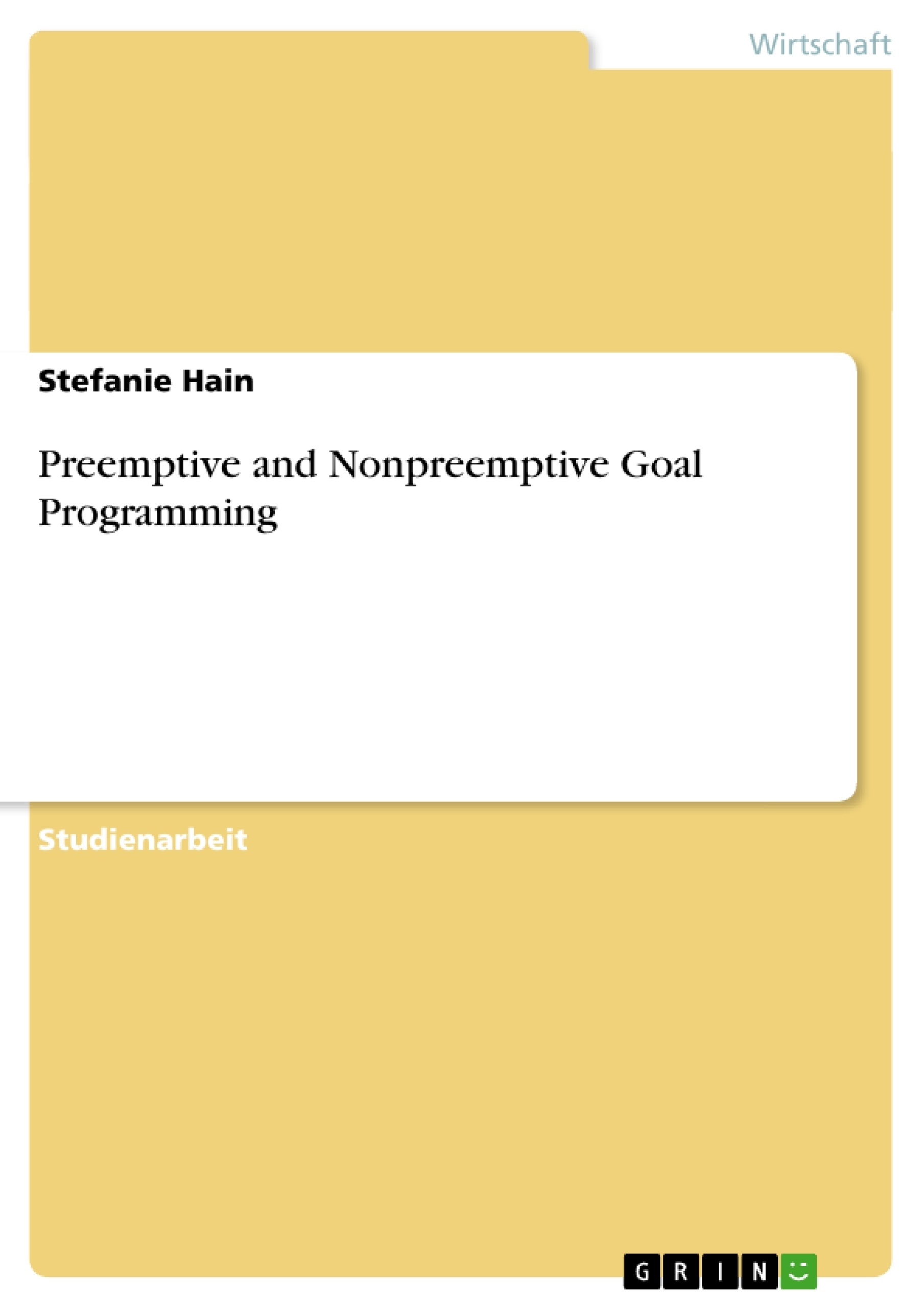Die Geschichte der Mathematik beruht auf dem Versuch die komplexe Realität durch mathematische Modelle darzustellen und zu erklären. Zumeist kann nur eine Annäherung an die reale Lösung unter Vernachlässigung schwer kalkulierbarer Bestandteile erzielt werden. Dabei werden einige Faktoren vernachlässigt, die zu geringen Abweichungen führen. Ursache dieser Simplifikation ist die Problematik der zeitintensiven Berechnung und der zusätzlichen unberechenbaren kritischen Einflüsse. In einem Zeitalter, in dem der kleinste Wirtschaftsvorsprung zählt, ist es von großer Bedeutung eine möglichst genaue Planung durchzuführen. Deswegen sollte das zu Grunde liegende mathematische Modell die Gegebenheiten der „realen Welt“ so genau wie möglich beschreiben. Aus Zeit- und Kostengründen ist jedoch auf eine vollständige Abdeckung des Problems zu verzichten. Ziel sollte es sein, einen Ansatz mit angemessener Präzision unter Berücksichtigung von Zeitrestriktion zu verfolgen. So bietet auch das Goal Programming eine Anpassung an die tatsächlichen wirtschaftlichen Vorgänge. Dabei wird eine Optimierung unter Berücksichtigung mehrerer Zielfunktionen angestrebt. Im Fokus liegt die Spezifizierung der Goals (Zielwerte der Funktionen) und Vergabe einer Prioritätsordnung für die Zielfunktionen. Das bedeutet, dass die Qualität der Lösung vom Entscheidungsträger abhängig ist. Ziel ist es, die Methoden des Goal Programming zu erläutern und anhand von Beispielen zu verdeutlichen. Ferner wird ein Ausblick für praktische Anwendungen gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Motivation
- 2. Einführung
- 2.1 Problemstellung
- 2.2 Begriffsdefinition
- 3. Theoretische Grundlagen
- 4. Goal Programming
- 5. Nonpreemptive Goal Programming
- 5.1 Lösungsvorgehen
- 5.2 Beispiel
- 6. Preemptive Goal Programming
- 6.1 Sequentielles Verfahren
- 6.2 Verkürztes Verfahren
- 6.3 Beispiel
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit erläutert die Methoden des Goal Programmings, sowohl des präemptiven als auch des nicht-präemptiven Ansatzes. Ziel ist es, diese Methoden anhand von Beispielen zu verdeutlichen und einen Ausblick auf praktische Anwendungen zu geben. Die Arbeit beleuchtet die Einordnung des Goal Programmings innerhalb des Operations Research und untersucht die theoretischen Grundlagen.
- Einordnung des Goal Programmings im Operations Research
- Erklärung des präemptiven und nicht-präemptiven Goal Programmings
- Veranschaulichung der Methoden anhand von Beispielen
- Theoretische Grundlagen und Konzepte
- Potentielle Anwendungen in der Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Motivation: Die Arbeit beginnt mit der Begründung der Notwendigkeit präziser Planungsmethoden in der Wirtschaft. Sie argumentiert, dass mathematische Modelle die Realität so genau wie möglich abbilden sollten, obwohl eine vollständige Abdeckung aufgrund von Zeit- und Kosteneinschränkungen nicht immer möglich ist. Goal Programming wird als Ansatz vorgestellt, der eine Optimierung unter Berücksichtigung mehrerer Zielfunktionen ermöglicht, wobei die Gewichtung der Ziele durch den Entscheidungsträger bestimmt wird. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der Goal Programming-Methoden und deren Veranschaulichung durch Beispiele, gefolgt von einem Ausblick auf praktische Anwendungen.
2. Einführung: Dieses Kapitel ordnet das Goal Programming (präemptiv und nicht-präemptiv) in den Bereich des Operations Research ein, beschreibt es als Methode der multikriteriellen Programmierung und als den meistgenutzten Ansatz im Umgang mit multikriteriellen Problemen der linearen Programmierung. Es wird auf die Einordnung in verschiedene Modellklassen hingewiesen (deterministische Modelle, lineare Optimierung) und es wird ein Überblick über die Problemstellung sowie die wichtigsten Begriffe gegeben. Schließlich werden die theoretischen Grundlagen mit der Einführung von "Unrestricted (free) Variables" vorbereitet.
3. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel dürfte die mathematischen und statistischen Grundlagen des Goal Programmings detailliert darstellen, inklusive der Definition und Anwendung relevanter Variablen und Formeln. Es dient als Basis für das Verständnis der darauffolgenden Kapitel, die auf diesem Fundament aufbauen.
4. Goal Programming: Dieses Kapitel bietet wahrscheinlich einen allgemeinen Überblick über die Methodik des Goal Programming, bevor die spezifischen präemptiven und nicht-präemptiven Ansätze in den folgenden Kapiteln detailliert behandelt werden. Es legt die grundlegenden Prinzipien und Konzepte dar, die für beide Verfahren relevant sind.
5. Nonpreemptive Goal Programming: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf das nicht-präemptive Goal Programming, wobei alle Zielfunktionen denselben Prioritätsgrad besitzen. Es wird detailliert auf die Lösungsverfahren und ein konkretes Beispiel eingegangen, um die Anwendung der Methode zu veranschaulichen. Die Zusammenfassung dieses Kapitels würde die Lösungsstrategie und die Interpretation der Ergebnisse des Beispiels beinhalten.
6. Preemptive Goal Programming: Hier wird das präemptive Goal Programming behandelt, welches verschiedene Prioritätsstufen für die Zielfunktionen einführt. Das Kapitel beschreibt wahrscheinlich verschiedene Verfahren (sequentiell und verkürzt) zur Lösung solcher Probleme. Die Zusammenfassung würde die unterschiedlichen Lösungsansätze gegenüberstellen und deren Vor- und Nachteile beleuchten, sowie ein Beispiel zur Veranschaulichung der Methode liefern.
Schlüsselwörter
Goal Programming, präemptiv, nicht-präemptiv, multikriterielle Programmierung, lineare Programmierung, Operations Research, Optimierung, Zielfunktionen, Prioritäten, Lösungsverfahren, mathematische Modellierung, Wirtschaftsplanung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument "Goal Programming"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Goal Programming, eine Methode des Operations Research zur Lösung multikriterieller Optimierungsprobleme. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel sowie eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Erklärung und Veranschaulichung des präemptiven und nicht-präemptiven Goal Programmings anhand von Beispielen.
Welche Methoden des Goal Programmings werden behandelt?
Das Dokument behandelt sowohl das nicht-präemptive Goal Programming (alle Zielfunktionen haben dieselbe Priorität) als auch das präemptive Goal Programming (Zielfunktionen mit unterschiedlichen Prioritäten). Für beide Methoden werden Lösungsverfahren detailliert beschrieben und anhand von Beispielen veranschaulicht.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte des Dokuments?
Das Hauptziel ist die Erklärung der Methoden des Goal Programmings (präemptiv und nicht-präemptiv) und deren Veranschaulichung anhand von Beispielen. Zusätzlich wird die Einordnung des Goal Programmings im Operations Research beleuchtet und auf die theoretischen Grundlagen eingegangen. Die Arbeit untersucht die Anwendungsmöglichkeiten in der Wirtschaft.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Motivation und Einführung in das Thema. Es folgen Kapitel zu den theoretischen Grundlagen, dem allgemeinen Goal Programming, dem nicht-präemptiven und dem präemptiven Goal Programming. Jedes Kapitel wird mit einer kurzen Zusammenfassung versehen. Abschließend wird eine Liste der Schlüsselbegriffe bereitgestellt.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Das Dokument umfasst Kapitel zu Motivation, Einführung (mit Problemstellung und Begriffsdefinition), theoretischen Grundlagen, Goal Programming im Allgemeinen, nicht-präemptivem Goal Programming (mit Lösungsvorgehen und Beispiel), präemptivem Goal Programming (mit sequentiellem und verkürztem Verfahren sowie Beispiel) und einem abschließenden Fazit. Jedes Kapitel bietet einen detaillierten Einblick in die jeweilige Thematik.
Welche Lösungsverfahren werden für das präemptive und nicht-präemptive Goal Programming beschrieben?
Für das nicht-präemptive Goal Programming wird ein Lösungsvorgehen detailliert erläutert und anhand eines Beispiels veranschaulicht. Das präemptive Goal Programming behandelt ein sequentielles und ein verkürztes Verfahren, ebenfalls mit Beispielen zur Veranschaulichung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Goal Programming, präemptiv, nicht-präemptiv, multikriterielle Programmierung, lineare Programmierung, Operations Research, Optimierung, Zielfunktionen, Prioritäten, Lösungsverfahren, mathematische Modellierung, Wirtschaftsplanung.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich an Leser, die sich mit Operations Research und multikriterieller Optimierung auseinandersetzen. Es ist besonders nützlich für Studierende und Wissenschaftler, die sich ein detailliertes Verständnis von Goal Programming aneignen möchten.
Wo finde ich Beispiele für die Anwendung der beschriebenen Methoden?
Das Dokument enthält konkrete Beispiele sowohl für das nicht-präemptive als auch für das präemptive Goal Programming in den entsprechenden Kapiteln. Diese Beispiele veranschaulichen die Lösungsverfahren und die Interpretation der Ergebnisse.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Das Kapitel zu den theoretischen Grundlagen beschreibt die mathematischen und statistischen Grundlagen des Goal Programmings, einschließlich relevanter Variablen und Formeln. Diese Grundlagen bilden die Basis für das Verständnis der darauffolgenden Kapitel.
- Quote paper
- Diplom-Wirtschaftsinformatikerin Stefanie Hain (Author), 2003, Preemptive and Nonpreemptive Goal Programming, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28497