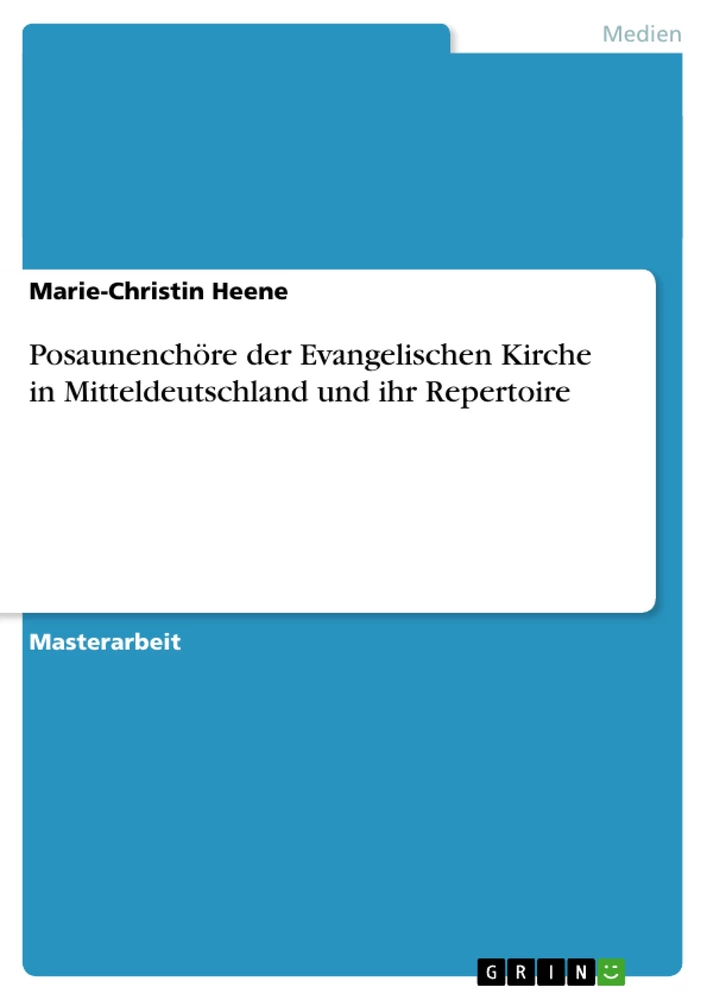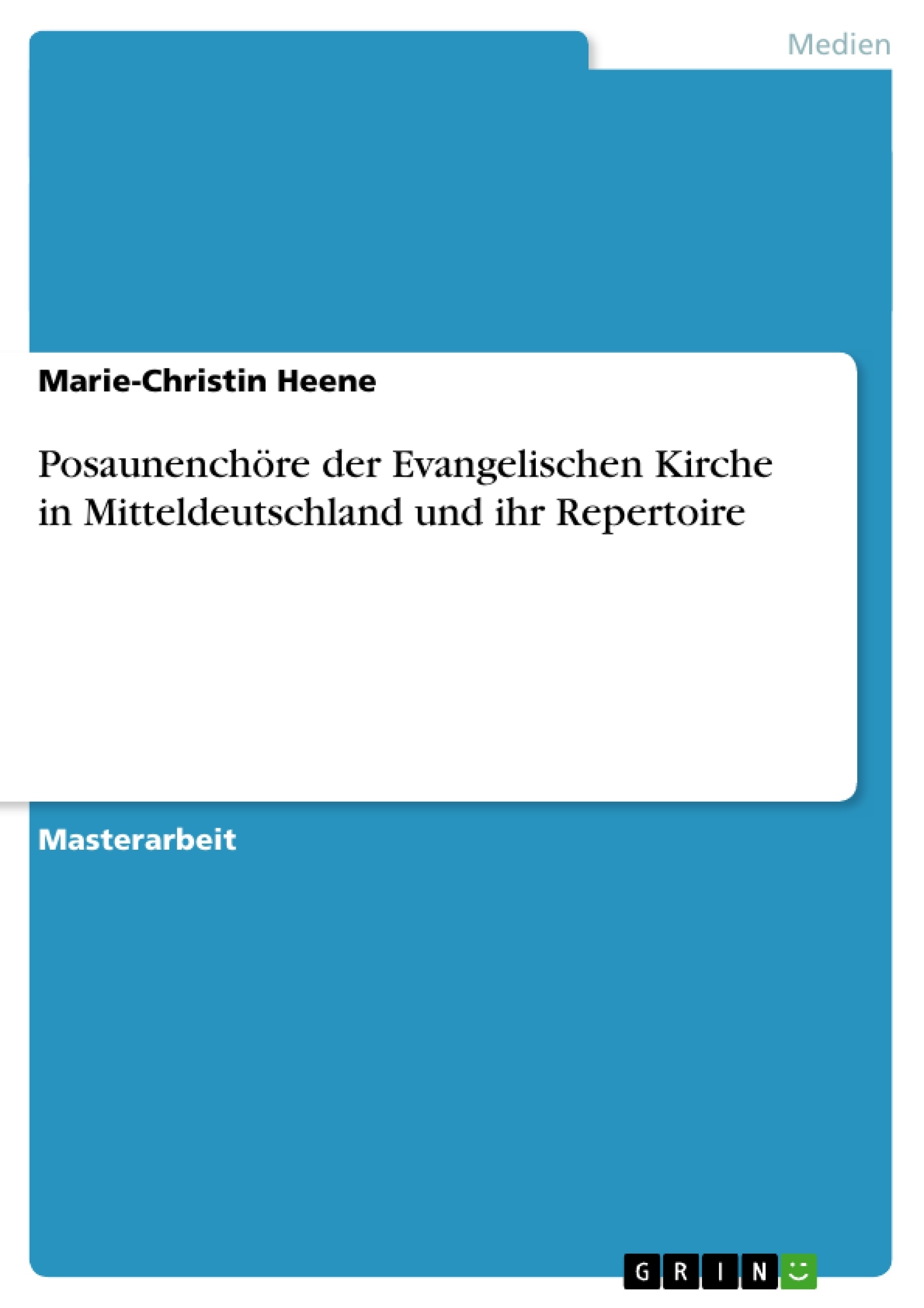Posaunenchöre der evangelischen Kirche haben in Deutschland eine lange Tradition. Die
Besonderheit dieser Chöre liegt vor allem in der Besetzung: nicht nur, dass sich in diesen
Chören oftmals mehrere Generationen wiederfinden, sie bestehen auch seit jeher aus
musikalischen Laien, die neben der Freude am gemeinsamen Musizieren vor allem in ihrem
Glauben verbunden miteinander sind.
Erst seit wenigen Jahrzehnten wird auch versucht, sich auf einer wissenschaftlichen Basis
der Entstehung und Entwicklung von Posaunenchören anzunähern. Häufig haben die
Posaunenchorleiter oder andere interessierte Laien die Geschichte ihrer Gemeinde und
deren musikalischen Vereinigungen dokumentiert. Diese Schriften genügen oftmals keinem
wissenschaftlichen Anspruch und sind zumeist durch eine eigene, subjektive Betrachtung
geprägt. Bei meinen ersten Recherchen bin ich auf eine gute wissenschaftliche Aufarbeitung
der älteren Bläserliteratur und -geschichte gestoßen. Zur jener der neueren Zeit2 fehlen
bisher ähnliche Forschungen. Somit bleiben Fragen nach der Qualität neuerer Bläserliteratur
und der Umgang der Posaunenchöre damit offen. Ebenfalls hat die Wissenschaft
Nachholbedarf, wenn es darum geht, zu dokumentieren, wie Posaunenchöre Tradition und
Anpassung an die Moderne vereinen können, um sowohl tradierte Werte beizubehalten als
auch junge Menschen mit dieser Musik zu erreichen und sie in ihrem Glauben zu bestärken.
Ziel der Arbeit ist es, die aktuelle Situation der Posaunenchöre des Posaunenwerks
Mitteldeutschland aufzuzeigen, insbesondere ihren Umgang mit dem bestehenden
Repertoire und dies in einen Zusammenhang mit der Geschichte und Entwicklung der
Posaunenchöre in ganz Deutschland zu bringen.
Die Arbeit ist chronologisch angelegt und in vier Teile gegliedert: Geschichte der
Posaunenchöre; Entwicklung des Repertoires für Posaunenchöre, Entwicklung des
Repertoires zu den Landesposaunenfesten in Mitteldeutschland ab 1950; aktuelle Situation
der Posaunenchöre in Mitteldeutschland mittels einer Umfrage.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung, Begriffserläuterung und methodische Herangehensweise
- Entstehung und Entwicklung der Posaunenchöre
- Merkmale von Posaunenchören
- Die Vorläufer der Posaunenchöre vor dem 18. Jahrhundert
- Erwähnungen in der Bibel
- Blechbläserformationen ab dem späten Mittelalter
- Die Anfänge der geistlichen Blasmusik
- Die Herrnhuter Brüdergemeine
- Posaunenchöre innerhalb der Erweckungsbewegung
- Die ersten Posaunenchöre
- Entwicklung bis ins 21. Jahrhundert
- Johannes Kuhlo und die neue Notation
- Posaunenchöre nach dem 1. Weltkrieg
- Organisation der Posaunenchöre nach dem zweiten Weltkrieg
- Das Instrumentarium der Posaunenchöre
- Das Repertoire der Posaunenchöre
- Einflüsse auf die Entwicklung des Repertoires für Posaunenchöre
- Einführende Gedanken
- Geschichte der Musik für Blasinstrumente
- Die Entwicklung der Klavierschreibweise
- Abhängigkeit von Literatur und Vortragsweise
- Gattungsgeschichte der Noten für Posaunenchöre
- Die ersten Noten bei den Herrnhuter Brüdergemeinen
- Einzelausgaben der Bläsernoten
- Chronologische Zusammenfassung
- Einflüsse auf die Entwicklung des Repertoires für Posaunenchöre
- Das Repertoire zu den Landesposaunenfesten in Mitteldeutschland
- Allgemeines zu den Landesposaunenfesten
- Überblick zu den Landesposaunentagen in Mitteldeutschland
- Ausgewählte Posaunentage und ihr Repertoire
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Umfrageauswertung
- Allgemeines zu den Daten
- Auswertung der einzelnen Fragen
- Allgemeines zum Befragten
- Zur Zusammensetzung des jeweiligen Posaunenchors
- Aktivitäten der Posaunenchöre
- Umgang mit den Noten
- Überprüfung verschiedener Hypothesen
- Zusammenfassung der Umfrageauswertung und Diskussion zur Methodik
- Schlussbetrachtungen und Ausblick
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Anhang
- Grafiken des Umfragebogens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung von Posaunenchören der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und analysiert deren Repertoire. Ziel ist es, die Geschichte der Posaunenchöre in diesem Kontext zu beleuchten, die Entwicklung des Repertoires zu untersuchen und die Bedeutung der Posaunenchöre in der heutigen Zeit zu beleuchten.
- Die Entstehung und Entwicklung der Posaunenchöre in Mitteldeutschland
- Die Entwicklung des Repertoires für Posaunenchöre
- Die Bedeutung der Posaunenchöre in der heutigen Zeit
- Die Rolle der Posaunenchöre in der evangelischen Kirche
- Die Herausforderungen und Chancen der Posaunenchorarbeit in der Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Masterarbeit ein und stellt die Relevanz der Posaunenchöre in der evangelischen Kirche dar. Sie beleuchtet die Besonderheit dieser Chöre, die aus musikalischen Laien bestehen und sowohl Kirchenmusik als auch Stücke aus dem Bereich der U-Musik spielen. Die Einleitung stellt auch die Forschungslücke dar, die diese Arbeit schließen möchte, indem sie die Entwicklung des Repertoires und die Bedeutung der Posaunenchöre in der heutigen Zeit untersucht.
Kapitel 3 befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Posaunenchöre. Es werden die Vorläufer der Posaunenchöre vor dem 18. Jahrhundert, die Anfänge der geistlichen Blasmusik und die Entwicklung bis ins 21. Jahrhundert beleuchtet. Dieses Kapitel analysiert die Merkmale von Posaunenchören, die Bedeutung der Herrnhuter Brüdergemeine und die Rolle der Posaunenchöre innerhalb der Erweckungsbewegung. Es werden auch die Entwicklungen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie das Instrumentarium der Posaunenchöre betrachtet.
Kapitel 4 widmet sich dem Repertoire der Posaunenchöre. Es werden die Einflüsse auf die Entwicklung des Repertoires, die Gattungsgeschichte der Noten für Posaunenchöre und die Entwicklung der Klavierschreibweise untersucht. Dieses Kapitel beleuchtet die Abhängigkeit von Literatur und Vortragsweise sowie die ersten Noten bei den Herrnhuter Brüdergemeinen. Es werden auch die Einzelausgaben der Bläsernoten und eine chronologische Zusammenfassung der Entwicklung des Repertoires präsentiert.
Kapitel 5 analysiert das Repertoire zu den Landesposaunenfesten in Mitteldeutschland. Es werden die Landesposaunenfeste im Allgemeinen, die Landesposaunentagen in Mitteldeutschland und ausgewählte Posaunentage mit ihrem Repertoire betrachtet. Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Entwicklung des Repertoires zu den Landesposaunenfesten und die Bedeutung dieser Veranstaltungen für die Posaunenchorarbeit.
Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse einer Umfrage unter Posaunenchören in Mitteldeutschland. Es werden die Daten der Umfrage analysiert und die Ergebnisse zu den einzelnen Fragen, wie z.B. die Zusammensetzung der Chöre, die Aktivitäten der Posaunenchöre und der Umgang mit den Noten, dargestellt. Dieses Kapitel untersucht auch verschiedene Hypothesen und diskutiert die Methodik der Umfrage.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Posaunenchöre, evangelische Kirche, Mitteldeutschland, Repertoire, Entstehung, Entwicklung, Geschichte, Musik, Blasmusik, Kirchenmusik, U-Musik, Landesposaunenfeste, Umfrage, Methodik, Tradition, Moderne, Glaube, Laienmusik, Instrumentarium, Notation, Klavierschreibweise, Literatur, Gattungsgeschichte, Noten, Bläsernoten, Chronologie, Analyse, Forschung, wissenschaftliche Aufarbeitung.
- Quote paper
- M.A. Marie-Christin Heene (Author), 2013, Posaunenchöre der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und ihr Repertoire, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284872