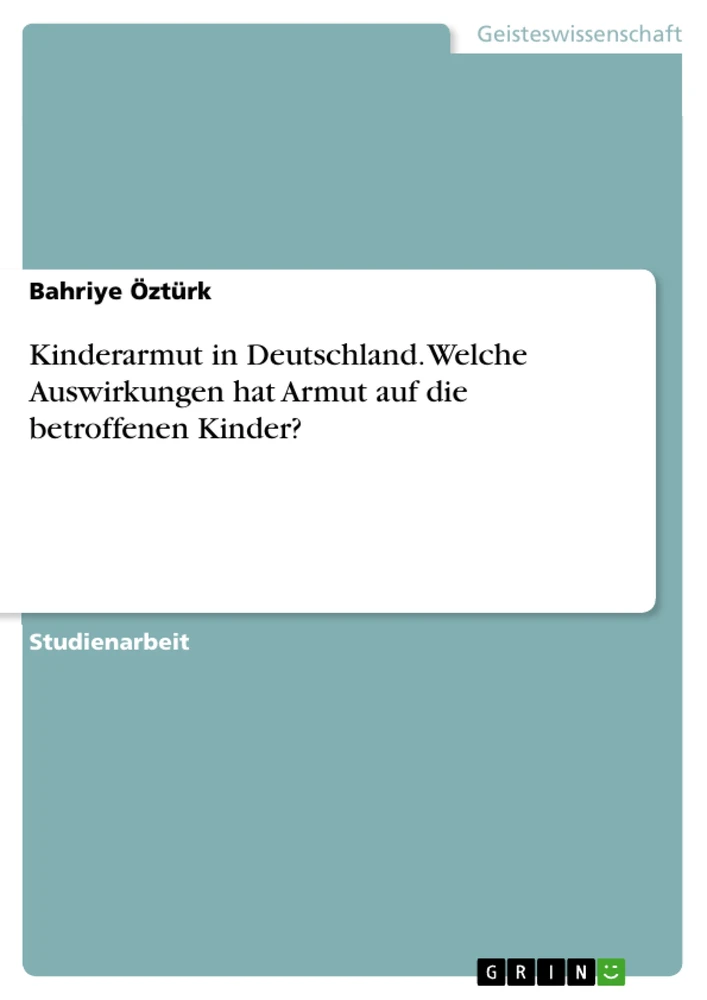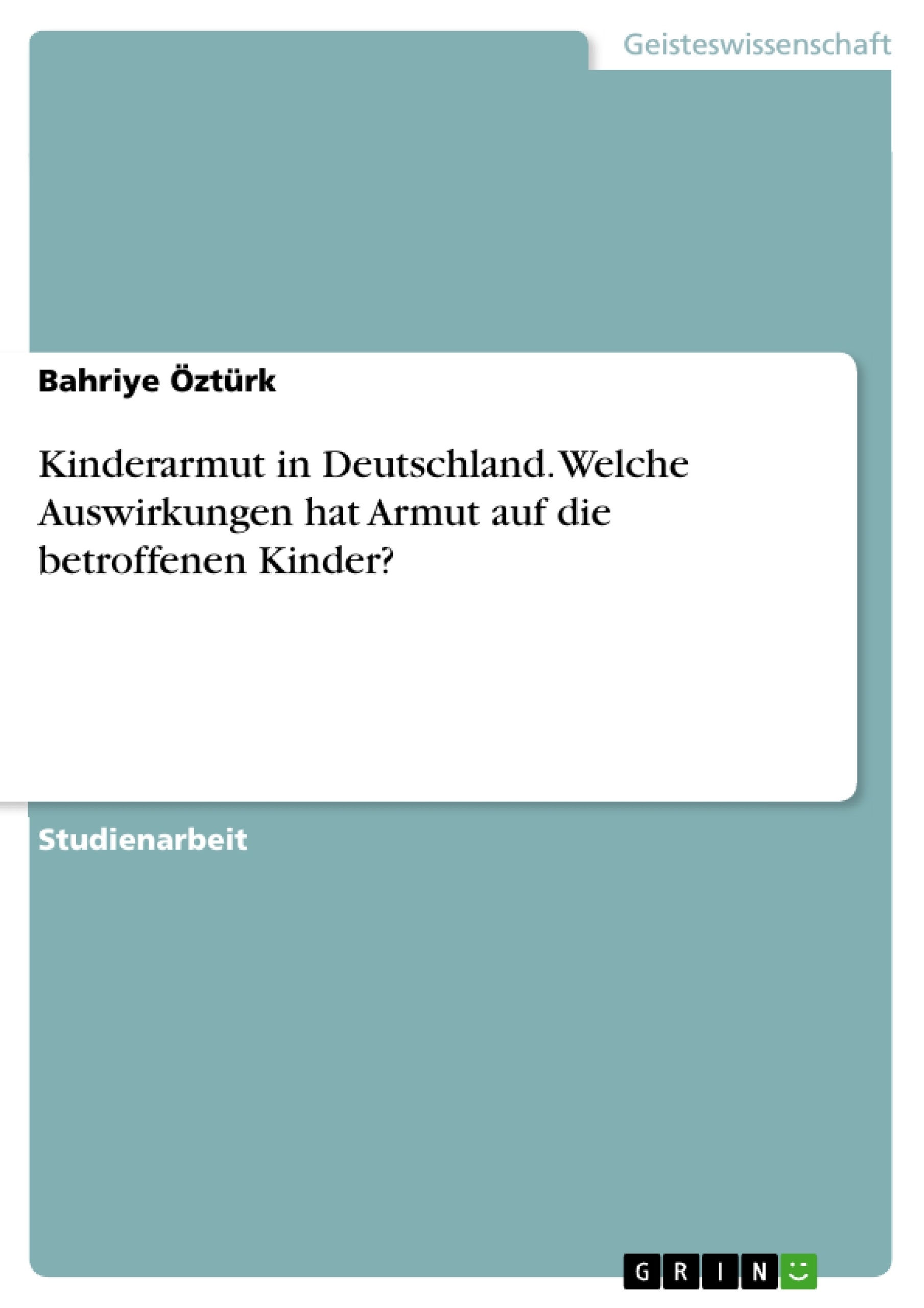Das Thema Kinderarmut rückte seit der Einführung der Hartz IV-Gesetze immer weiter in den Vordergrund von sozialpolitischen Debatten. Das Institut für Wirtschaftsforschung verkündete in der Pressemitteilung vom 12.05.2011, dass im Jahre 2009 der Prozentsatz der in Armut lebender Kinder bei 16,4% lag. Demnach verdoppelte sich die Kinderarmut in Deutschland in den letzten 20 Jahren. Die Jugendforscher Hutsch und Ringo führen diese Entwicklung insbesondere auf die im Jahre 2005 eingeführten Hartz IV-Gesetze zurück.
Klassische psychoanalytische Entwicklungsmodelle betrachten die Kindheit als einen Lebensabschnitt, der durch vielfältige und massive Veränderungen geprägt ist. Nach dem Eriksonschen Entwicklungsmodellen sind die Erlebnisse und Erfahrungen in dieser Lebensphase des Individuums besonders prägend. Anlehnend an diese Erkenntnisse aus der Identitäts- und Entwicklungsforschung, können die durch die Armut hervorgehenden Lebensumstände Auswirkungen auf die psychische sowie physische Entwicklung für Individuen verursachen und somit zu einer einschneidenden Erfahrung für die Individuen werden, welche das ganze spätere Leben prägen kann. Hierbei wird die Dringlichkeit und Signifikanz der Auseinandersetzung mit dem Thema Kinderarmut erkenntlich.
Dies stellt das Thema dieser Seminararbeit dar und wird anhand von des ressourcenorientierten – und des Lebenslagenansatzes näher beleuchtet. Zudem zeigt diese Arbeit das Ausmaß der Kinderarmut in Deutschland auf. Die genaue Auseinandersetzung mit den Folgen und dem Ausmaß der Kinderarmut in Deutschland ist in den Vordergrund zu stellen, um in dem darauffolgenden Kapitel effektive Handlungsmöglichkeiten der sozialen Arbeit und Präventionsmaßnahmen hervorzubringen. Von Nöten ist demnach auch die in Kapitel 2 vorgenommene Begriffserläuterung, welche die Probleme und Situation der in Armut lebenden Kinder in Deutschland konkretisieren soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung von Kinderarmut und die Messung
- Zwei Definitionsansätze von Armut
- Die „absolute“ Armut
- Die „relative“ Armut
- Zwei Konzepte zur Verarbeitung von Kinderarmut
- Der ressourcenorientierte Ansatz
- Der Lebenslagenansatz
- Die Auswirkungen von Armut auf die betroffenen Kinder
- Die Auswirkung der „relativen“ Einkommensarmut auf die materielle Situation
- Die Auswirkung der „relativen“ Einkommensarmut auf die Gesundheitsentwicklung
- Die körperliche Gesundheit
- Die psychische Gesundheit
- Die Auswirkung von Armut hinsichtlich der
- Sozialverhalten
- Soziale Kontakte
- Die Auswirkung von Armut auf die kulturelle Situation
- Schluss
- Fazit
- Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit setzt sich mit der Problematik der Kinderarmut in Deutschland auseinander. Sie befasst sich insbesondere mit den Auswirkungen von Armut auf die betroffenen Kinder in verschiedenen Lebensbereichen, wie der materiellen Situation, der Gesundheit und dem sozialen Verhalten. Die Arbeit analysiert die Problematik anhand von zwei unterschiedlichen Konzepten: dem ressourcenorientierten Ansatz und dem Lebenslagenansatz. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Kinderarmut in Deutschland zu zeichnen und Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit aufzuzeigen.
- Definition und Messung von Kinderarmut
- Auswirkungen von Armut auf die materielle Situation
- Auswirkungen von Armut auf die körperliche und psychische Gesundheit
- Auswirkungen von Armut auf das Sozialverhalten und die sozialen Kontakte
- Handlungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Kinderarmut ein und beleuchtet die Relevanz der Thematik im Kontext der Hartz IV-Gesetze. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffes Kinderarmut, wobei die Unterscheidung zwischen „absoluter“ und „relativer“ Armut im Vordergrund steht. Es werden zwei Konzepte zur Verarbeitung von Kinderarmut vorgestellt: der ressourcenorientierte Ansatz und der Lebenslagenansatz.
Das dritte Kapitel widmet sich den Auswirkungen von Armut auf die betroffenen Kinder. Es wird die Auswirkung von „relativer“ Einkommensarmut auf die materielle Situation, die körperliche und psychische Gesundheit, das Sozialverhalten und die sozialen Kontakte beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Armut, relative Armut, absolute Armut, Ressourcenansatz, Lebenslagenansatz, materielle Situation, Gesundheit, Sozialverhalten, Soziale Kontakte, Handlungsmöglichkeiten, Soziale Arbeit.
- Citar trabajo
- Bahriye Öztürk (Autor), 2014, Kinderarmut in Deutschland. Welche Auswirkungen hat Armut auf die betroffenen Kinder?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284627