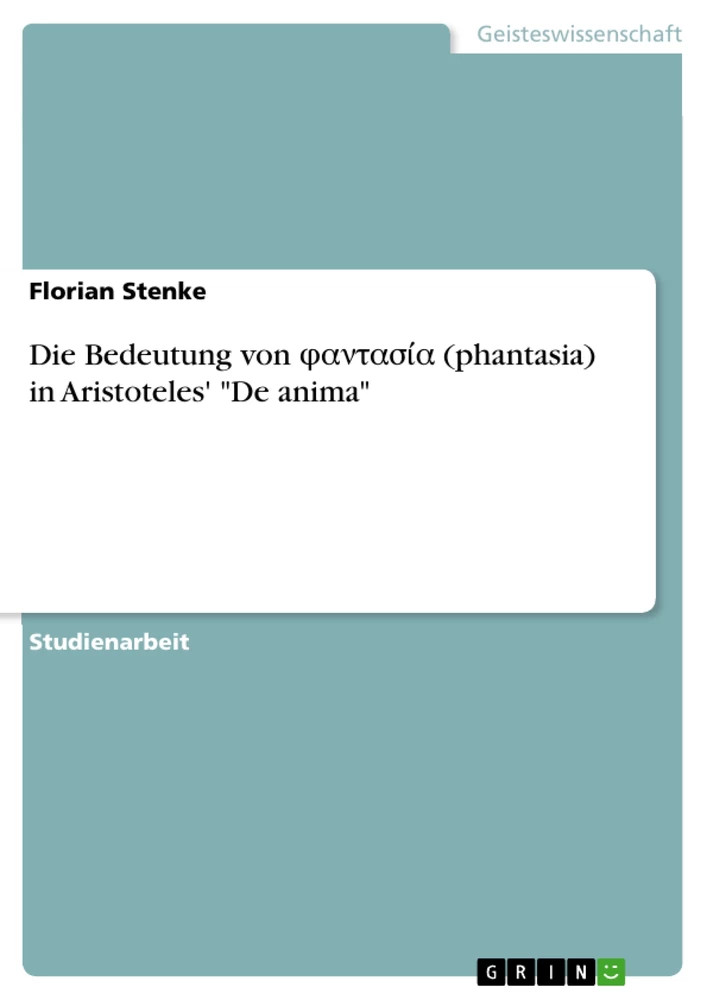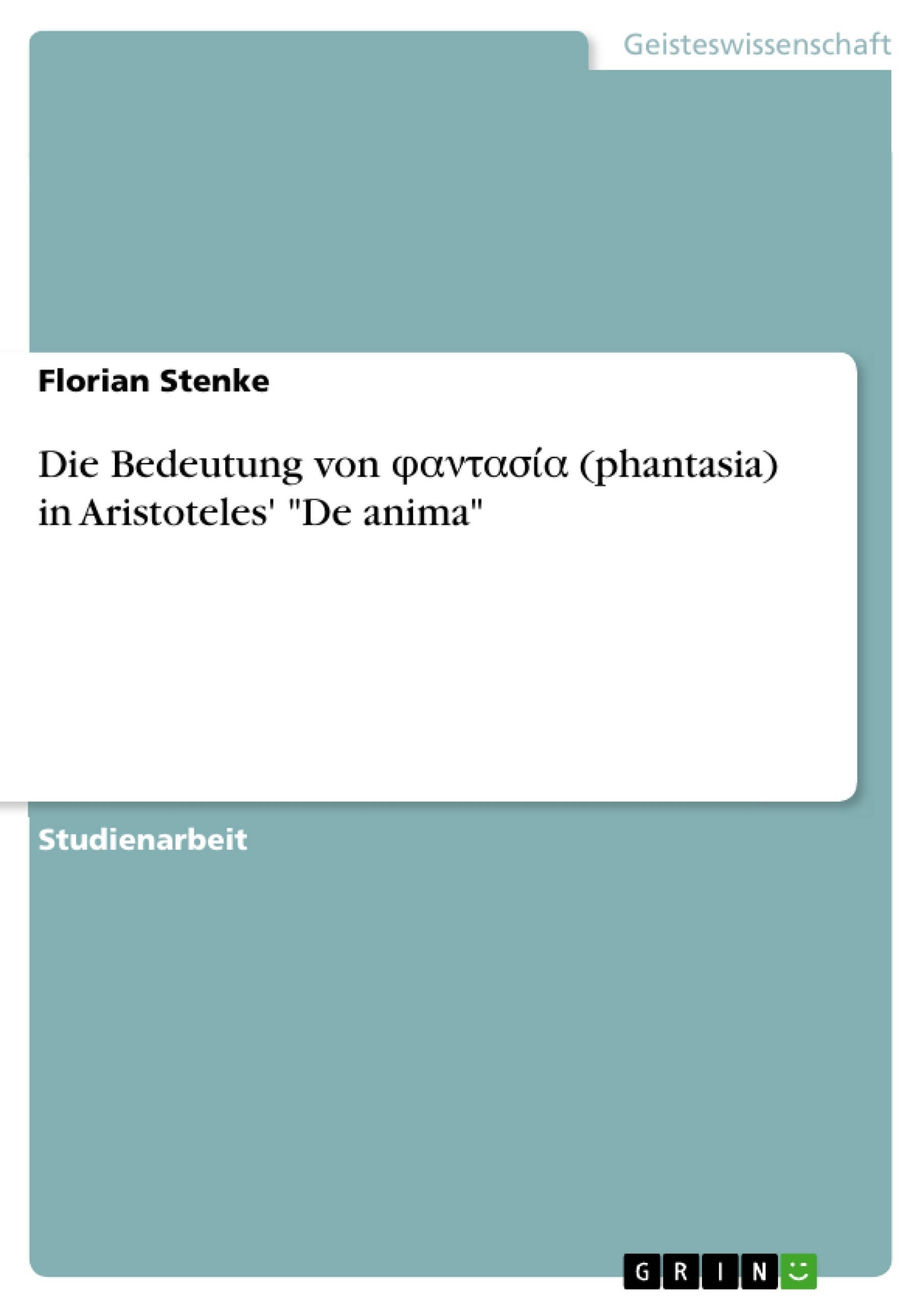Aristoteles‘ Werk 'De anima' „enthält […] eine philosophische Lehre von der Seele und vom Menschen, auf metaphysischer Grundlage“ und gilt als ältestes erhaltenes Zeugnis einer systematischen Untersuchung der menschlichen Seelenwelt. Deshalb wird 'De anima' heute als Grundsteinlegung der Psychologie als eigener philosophischer Disziplin betrachtet.
Nach dem Siegeszug der empirischen Psychologie in den letzten Jahrzehnten gewinnt es wieder zunehmend an Bedeutung, wenn die empirisch arbeitende Psychologie an die Grenzen ihrer durch die Methode eingeschränkten Forschungsgegenstände stößt. Hier müssen naturwissenschaftlich orientierte Psychologen und Anthropologen immer wieder auf die philosophische Psychologie zurückgreifen. An der Aktualität ihres Gegenstandes kann bei der Seelenlehre Aristoteles‘ deshalb kein Zweifel bestehen und so auch nicht am Stellenwert der Schrift 'De anima' für die gegenwärtige Forschung.
Problematisch beim Umgang mit antiken Schriften ist, neben der Überlieferungsgeschichte und Übersetzung, vor allem die Interpretation des heutigen Lesers. Besonders deutlich wird dies im dritten Kapitel des dritten Buches, wenn Aristoteles phantasia in seine Seelenlehre einführt. Über kaum eine Stelle der Schrift wird in der Fachwissenschaft mehr diskutiert, sie gilt als „extremely unclear“.
Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, phantasia in der Rolle darzustellen, die Aristoteles selbst ihr im dritten Kapitel des dritten Buchs gab. Deshalb werden die
von Aristoteles selbst angeführten Argumente für die Notwendigkeit von phantasia im Erkenntnisprozess die Struktur des Hauptteils vorgeben. So soll die auf fünf Argumenten basierende, negative Definition von phantasia, die er hier vornahm, nachvollzogen werden. Erst auf dieser Grundlage kann dann die Bedeutung von phantasia bei Aristoteles und für die gegenwärtige Forschung beurteilt werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- II. 1 Unterscheidung von der (Sinnes-)Wahrnehmung
- II.2 Unterscheidung von der Vernunft und vom Wissen/der Wissenschaft
- II.3. Unterscheidung von der Meinung
- II.4 Unterscheidung von einer Meinungs-Wahrnehmungs-Verbindung
- II.5 Die Bedeutung von qavtaσía bei Aristoteles
- III. Schluss
- IV. Quellen- und Literaturverzeichnis
- IV.1. Quellenverzeichnis
- IV.2. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von φαντασία in Aristoteles' De anima. Ziel ist es, die Rolle von φαντασία im Erkenntnisprozess nach Aristoteles darzustellen und zu analysieren, wie sie sich von anderen Erkenntnisformen wie Wahrnehmung, Vernunft und Meinung unterscheidet. Die Arbeit konzentriert sich auf die Argumente, die Aristoteles selbst für die Notwendigkeit von φαντασία im Erkenntnisprozess anführt.
- Die Rolle von φαντασία im Erkenntnisprozess nach Aristoteles
- Die Unterscheidung von φαντασία von anderen Erkenntnisformen wie Wahrnehmung, Vernunft und Meinung
- Die Bedeutung von φαντασία für die gegenwärtige Forschung
- Die Interpretation von φαντασία in der Fachwissenschaft
- Die Bedeutung von φαντασία für die aristotelische Seelenlehre
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Werk De anima von Aristoteles vor und erläutert die Bedeutung der Schrift für die Philosophie und die Psychologie. Sie hebt die Problematik der Interpretation antiker Schriften hervor, insbesondere im Hinblick auf die Rolle von φαντασία in der Seelenlehre. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, φαντασία in der Rolle darzustellen, die Aristoteles ihr im dritten Kapitel des dritten Buches gab.
Der Hauptteil der Arbeit analysiert die fünf Argumente, die Aristoteles für die Notwendigkeit von φαντασία im Erkenntnisprozess anführt. Er zeigt, wie sich φαντασία von der Wahrnehmung, der Vernunft und der Meinung unterscheidet. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von φαντασία für die aristotelische Seelenlehre und die gegenwärtige Forschung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Bedeutung von φαντασία in Aristoteles' De anima, die Rolle von φαντασία im Erkenntnisprozess, die Unterscheidung von φαντασία von anderen Erkenntnisformen wie Wahrnehmung, Vernunft und Meinung, die Interpretation von φαντασία in der Fachwissenschaft und die Bedeutung von φαντασία für die aristotelische Seelenlehre.
- Quote paper
- Florian Stenke (Author), 2014, Die Bedeutung von φαντασία (phantasia) in Aristoteles' "De anima", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284344