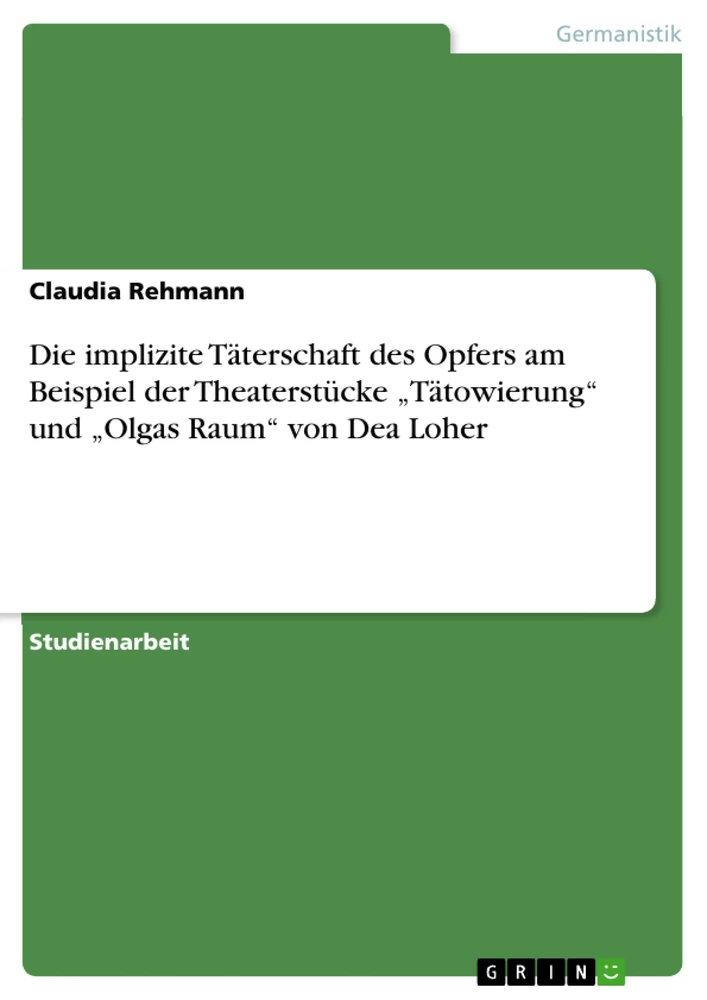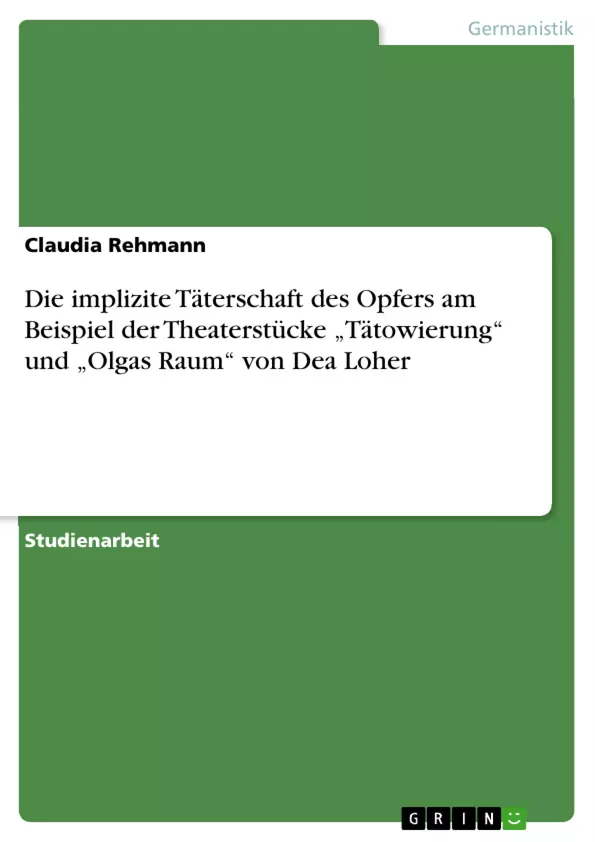"Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbst gewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen." (Karl Marx).
Die vorliegende Hausarbeit wird in dem Seminar „Theater der Versehrten“ geschrieben und ist Bestandteil des Moduls „L 2.2
Literaturgeschichte I“.
Um die These zu untersuchen, ob ein Opfer nicht auch janusköpfig einen Täter beheimatet, und, wenn ja, unter welchen Umständen dieser sich offenbart, entschied ich mich für die Untersuchung und einen Vergleich zweier thematisch weit auseinander klaffender Frauenfiguren des Theaters Dea Lohers. Da ist zum einen die „wegsehende“ Mutter in dem Stück „Tätowierung“, das den sexuellen Kindesmissbrauchs fokussiert, zum anderen „Olgas Raum“, in dem der Machtmissbrauch des Naziregimes bzw. dem ihrer Schergen thematisiert wird.
Zu den Stücken ist zu sagen, „Loher dramatisiert eine konkret fassbare Gesellschaftskritik“; sie setzt sich mit dem Thema Gewalt ebenso auseinander, wie mit dem der individuellen Freiheit. Hier werden also sozialkritische Themen transportiert, die aber nicht mit erhobenem Zeigefinger umgesetzt werden und auch keine Lösung mitliefern, die jedoch „durch die Darstellung den Blick für die Realität [schärfen]“.
Zuerst werden kurz die Stücke vorgestellt, dann die jeweils prominenten Frauenfiguren. Schließlich wird - entsprechend dem Seminarthema - auf die Versehrungen eingegangen. Es
folgt ein Vergleich der beiden Protagonistinnen, der mit einem Fazit endet, ob die aufgestellte These bei näherer Betrachtung standhält.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Tätowierung
- 2.1 Juliane
- 2.2 Exemplarische Versehrung/en
- 3. Olgas Raum
- 3.1 Olga
- 3.2 Exemplarische Versehrung/en
- 4. Vergleich der Frauenfiguren
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die These, ob Opfer in Dea Lohers Stücken „Tätowierung“ und „Olgas Raum“ auch Aspekte der Täterschaft in sich tragen und unter welchen Umständen diese zum Vorschein kommt. Verglichen werden die Frauenfiguren Juliane und Olga, die in unterschiedlichen Kontexten von Gewalt betroffen sind – sexueller Kindesmissbrauch und der Machtmissbrauch des Naziregimes.
- Die Rolle des Opfers und die implizite Täterschaft
- Vergleichende Analyse zweier Frauenfiguren in Dea Lohers Stücken
- Analyse von Schweigen und Passivität als Formen der Mitschuld
- Die Darstellung von Gewalt und individueller Freiheit in Dea Lohers Werk
- Sozialkritische Aspekte in den Dramen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der impliziten Täterschaft von Opfern dar. Sie begründet die Wahl der Stücke „Tätowierung“ und „Olgas Raum“ von Dea Loher und skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse der Frauenfiguren Juliane und Olga sowie einen Vergleich beider Figuren umfasst. Die Einleitung betont den sozialkritischen Aspekt von Lohers Werk, ohne explizite Lösungen anzubieten, aber den Blick für die Realität zu schärfen.
2. Tätowierung: Dieses Kapitel analysiert Dea Lohers Stück „Tätowierung“, welches den Inzest innerhalb einer scheinbar spießbürgerlichen Familie thematisiert. Der Fokus liegt auf der Figur der Mutter Juliane, deren passiv-abhängiges Verhalten und Schweigen angesichts des sexuellen Missbrauchs ihrer Tochter durch ihren Mann, Wolfgang, im Zentrum der Analyse steht. Julianes Verhalten wird als eine Form der impliziten Täterschaft interpretiert, da ihr Schweigen und ihre Weigerung, einzugreifen, den Missbrauch ermöglichen. Die Analyse beleuchtet Julianes Abhängigkeit von Wolfgang und ihre ambivalenten Gefühle, ihre Selbstzerstörungstendenzen und die Dynamik ihrer Beziehung zu ihren Töchtern, Anita und Lulu. Die Kapitel untersucht die Parentifizierung und die Rollenvertauschung zwischen Mutter und Tochter, sowie die implizite Mitschuld Juliane's an dem Geschehen.
Schlüsselwörter
Dea Loher, Tätowierung, Olgas Raum, Opfer, Täter, implizite Täterschaft, Schweigen, Passivität, Gewalt, sexueller Kindesmissbrauch, Naziregime, Machtmissbrauch, Frauenfiguren, Sozialkritik, individuelle Freiheit, Parentifizierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu der Hausarbeit: Implizite Täterschaft bei Dea Loher
Was ist das zentrale Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die These, ob Opfer in Dea Lohers Stücken „Tätowierung“ und „Olgas Raum“ Aspekte der Täterschaft in sich tragen und unter welchen Umständen dies zum Vorschein kommt. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Frauenfiguren Juliane und Olga, die in unterschiedlichen Kontexten von Gewalt betroffen sind (sexueller Kindesmissbrauch und Machtmissbrauch des Naziregimes).
Welche Stücke von Dea Loher werden analysiert?
Die Hausarbeit analysiert die Stücke „Tätowierung“ und „Olgas Raum“. „Tätowierung“ thematisiert Inzest innerhalb einer Familie, während „Olgas Raum“ den Machtmissbrauch im Kontext des Naziregimes behandelt.
Welche Figuren stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die zentralen Figuren der Analyse sind Juliane aus „Tätowierung“ und Olga aus „Olgas Raum“. Der Vergleich beider Figuren soll Aufschluss über die implizite Täterschaft von Opfern geben.
Wie wird die implizite Täterschaft der Opfer definiert?
Die implizite Täterschaft wird durch passives Verhalten, Schweigen und die Weigerung, einzugreifen, definiert. Die Hausarbeit untersucht, wie dieses Verhalten zum Fortbestand der Gewalt beiträgt.
Welche Aspekte von Gewalt werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt sexuellen Kindesmissbrauch in „Tätowierung“ und Machtmissbrauch im Kontext des Naziregimes in „Olgas Raum“. Es wird analysiert, wie diese Gewalt die Figuren prägt und wie sie darauf reagieren.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Hausarbeit verwendet eine vergleichende Analyse der Frauenfiguren Juliane und Olga. Sie untersucht deren Verhalten, Motive und die Dynamik ihrer Beziehungen zu anderen Figuren.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Hausarbeit diskutiert?
Schlüsselkonzepte sind Opferrolle, Täterschaft, implizite Täterschaft, Schweigen, Passivität, Gewalt, sexueller Kindesmissbrauch, Machtmissbrauch, Parentifizierung und die Darstellung von individueller Freiheit im Kontext sozialkritischer Aspekte.
Was ist das Fazit der Hausarbeit (ohne Spoiler)?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der vergleichenden Analyse zusammen und diskutiert die zentrale Forschungsfrage nach der impliziten Täterschaft von Opfern in den ausgewählten Stücken von Dea Loher. Es werden keine expliziten Lösungen angeboten, sondern der Blick auf die Realität geschärft.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zur Analyse von „Tätowierung“ und „Olgas Raum“, einen Vergleich der Frauenfiguren und ein Fazit. Zusätzlich werden die Zielsetzung, Themenschwerpunkte und Schlüsselwörter aufgeführt.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Hausarbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, die die jeweiligen Schwerpunkte und Ergebnisse der Analyse detailliert beschreibt. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt und die Argumentationslinie jedes Kapitels.
- Quote paper
- Claudia Rehmann (Author), 2011, Die implizite Täterschaft des Opfers am Beispiel der Theaterstücke „Tätowierung“ und „Olgas Raum“ von Dea Loher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284190