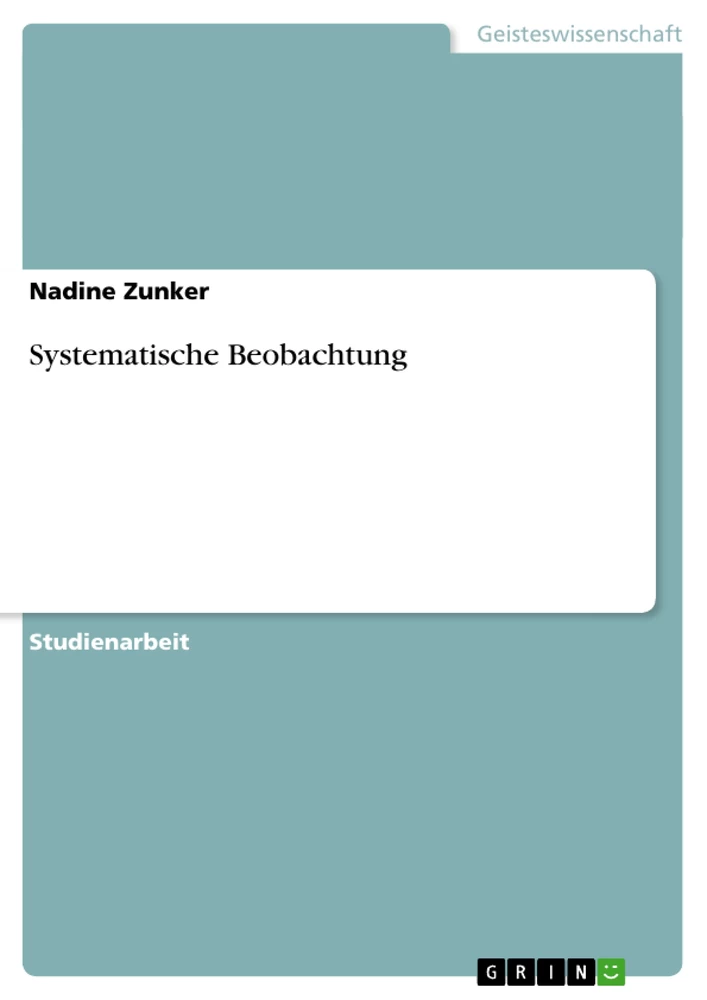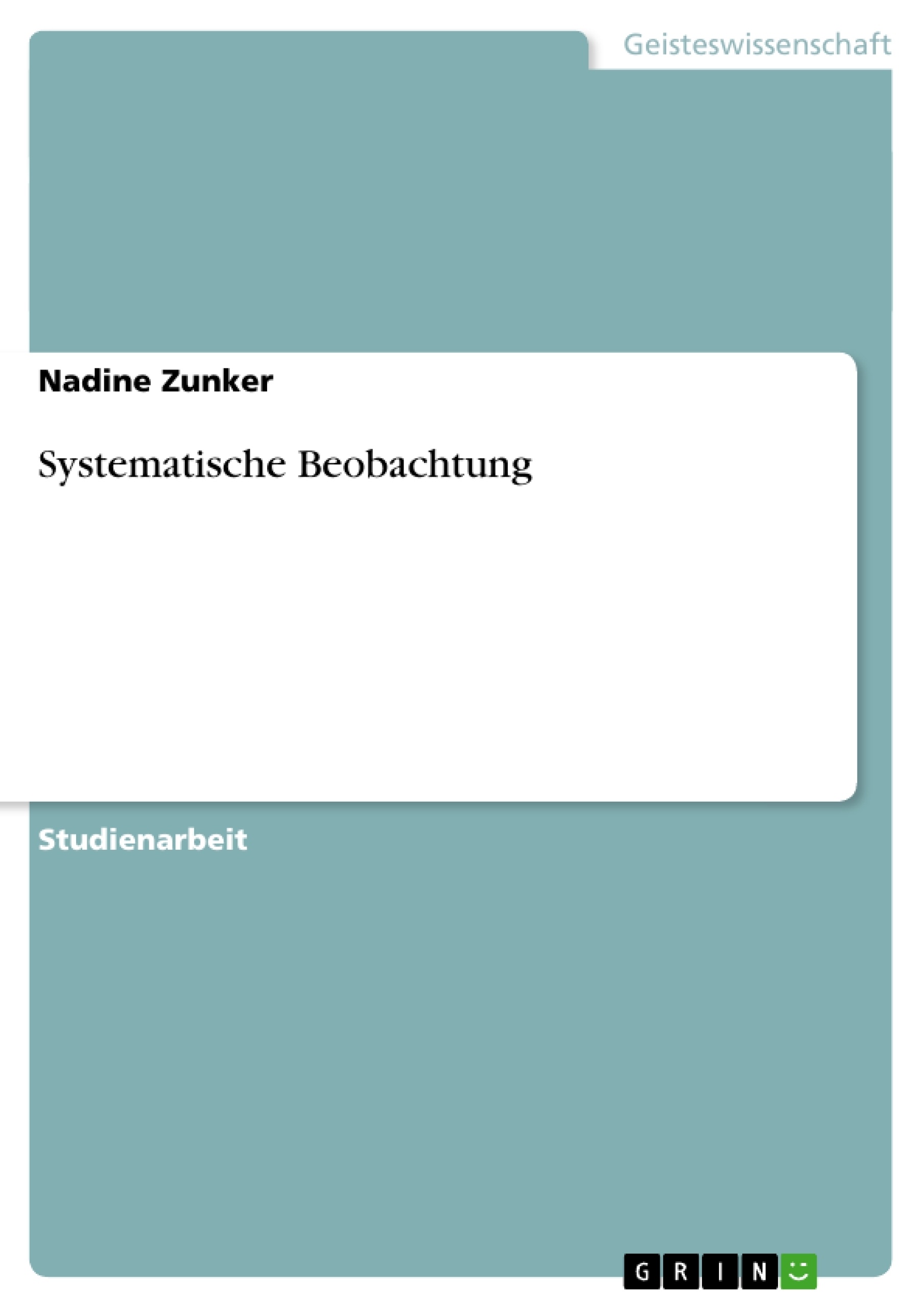Die Beobachtung wird im allgemeinen als die „ursprünglichste“ Datenerhebungstechnik betrachtet, denn hier wird die Nähe zu alltäglichen Techniken zur Erlangung von Informationen besonders deutlich.
Ein Übergang von der alltäglichen „naiven“ Beobachtung zur wissenschaftlichen Beobachtung erfolgt dadurch, dass das Verfahren der Beobachtung kontrolliert und systematisch abläuft.
„Beobachtung ist die planmäßige Erfassung sinnlich wahrnehmbarer Tatbestände, wobei der Forscher dem Untersuchungsobjekt gegenüber eine rezeptive Haltung einnimmt. Durch diese rezeptive Haltung unterscheidet sich die Beobachtung sowohl vom Interview wie auch vom Experiment, indem nämlich darauf verzichtet wird, durch verbale und andere Reize die erwünschten Reaktionen hervorrufen.“ (SCHEUCH, 1958, S. 210)
Der Unterschied zur alltäglichen Beobachtung besteht nicht in der Art und Weise des Beobachtens, sondern vielmehr im Beweggrund des Beobachtens.
„Während alltägliches Beobachten der Orientierung der Akteure in der Welt dient, ist das Ziel der wissenschaftlichen Beobachtung die Beschreibung bzw. Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit vor dem Hintergrund einer leitenden Forschungsfrage.“
(ATTESLANDER, 1995, S. 87)
Ein weiterer Unterschied ist die Anwendung systematischer Verfahrensweisen, während die alltägliche Beobachtung eher unreflektiert abläuft. Das Ziel solch einer wissenschaftlichen Beobachtung ist es weiterhin, ihre Ergebnisse einer wissenschaftlichen Diskussion zu unterziehen, das heißt sie ist „wiederholten Prüfungen und Kontrollen hinsichtlich der Gültigkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit unterworfen“
(KÖNIG, 1972, S. 77)
In der Soziologie findet die Beobachtung allerdings eher selten Anwendung. Darauf weist Jürgen Fiedrichs, mit der Begründung, „dass die Beobachtung Hypothesen über das Verhalten von Individuen verlangt, zu denen dann Analysen und Prognosen nötig sind. In den Hypothesen sind Variablen enthalten, deren Messung anhand der Kategorien des Forschers erfolgt, er interpretiert Bewegung, räumliche Distanz und Interaktion.“, hin.
(FRIEDRICHS, 1985)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Beobachtung
- 1.1 Begriffsbestimmung „Beobachtung“
- 1.2 Geschichte der Beobachtung
- 1.3 Quantitativ/qualitativ orientierte Beobachtung
- 1.4 Die Beobachtung und ihre Vorteile bzw. Nachteile
- 2. Elemente der Beobachtung
- 2.1 Beobachtungsfeld
- 2.2 Beobachtungseinheit
- 2.3 Beobachter/Beobachtete
- 2.4 Protokollieren
- 3. Beobachtungsformen
- 3.1 Teilnehmende Beobachtung/ nicht-teilnehmende Beobachtung
- 3.2 Offene Beobachtung/verdeckte Beobachtung
- 3.3 Strukturierte Beobachtung/unstrukturierte Beobachtung
- 3.4 Natürliche Beobachtung/künstliche Beobachtung
- 3.5 Fremdbeobachtung/Selbstbeobachtung
- 3.6 Zusammenfassung
- 4. Diskrepanz zwischen Befragung und Beobachtung
- 5. Fehlerquellen
- 5.1 Fehler durch den Beobachter
- 5.2 Systematische Fehler
- 5.3 Reaktiver Effekt
- 6. Beobachtungsverfahren
- 6.1 Die Interaktionsanalyse
- 6.1.1 Anwendungsbeispiel der balesschen Interaktionsanalyse
- 6.1.2 Problematik der balesschen Interaktionsanalyse
- 6.2 Beispiel einer teilnehmenden Beobachtung: „,Street Comer Society”
- 7. Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text stellt die Beobachtung als Methode der Sozialforschung vor. Ziel ist es, die Besonderheiten der wissenschaftlichen Beobachtung im Vergleich zur alltäglichen Beobachtung aufzuzeigen und verschiedene Aspekte und Dimensionen der Methode zu beleuchten.
- Begriffliche Abgrenzung und historische Entwicklung der Beobachtung
- Unterscheidung zwischen quantitativ und qualitativ orientierter Beobachtung
- Vorteile und Nachteile der Beobachtung als Forschungsmethode
- Elemente und Formen der Beobachtung
- Fehlerquellen und Beobachtungsverfahren
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema „Beobachtung“ ein und erläutert den Unterschied zwischen alltäglicher und wissenschaftlicher Beobachtung. Die Geschichte der Beobachtung in den Sozialwissenschaften wird skizziert und die Unterscheidung zwischen quantitativ und qualitativ orientierter Beobachtung wird beleuchtet. Kapitel 2 befasst sich mit den Elementen der Beobachtung, wobei Beobachtungsfeld, Beobachtungseinheit und Beobachter/Beobachtete im Fokus stehen. Kapitel 3 präsentiert verschiedene Beobachtungsformen, einschließlich teilnehmender und nicht-teilnehmender, offener und verdeckter, strukturierter und unstrukturierter Beobachtung sowie natürlicher und künstlicher Beobachtung. Die Diskrepanz zwischen Befragung und Beobachtung wird in Kapitel 4 beleuchtet. Kapitel 5 befasst sich mit möglichen Fehlerquellen, die bei Beobachtungen auftreten können. Abschließend werden in Kapitel 6 verschiedene Beobachtungsverfahren, wie die Interaktionsanalyse und Beispiele für teilnehmende Beobachtung, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenschwerpunkte des Textes sind: Beobachtung, wissenschaftliche Beobachtung, alltägliche Beobachtung, quantitative Beobachtung, qualitative Beobachtung, Beobachtungsfeld, Beobachtungseinheit, Beobachtungsformen, Interaktionsanalyse, teilnehmende Beobachtung, Fehlerquellen, methodische Kontrolle, Sozialforschung.
- Quote paper
- Nadine Zunker (Author), 2004, Systematische Beobachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28418