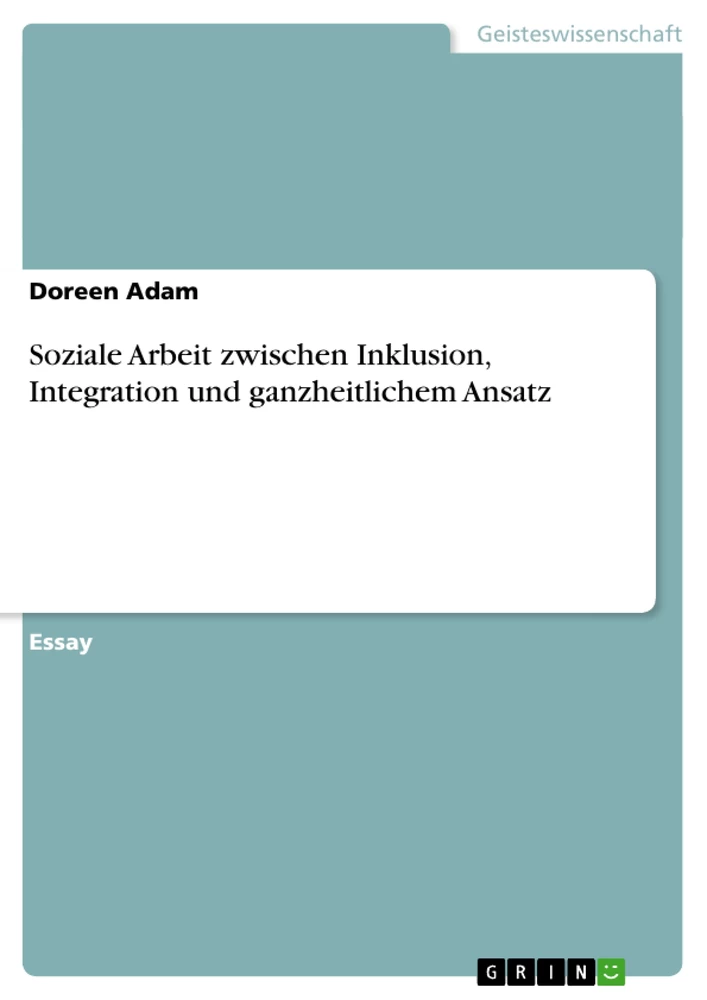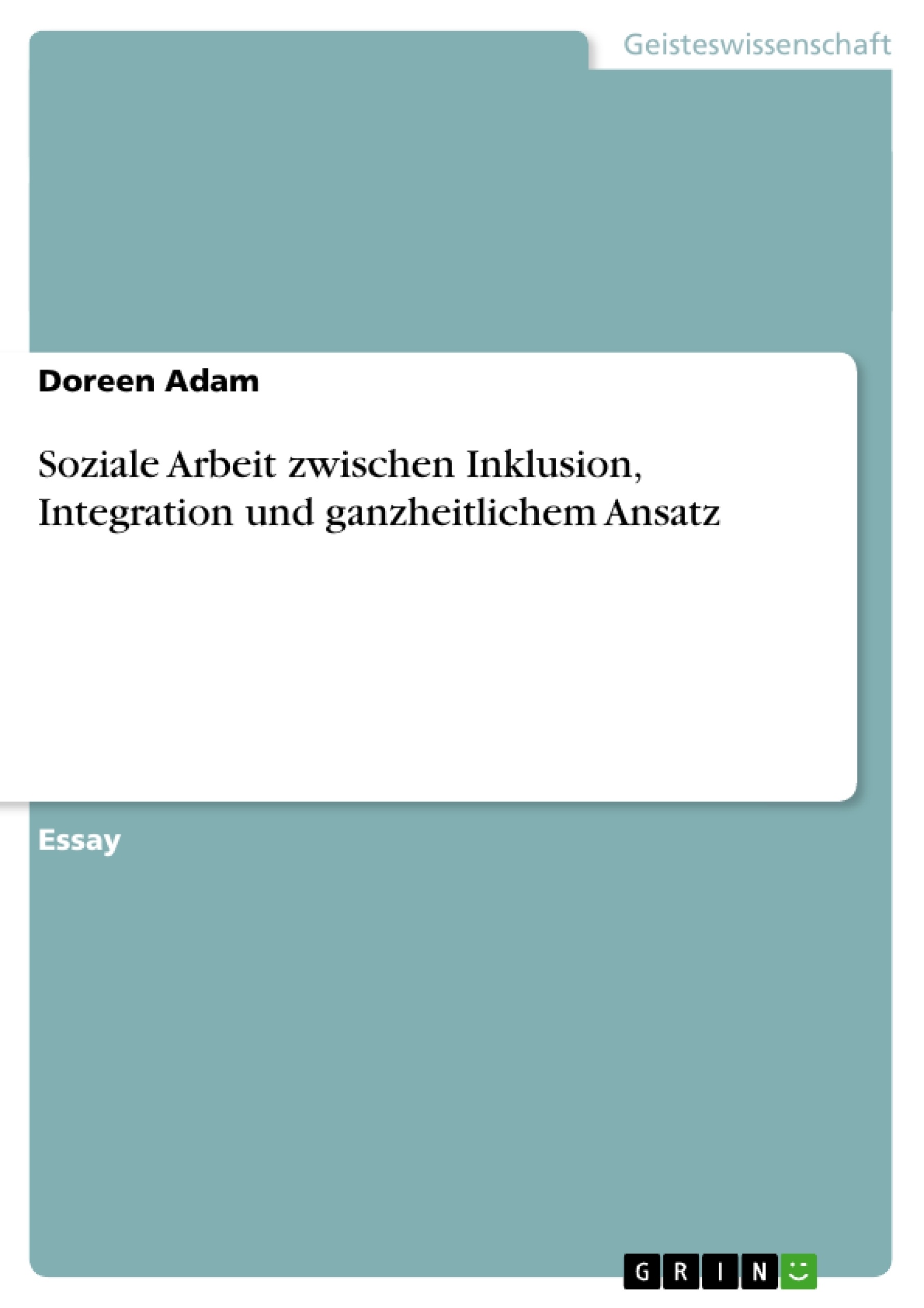Soziale Arbeit hat u.a. die Aufgabe Soziale Teilhabe zu fördern, Exklusion zu mindern bzw. zu vermeiden. Integration und Inklusion sind die Zauberwörter in diesem Zusammenhang. Nur was verbirgt sich hinter diesen Begriffen und verstehen wir alle das Gleiche, wenn wir diese Begrifflichkeiten verwenden?
Heiko Kleve ist der Meinung, dass eine Funktion der Sozialen Arbeit ist, Inklusion zu vermitteln oder stellvertretend zu inkludieren, wenn die Vermittlung misslingt.
Der DBSH (Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V.) informiert über die im Juli 2014 in der Generalversammlung des IFSW (International Federation of Social Workers) und IASSW (International Association of Schools of Social Work) verabschiedete Definition der Sozialen Arbeit.
„Soziale Arbeit ist eine praxisorientierte Profession und eine wissenschaftliche Disziplin, dessen bzw. deren Ziel die Förderung des sozialen Wandels, der sozialen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sowie die Stärkung und Befreiung der Menschen ist. Die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, die Menschenrechte, gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlagen der Sozialen Arbeit. Gestützt auf Theorien zur Sozialen Arbeit, auf Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und indigenem Wissen, werden bei der Sozialen Arbeit Menschen und Strukturen eingebunden, um existenzielle Herausforderungen zu bewältigen und das Wohlergehen zu verbessern. Die obige Definition kann auf nationaler und/oder regionaler Ebene noch erweitert werden."
Widerspricht sich diese Definition mit der Aussage Heiko Kleves? Um diese Frage beantworten zu können muss zuerst die Systemtheorie von Heiko Kleve angelehnt an Niklas Luhmann und Jürgen Habermas erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Eileitung
- Integration
- Inklusion
- Integration und Inklusion
- These
- Praxis/DBSH/ganzheitlicher Ansatz
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit der Rolle der Sozialen Arbeit im Kontext von Inklusion und Exklusion. Er analysiert die Begriffe Integration und Inklusion im Lichte der Systemtheorie von Niklas Luhmann und der Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas. Der Essay untersucht, wie Soziale Arbeit die soziale Teilhabe von Individuen in der modernen Gesellschaft fördern kann, insbesondere im Hinblick auf die Herausforderungen der Inklusion in den verschiedenen Funktionssystemen und Lebenswelten.
- Die Unterscheidung zwischen Integration und Inklusion im Kontext der Sozialen Arbeit
- Die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Vermittlung von Inklusion und der stellvertretenden Inklusion
- Die Bedeutung des ganzheitlichen Ansatzes in der Sozialen Arbeit
- Die Herausforderungen der Inklusion in der modernen Gesellschaft
- Die Bedeutung der sozialen Gerechtigkeit und der Menschenrechte in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Bedeutung von Inklusion und Integration in der Sozialen Arbeit und beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf diese Begriffe. Der Essay bezieht sich dabei auf die Definition der Sozialen Arbeit durch den DBSH und die These von Heiko Kleve, der die Funktion der Sozialen Arbeit als Vermittlerin von Inklusion beschreibt.
Das Kapitel "Integration" analysiert den Begriff der Integration im Kontext der Sozialen Arbeit und stellt die normative Einbindung von Individuen in die Gesellschaft in den Vordergrund. Es wird deutlich, dass dieses Integrationskonzept im Lichte der Systemtheorie von Niklas Luhmann und der Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas als veraltet betrachtet werden kann.
Das Kapitel "Inklusion" beschreibt die moderne Gesellschaft als funktional differenzierte Gesellschaft, die sich in verschiedene Funktionssysteme aufteilt. Es wird argumentiert, dass die soziale Teilhabe an diesen Systemen nicht als Integration, sondern als Inklusion verstanden werden sollte. Inklusion bezieht sich dabei auf die Relevanz von Personen für die Funktionssysteme und die Möglichkeit, Kommunikationsmedien wie Geld, Bildung, Wissen oder Recht einzubringen.
Das Kapitel "Integration und Inklusion" schlägt vor, den Begriff Integration im Bereich der Lebenswelten zu verwenden, während Inklusion für die soziale Partizipation an den Funktionssystemen verwendet werden sollte. Es wird deutlich, dass zwischen den Anforderungen der Funktionssysteme und den Lebenswelten eine Diskrepanz besteht, die die Klientel der Sozialen Arbeit vor Herausforderungen stellt.
Das Kapitel "These" befasst sich mit der These von Heiko Kleve, der die Funktion der Sozialen Arbeit als Vermittlerin von Inklusion beschreibt. Es wird argumentiert, dass Soziale Arbeit die Aufgabe hat, Exklusion von Individuen aus den Funktionssystemen zu beobachten, diese Ausschlüsse zum Thema zu machen und zu re-inkludieren.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Inklusion, Exklusion, Integration, Soziale Arbeit, Systemtheorie, Niklas Luhmann, Jürgen Habermas, Funktionssysteme, Lebenswelten, soziale Teilhabe, soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, ganzheitlicher Ansatz, Desintegration, Re-Inklusion.
- Quote paper
- Doreen Adam (Author), 2014, Soziale Arbeit zwischen Inklusion, Integration und ganzheitlichem Ansatz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284013