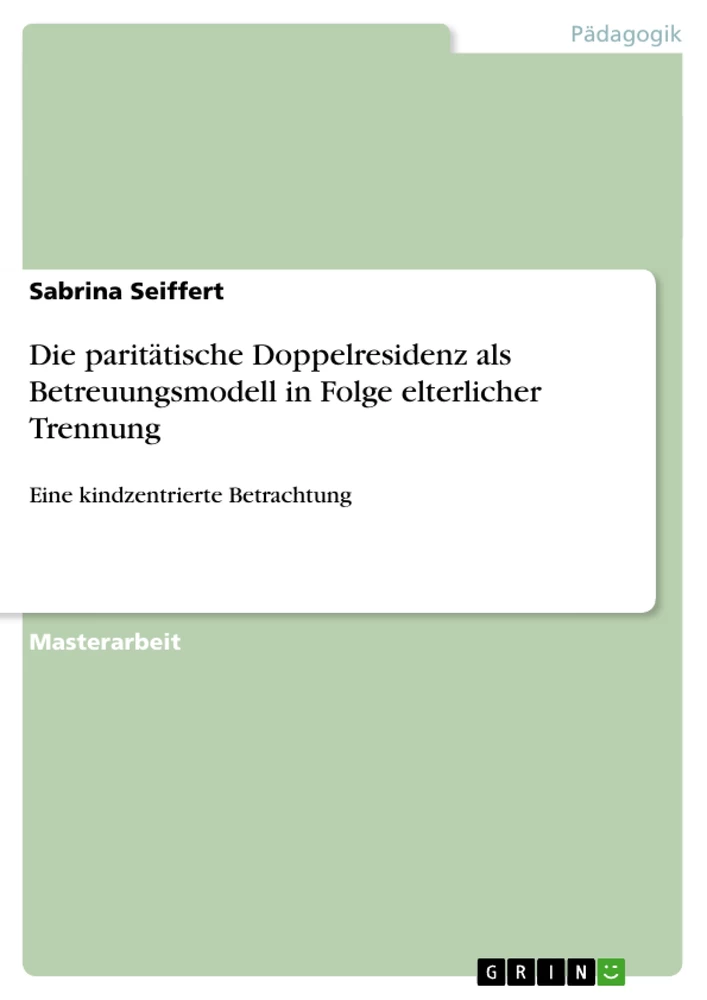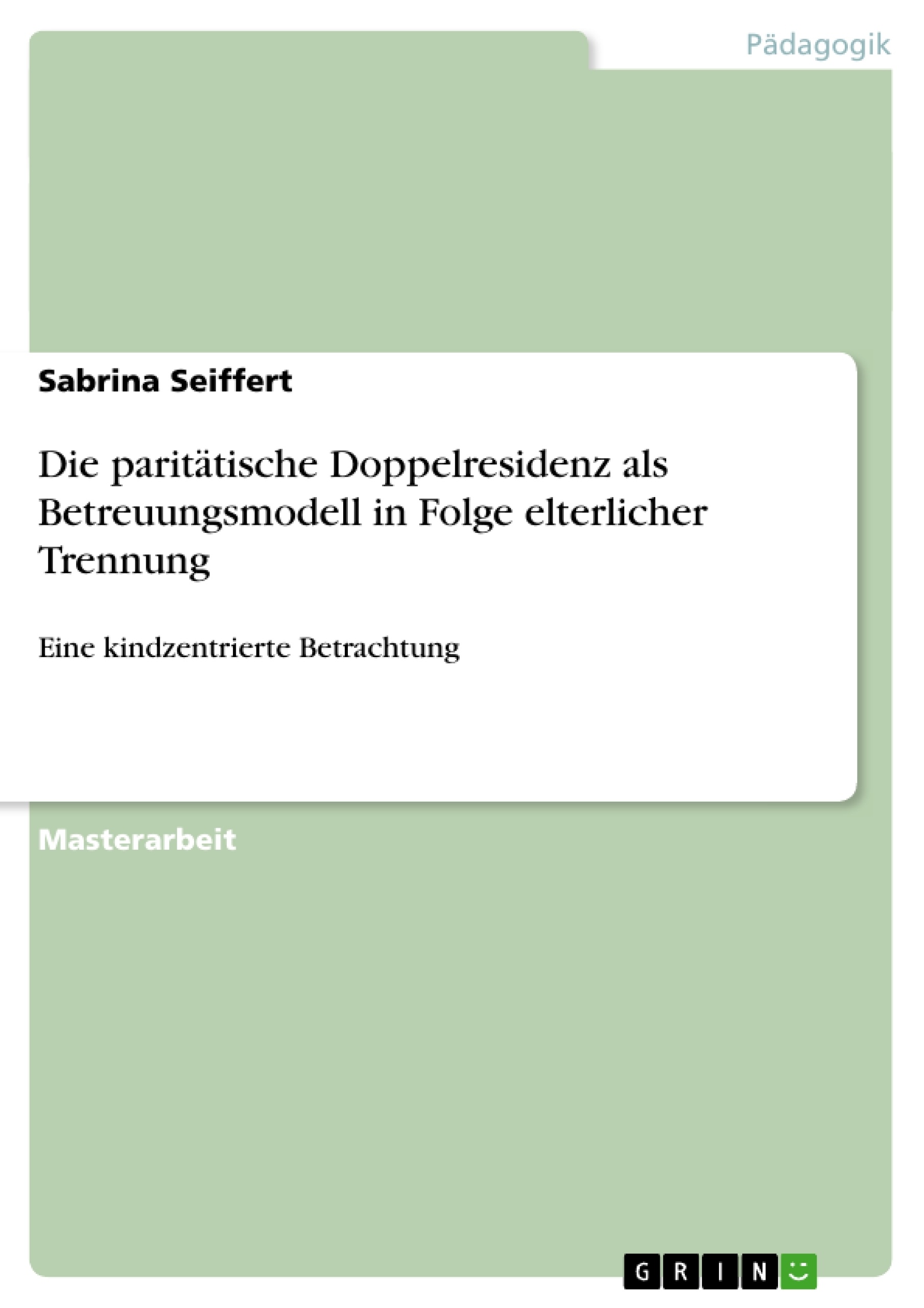Kinder sind unsere Zukunft. Dieser Satz ist häufig zu hören, wenn politische Debatten über Familie und Jugend geführt werden. Dennoch ist er unvollständig. Die Belange der Kinder sind nicht nur Zukunftsmusik, sie sind Gegenwart. Das Leben in ihrer Familie, Streit zwischen ihren Eltern, Versöhnungsversuche und letztendlich doch die endgültige Trennung verbunden mit einem völlig neuen Leben ist ihr Alltag, ihre Realität. Und auch wenn Eltern die Verantwortung für ihre Kinder mit der Loslösung vom Partner nicht abgeben, sondern vielmehr bewusster wahrnehmen sollten als je zuvor, überlagert die eigene Gefühlswelt häufig diese ihnen obliegende Pflicht. Somit liegt es dann in der Entscheidungsgewalt von Richtern und Richterinnen mit der Hilfe von fachkundigen Sachverständigen und den zugrunde liegenden Gesetzestexten, das weitere Leben der Kinder maßgeblich zu gestalten.
In Zahlen ausgedrückt waren im Jahr 2011 rund 148.200 minderjährige Kinder von der Scheidung ihrer Eltern betroffen (vgl. Statistisches Bundesamt 2013: 50). Eine Sorgerechtserklärung wurde für 135.000 von ihnen abgegeben (vgl. Statistisches Bundesamt 2012: 7). Selbst ungeachtet der Familien, deren Trennung nicht statistisch erfasst wird, betrifft die offizielle Regelung des Sorgerechts und künftigen Aufenthalts eine Vielzahl von Kindern. Aufgrund der bedeutungsschweren Thematik und den genannten Zahlen beleuchtet diese Arbeit eine Möglichkeit, der Pflicht zur Sorge und der Regelung des Aufenthalts für die eigenen Kinder infolge einer Trennung nachzukommen. Die paritätische Doppelresidenz, also die zeitlich annähernd gleiche Betreuung des Nachwuchses von beiden Eltern, findet zunehmend Einzug in die Gerichtssäle und Köpfe der Eltern. Somit stellt sich für diese Arbeit die Forschungsfrage, ob dieses Betreuungsmodell als gerichtlicher Standard für Beschlüsse in Sorgerechtsfällen geeignet erscheint und ob dessen Anwendung an Voraussetzungen geknüpft sein sollte. Dabei helfen soll die Konkretisierung des Kindeswohlbegriffs, welcher zwar in aller Munde ist aber dennoch einer einheitlichen Definition entbehrt.
Zum besseren Verständnis der Arbeit werden zunächst die wichtigsten Arbeitsbegriffe näher erläutert. Anschließend folgt die Darlegung der psychologischen Grundlagen anhand von Fachliteratur, welche für eine Annäherung an die Forschungsfrage notwendig erscheinen. Das fünfte Kapitel setzt sich sodann mit den rechtlichen Aspekten und Rahmenbedingungen auseinander. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Das Kind im Fokus der Betreuung – Eine Einführung
- Terminologie
- Das Domizil- oder Residenzmodell
- Die paritätische Doppelresidenz (Wechselmodell)
- Das Nestmodell
- Der Kindeswohlbegriff
- Psychologische Grundlagen
- Scheidungsfolgen für Kinder
- Aspekte der Bindungstheorie
- Bedürfnisorientierung nach Brazelton/Greenspan
- Theoretische Schlussfolgerungen für die Forschungsfrage
- Rechtlicher Exkurs
- Fakten und Zahlen zu Sorgerechts- und Umgangsverfahren
- Kinderrechte
- Internationale Normen
- Europäische Normen
- Deutsche Normen
- Theoretische Schlussfolgerungen für die Forschungsfrage
- Eigene Forschung
- Interviews mit Kindern
- Zugang
- Methodik
- Ethische Fragen
- Durchführung der Interviews
- Sarah
- Nicole und Marie
- Elisabeth
- Dana und Lukas
- Datenanalyse
- Reflexion des Forschungsprozesses
- Zusammenfassung der Ergebnisse und kritische Betrachtung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die paritätische Doppelresidenz als Betreuungsmodell für Kinder nach elterlicher Trennung. Ziel ist es, die Eignung dieses Modells als gerichtlichen Standard zu evaluieren und eventuelle Voraussetzungen für seine Anwendung zu identifizieren. Der Kindeswohlbegriff spielt dabei eine zentrale Rolle.
- Die Auswirkungen der elterlichen Trennung auf Kinder
- Psychologische Grundlagen der Kindesentwicklung im Kontext von Trennung und Scheidung
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Kinderrechte bezüglich Sorgerecht und Umgang
- Analyse der paritätischen Doppelresidenz als Betreuungsmodell
- Empirische Untersuchung anhand von Interviews mit betroffenen Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kind im Fokus der Betreuung – Eine Einführung: Dieses einführende Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es die Bedeutung der Berücksichtigung kindlicher Bedürfnisse im Kontext elterlicher Trennung herausstellt. Es werden wichtige Begriffe definiert und die Forschungsfrage formuliert: Ist die paritätische Doppelresidenz als Standardlösung in Sorgerechtsfällen geeignet? Die hohe Zahl betroffener Kinder in Deutschland unterstreicht die Relevanz der Thematik. Das Kapitel skizziert den Aufbau der Arbeit und die methodischen Ansätze.
Psychologische Grundlagen: Dieses Kapitel beleuchtet die psychologischen Auswirkungen von Scheidung auf Kinder und analysiert relevante Theorien, insbesondere die Bindungstheorie und die bedürfnisorientierte Entwicklung nach Brazelton/Greenspan. Es wird dargelegt, wie diese Theorien die Eignung der paritätischen Doppelresidenz als Betreuungsmodell beeinflussen können. Der Fokus liegt auf dem Verständnis kindlicher Bedürfnisse und der Bedeutung stabiler Bindungen für die gesunde Entwicklung.
Rechtlicher Exkurs: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland bezüglich Sorgerecht und Umgang im Scheidungsfall. Es werden relevante Statistiken zu Sorgerechtsentscheidungen präsentiert, gefolgt von einer Darstellung internationaler, europäischer und deutscher Kinderrechte. Der Schwerpunkt liegt auf dem Recht des Kindes auf den Erhalt persönlicher Beziehungen zu beiden Elternteilen und der Notwendigkeit kindzentrierter Entscheidungen im Sorgerechtsverfahren.
Eigene Forschung: Dieses Kapitel beschreibt die eigene empirische Forschung der Autorin. Durch narrative Interviews mit Kindern, die in paritätischen Doppelresidenzmodellen leben, und die Auswertung thematischer Zeichnungen, wird versucht, die Perspektiven der Kinder auf das Betreuungsmodell zu erfassen. Der Abschnitt behandelt Methodik, ethische Aspekte und die Durchführung der Interviews. Die detaillierte Darstellung der einzelnen Interviews bietet Einblicke in die individuellen Erfahrungen der Kinder.
Schlüsselwörter
Paritätische Doppelresidenz, Wechselmodell, Sorgerecht, Kindeswohl, elterliche Trennung, Scheidung, Bindungstheorie, Kinderrechte, empirische Forschung, qualitative Forschung, narrative Interviews.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Paritätische Doppelresidenz als Betreuungsmodell nach elterlicher Trennung
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Eignung der paritätischen Doppelresidenz (auch Wechselmodell genannt) als Betreuungsmodell für Kinder nach elterlicher Trennung. Sie evaluiert dieses Modell als möglichen gerichtlichen Standard und identifiziert potenzielle Voraussetzungen für seine Anwendung. Der Kindeswohlbegriff spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Auswirkungen der elterlichen Trennung auf Kinder, die psychologischen Grundlagen der Kindesentwicklung in diesem Kontext (inkl. Bindungstheorie und bedürfnisorientierter Entwicklung nach Brazelton/Greenspan), die rechtlichen Rahmenbedingungen und Kinderrechte (national und international), eine Analyse der paritätischen Doppelresidenz als Betreuungsmodell und eine empirische Untersuchung anhand von Interviews mit betroffenen Kindern.
Welche Methoden wurden in der empirischen Forschung angewendet?
Die empirische Forschung basiert auf narrativen Interviews mit Kindern, die in paritätischen Doppelresidenzmodellen leben. Die Auswertung thematischer Zeichnungen ergänzt die Interviews. Die Arbeit beschreibt detailliert die Methodik, ethische Aspekte und die Durchführung der Interviews.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Eine Einführung, welche den Fokus auf das Kind und die Definition wichtiger Begriffe legt; Psychologische Grundlagen, die die Auswirkungen der Trennung auf Kinder und relevante Theorien beleuchten; einen Rechtlichen Exkurs zu Sorgerecht, Umgang und Kinderrechten; die Beschreibung der eigenen empirischen Forschung mit Interviews und Datenanalyse; eine Zusammenfassung der Ergebnisse und deren kritische Betrachtung; und schließlich einen Ausblick.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der narrativen Interviews mit Kindern, die im Kontext einer paritätischen Doppelresidenz aufwachsen. Die Ergebnisse werden analysiert und kritisch betrachtet, um die Eignung des Modells als Standardlösung zu beurteilen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Eignung der paritätischen Doppelresidenz als Standardlösung in Sorgerechtsfällen. Sie berücksichtigt dabei die psychologischen und rechtlichen Aspekte sowie die empirischen Befunde aus den Kinderinterviews. Die Arbeit bietet einen Beitrag zur Diskussion um kindgerechte Lösungen nach elterlicher Trennung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Paritätische Doppelresidenz, Wechselmodell, Sorgerecht, Kindeswohl, elterliche Trennung, Scheidung, Bindungstheorie, Kinderrechte, empirische Forschung, qualitative Forschung, narrative Interviews.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Familienrecht, Kindeswohl und Entwicklungspsychologie beschäftigen. Sie ist auch von Interesse für Praktiker im Bereich der Familienberatung und des Jugendhilfesystems sowie für Richter und Anwälte, die mit Sorgerechtsverfahren befasst sind. Eltern, die sich über verschiedene Betreuungsmodelle informieren möchten, könnten ebenfalls Nutzen aus dieser Arbeit ziehen.
- Quote paper
- B. A. Sabrina Seiffert (Author), 2014, Die paritätische Doppelresidenz als Betreuungsmodell in Folge elterlicher Trennung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283972